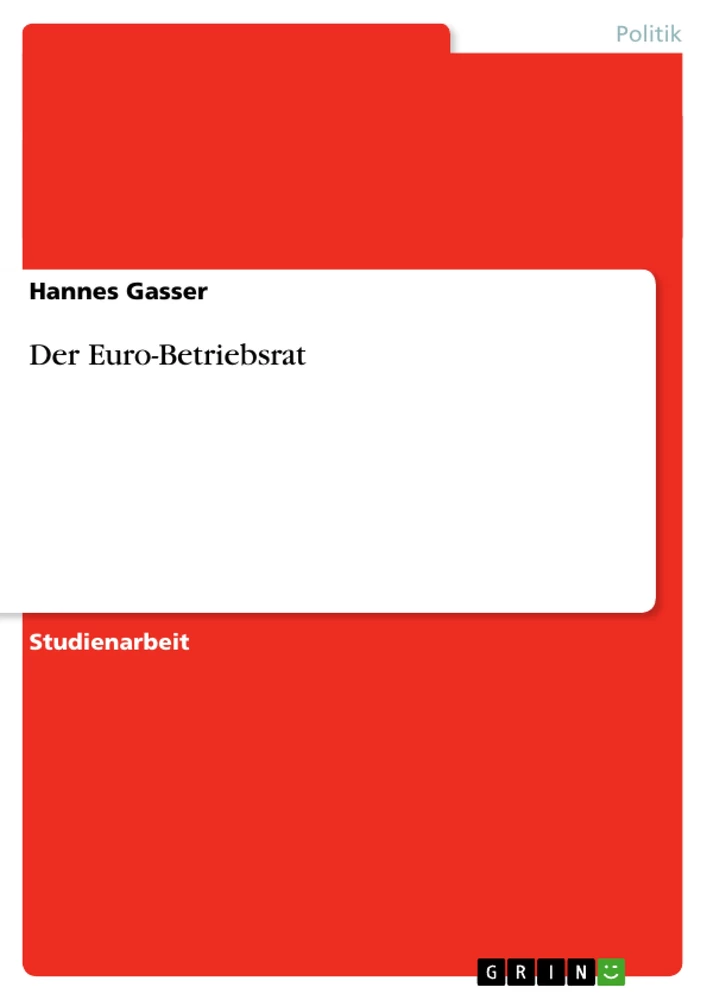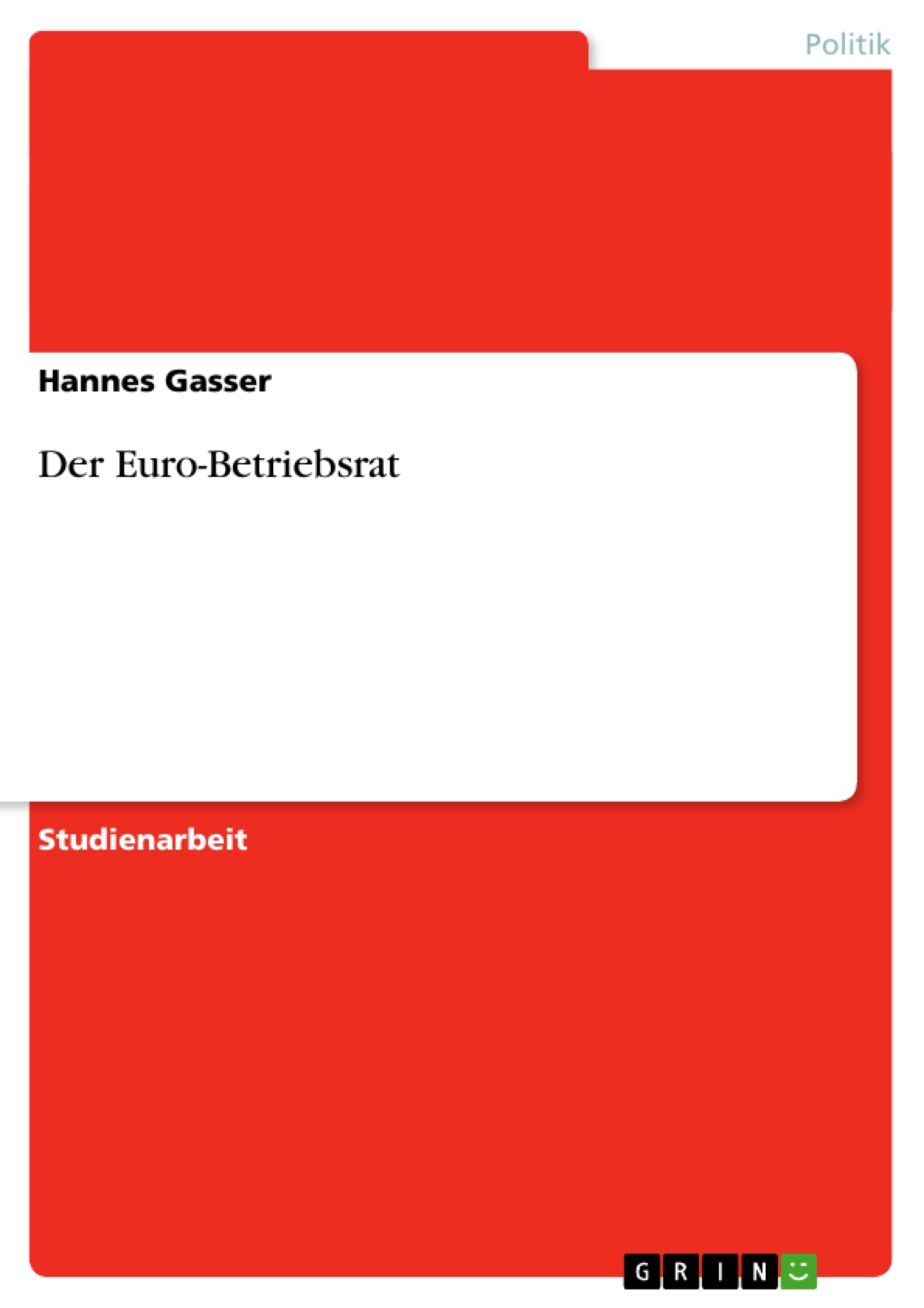Durch die multinationalen Konzerne haben sich die Ansprüche für eine erfolgreiche Arbeitnehmervertretung geändert. Nicht nur die Internationalisierung des Kapitals steht unter Druck, sondern auch die Internationalisierung von Mitbestimmungsregeln. Ein erstes Instrument dieser Internationalisierung gerecht zu werden, sind für europaweit agierende Unternehmen, die Eurobetriebsräte.
Ob und inwiefern die Eurobetriebsräte diesen Erfordernissen gerecht werden, werde ich versuchen in dieser Arbeit zu eruieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition
- Vorgeschichte
- Inhalte des Richtlinien-Vorschlages
- Geltungsbereich
- Weshalb einen Euro- Betriebsrat gründen
- Arbeitsteilung
- Konkurrenz zwischen den Betrieben
- Belegschaften
- EU-und EU-Erweiterung
- Verbreitung von Euro- Betriebsräten
- Auf dem Weg zu einem Euro- Betriebsrat
- Initiativrecht
- Das besondere Verhandlungsgremium
- Die Verhandlung
- Das Scheitern der Verhandlungen
- Aufgaben des Euro- Betriebsrates
- Die Befugnisse des Euro- Betriebsrates
- Unterrichtung und Konsultation
- Außergewöhnliche Umstände
- Beispiel
- Die Zusammensetzung des Euro- Betriebsrates
- Deutsches oder französisches Modell
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Funktionsweise von Euro-Betriebsräten im Kontext der Internationalisierung von Unternehmen und Arbeitnehmervertretungen. Sie analysiert die historischen Entwicklungen, die zu den Richtlinien für die Einführung von Euro-Betriebsräten führten, und beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die mit diesem neuen Gremium verbunden sind.
- Entwicklung und Bedeutung des Euro-Betriebsrats
- Rechtliche Grundlagen und Richtlinien zur Einführung von Euro-Betriebsräten
- Zusammensetzung, Aufgaben und Befugnisse des Euro-Betriebsrats
- Herausforderungen und Chancen für die Arbeitnehmervertretung im europäischen Kontext
- Die Rolle der Europäischen Union bei der Gestaltung der Mitbestimmungsrechte von Arbeitnehmern
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt den Euro-Betriebsrat vor, definiert seine Rolle und zeichnet seine Vorgeschichte nach. Es beleuchtet die Entstehung der Richtlinien für die Einführung des Gremiums und skizziert die wichtigsten Inhalte des Richtlinien-Vorschlags.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Gründen für die Gründung eines Euro-Betriebsrats. Es beleuchtet die Herausforderungen der Arbeitsteilung, die Konkurrenz zwischen Unternehmen und die Bedeutung der Belegschaften im europäischen Kontext.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Verbreitung von Euro-Betriebsräten. Es untersucht die praktische Umsetzung der Richtlinien und die Herausforderungen, die mit der Gründung eines Euro-Betriebsrats verbunden sind.
Das vierte Kapitel beleuchtet den Prozess der Gründung eines Euro-Betriebsrats. Es betrachtet das Initiativrecht, das besondere Verhandlungsgremium und die Verhandlungsphasen bis hin zum möglichen Scheitern der Verhandlungen.
Das fünfte Kapitel behandelt die Aufgaben des Euro-Betriebsrats. Es beschreibt die Rolle des Gremiums bei der Information und Konsultation der Arbeitnehmer in grenzüberschreitenden Unternehmen.
Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit den Befugnissen des Euro-Betriebsrats. Es betrachtet die Rechte zur Unterrichtung und Konsultation der Arbeitnehmer in verschiedenen Situationen, einschließlich außergewöhnlicher Umstände.
Das siebte Kapitel untersucht die Zusammensetzung des Euro-Betriebsrats. Es diskutiert die verschiedenen Modelle für die Sitzverteilung und die Wahl der Mitglieder.
Schlüsselwörter
Euro-Betriebsrat, Arbeitnehmervertretung, Internationalisierung, Mitbestimmung, EU-Richtlinien, transnationales Unternehmen, Unterrichtung, Konsultation, Verhandlungsgremium, Arbeitnehmerrechte, Europäische Union, Arbeitsteilung, Konkurrenz, Belegschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Euro-Betriebsrat (EBR)?
Ein Euro-Betriebsrat ist ein Gremium zur Information und Konsultation der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit tätigen Unternehmen innerhalb der EU.
Warum werden Euro-Betriebsräte gegründet?
Sie dienen dazu, die Arbeitnehmervertretung zu internationalisieren, um auf grenzüberschreitende Entscheidungen multinationaler Konzerne reagieren zu können.
Welche Befugnisse hat ein Euro-Betriebsrat?
Der EBR hat primär Rechte auf Unterrichtung und Konsultation bei Angelegenheiten, die mindestens zwei Standorte in verschiedenen EU-Ländern betreffen.
Was ist das "Besondere Verhandlungsgremium"?
Es ist eine Gruppe von Arbeitnehmervertretern, die mit der Unternehmensleitung die konkrete Ausgestaltung und Arbeitsweise des zukünftigen Euro-Betriebsrats aushandelt.
Gibt es Unterschiede zwischen dem deutschen und französischen Modell?
Ja, die Arbeit untersucht verschiedene nationale Traditionen der Mitbestimmung und wie diese die Zusammensetzung und Arbeitsweise des EBR beeinflussen.
- Citation du texte
- Hannes Gasser (Auteur), 2005, Der Euro-Betriebsrat, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47399