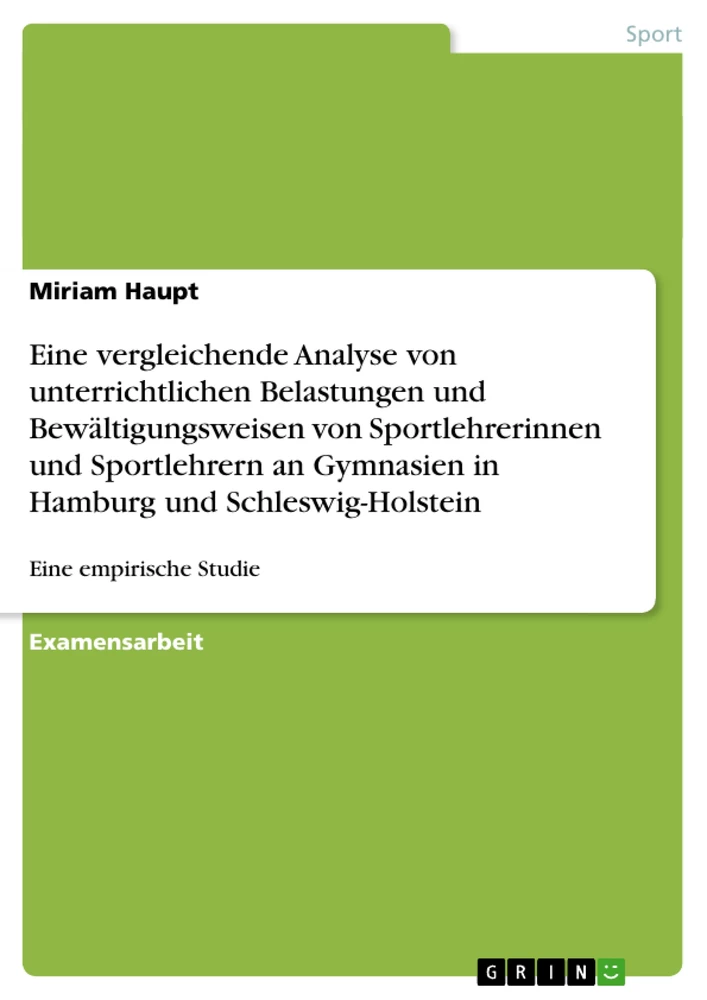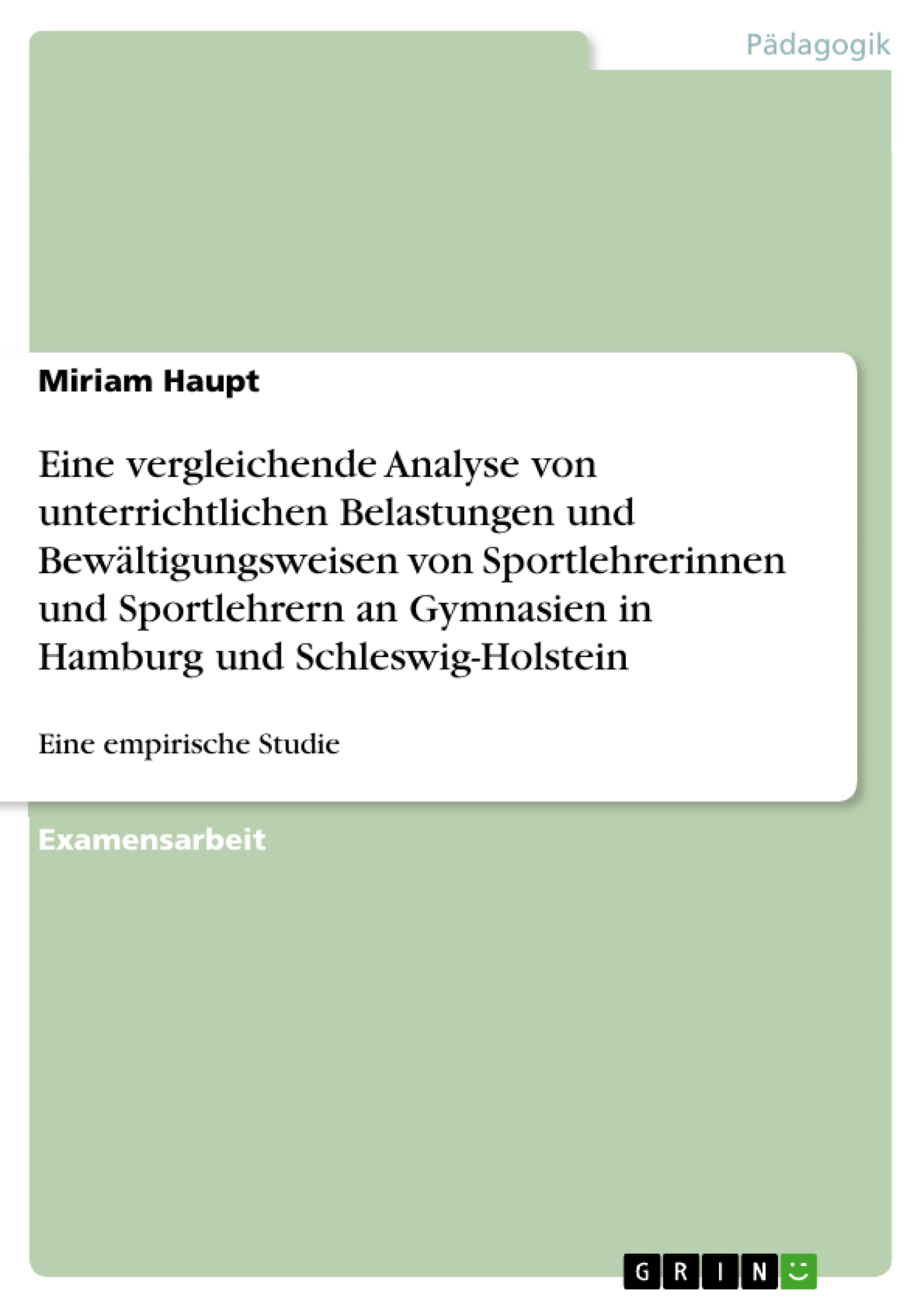Die vorliegende Untersuchung steht im Rahmen eines umfangreichen Forschungsprojektes zur Erfassung von Stressoren und psychischen Widerstandsressourcen von Sportlehrkräften, das auf den qualitativen Studien Miethlings (1986, 2002) zu Belastungssituationen im Sportunterricht sowie der quantitativen Querschnittsuntersuchung von Miethling und Brand (2004) basiert und diese Stichprobe auf die Sportlehrkräfte der Hansestadt Hamburg ausweitet.
Der Aufbau der vorliegenden Arbeit gliedert sich folgendermaßen: Den Anfang bildet die Darstellung der theoretischen Grundlagen, wobei zunächst ein Überblick über die Stressforschung und eine Erläuterung der Stress- und Ressourcenmodelle von Lazarus und Launier (1981) sowie Hobfoll (1988) erfolgt. Im Anschluss werden bedeutsame Widerstandsressourcen wie die soziale Unterstützung vorgestellt, und ein Blick auf die Theorien von Antonovsky (1997) und Becker (1992) zur Bedeutung und Entstehung von Gesundheit geworfen. Das darauf folgende Kapitel beschäftigt sich mit einem Vergleich der Lehrpläne und schulischen Gegebenheiten der Gymnasien in Hamburg und Schleswig-Holstein, und ist somit im Hinblick auf die vergleichende Analyse der Ergebnisse beider Bundesländer von Interesse. Weiterhin werden die für die vorliegende Arbeit relevanten Untersuchungen zu Arbeitsanforderungen, Belastungen und deren Bewältigung bei Lehrerinnen und Lehrern vorgestellt, worunter die Studie Hubermans (1989) zur Abfolge zentraler Themen in der Berufslaufbahn von Lehrern sowie das Werk Schaarschmidts (2004) zur psychischen Gesundheit im Lehrerberuf fallen. Im Anschluss erfolgt eine Darstellung aktueller Forschungen, die sich mit diesen Themen speziell in Bezug auf Sportlehrer befassen. Dabei werden neben der Untersuchung Heims und Klimeks (1999) die zuvor genannten, dieser Arbeit zugrundeliegenden Studien von Miethling (1986, 2002) sowie Miethling und Brand (2004) beschrieben. Aus der Darstellung der theoretischen Grundlagen erfolgt sodann die Herleitung der Forschungsfragen. Im weiteren Verlauf dieser Studie werden im Rahmen der Untersuchungsmethode die empirischen Forschungshypothesen aufgestellt. Die sich anschließende Darstellung und Diskussion der Ergebnisse findet zunächst deskriptiv und des Weiteren hinsichtlich der Forschungshypothesen statt. Nachdem die Resultate dargestellt und vergleichend analysiert wurden, bilden die Zusammenfassung und Einordnung der Resultate in den aktuellen Forschungsstand den abschließenden Teil der Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Bezugsrahmen
- 2.1 Stress- und Ressourcentheorien
- 2.1.1 Überblick über die Stressforschung
- 2.1.2 Das transaktionale Stressmodell von Lazarus und Launier (1981)
- 2.1.3 Das Ressourcenmodell von Hobfoll (1988)
- 2.2 Widerstandsressourcen
- 2.2.1 Die Bedeutung und Entstehung von Gesundheit
- 2.2.2 Die Theorie der sozialen Unterstützung
- 2.3 Ein Vergleich der Lehrpläne und der schulischen Gegebenheiten von Gymnasien in Hamburg und Schleswig-Holstein
- 2.3.1 Demographische Angaben zu Hamburg und Schleswig-Holstein
- 2.3.2 Die Geschlechterverteilung der Gymnasiallehrkräfte und ihr Arbeitsverhältnis
- 2.3.3 Arbeitszeiten der Lehrerinnen und Lehrer an Gymnasien in Hamburg und Schleswig-Holstein - Mehr Unterrichtsstunden für Hamburger Sportlehrkräfte durch das Lehrerarbeitszeitmodell?
- 2.3.4 Ein Vergleich der Lehrpläne der Gymnasien Hamburgs und Schleswig-Holsteins für das Fach Sport
- 2.4 Stand der Forschung zu Arbeitsanforderungen, Belastungen und deren Bewältigung bei Lehrerinnen und Lehrern
- 2.4.1 Die Abfolge zentraler Themen in der Berufslaufbahn von Lehrern nach Huberman (1989)
- 2.4.2 Psychische Gesundheit im Lehrerberuf nach Schaarschmidt (2004)
- 2.5 Stand der Forschung zu Arbeitsanforderungen, Belastungen und deren Bewältigung bei Sportlehrerinnen und Sportlehrern
- 2.6 Ableitung der Forschungsfragen
- 3 Forschungsmethode
- 3.1 Beschreibung der Untersuchungsplanung und des Instruments der Datenerhebung
- 3.2 Beschreibung der Untersuchungsdurchführung
- 3.3 Empirische Forschungshypothesen und Techniken der Datenauswertung
- 4 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse
- 4.1 Deskriptive Statistik
- 4.1.1 Darstellung der Stichprobe Hamburgs und Schleswig-Holsteins
- 4.1.2 Ausprägungen der wahrgenommenen Stressoren und psychischen Widerstandsressourcen sowie deren Zusammenhänge
- 4.2 Prüfende Statistik
- 4.2.1 Vergleich der Bundesländer bezüglich der Ausprägungen von Stressoren und Widerstandsressourcen (H₁4)
- 4.2.2 Vergleich bezüglich der Geschlechter (H₁)
- 4.2.3 Vergleich bezüglich der absolvierten Berufsjahre (H1,2)
- 4.2.4 Darstellung und Diskussion signifikanter Zusammenhänge zwischen der Wahrnehmung sportunterrichtlicher Stressoren und der Ausprägung psychischer Widerstandsressourcen (H1,3, H 1,5)
- 5 Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht vergleichend die unterrichtlichen Belastungen und Bewältigungsstrategien von Sportlehrerinnen und Sportlehrern an Gymnasien in Hamburg und Schleswig-Holstein. Ziel ist es, Unterschiede zwischen den Bundesländern und innerhalb der Lehrerschaft (Geschlecht, Berufserfahrung) aufzuzeigen.
- Vergleich der unterrichtlichen Belastungen von Sportlehrkräften in Hamburg und Schleswig-Holstein.
- Analyse der Bewältigungsstrategien von Sportlehrkräften im Umgang mit Stress.
- Untersuchung des Einflusses von Geschlecht und Berufserfahrung auf die wahrgenommenen Belastungen und Bewältigungsstrategien.
- Vergleich der Lehrpläne und schulischen Gegebenheiten in beiden Bundesländern.
- Einordnung der Ergebnisse in den bestehenden Forschungsstand zur Lehrergesundheit.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein, erläutert die Relevanz der Untersuchung und formuliert die Forschungsfragen. Es wird der methodische Ansatz vorgestellt und ein Überblick über die Struktur der Arbeit gegeben. Die Einleitung begründet die Notwendigkeit eines Vergleichs der beiden Bundesländer Hamburg und Schleswig-Holstein hinsichtlich der Belastungssituation von Sportlehrkräften.
2 Theoretischer Bezugsrahmen: Dieser Abschnitt liefert die theoretische Grundlage für die empirische Studie. Es werden relevante Stress- und Ressourcentheorien (Lazarus, Launier; Hobfoll) vorgestellt und deren Anwendung auf den Lehrerberuf diskutiert. Die Bedeutung von Widerstandsressourcen, insbesondere sozialer Unterstützung, wird hervorgehoben. Ein detaillierter Vergleich der Lehrpläne und schulischen Gegebenheiten in Hamburg und Schleswig-Holstein, inklusive demografischer Daten und Arbeitszeitmodelle, bildet einen weiteren Schwerpunkt. Der Abschnitt schließt mit der Darstellung des Forschungsstandes zu Arbeitsanforderungen, Belastungen und Bewältigungsmechanismen im Lehrerberuf, speziell im Kontext des Sportunterrichts.
3 Forschungsmethode: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der Untersuchung. Es wird die Untersuchungsplanung, das Instrument der Datenerhebung (einschließlich der verwendeten Fragebögen), die Durchführung der Studie und die statistischen Methoden der Datenauswertung erläutert. Die empirischen Forschungshypothesen werden präzise formuliert.
4 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse: Dieser umfangreiche Abschnitt präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Zunächst erfolgt eine deskriptive Statistik der Stichprobe, gefolgt von der Analyse der erhobenen Daten mittels prüfender Statistik. Die Ergebnisse werden im Detail dargestellt und diskutiert, wobei die einzelnen Forschungshypothesen im Kontext der theoretischen Überlegungen überprüft werden. Vergleiche zwischen den Bundesländern, den Geschlechtern und den Berufserfahrungsgruppen werden durchgeführt und interpretiert. Zusammenhänge zwischen Stressoren und Widerstandsressourcen werden analysiert und erklärt.
Schlüsselwörter
Sportlehrer, Unterrichtsbelastung, Stress, Bewältigung, Ressourcen, soziale Unterstützung, Hamburg, Schleswig-Holstein, Lehrergesundheit, Lehrpläne, Vergleichsstudie, empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Vergleichende Untersuchung unterrichtlicher Belastungen und Bewältigungsstrategien von Sportlehrkräften an Gymnasien in Hamburg und Schleswig-Holstein
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Die Studie untersucht vergleichend die unterrichtlichen Belastungen und Bewältigungsstrategien von Sportlehrerinnen und Sportlehrern an Gymnasien in Hamburg und Schleswig-Holstein. Ziel ist es, Unterschiede zwischen den Bundesländern und innerhalb der Lehrerschaft (Geschlecht, Berufserfahrung) aufzuzeigen.
Welche Themen werden in der Studie behandelt?
Die Studie umfasst einen Vergleich der unterrichtlichen Belastungen von Sportlehrkräften in beiden Bundesländern, eine Analyse der Bewältigungsstrategien im Umgang mit Stress, die Untersuchung des Einflusses von Geschlecht und Berufserfahrung auf Belastungen und Bewältigungsstrategien, einen Vergleich der Lehrpläne und schulischen Gegebenheiten in Hamburg und Schleswig-Holstein sowie die Einordnung der Ergebnisse in den bestehenden Forschungsstand zur Lehrergesundheit.
Welche theoretischen Grundlagen liegen der Studie zugrunde?
Die Studie basiert auf relevanten Stress- und Ressourcentheorien, insbesondere dem transaktionalen Stressmodell von Lazarus und Launier (1981) und dem Ressourcenmodell von Hobfoll (1988). Die Bedeutung von Widerstandsressourcen, wie soziale Unterstützung, wird ebenfalls berücksichtigt.
Wie ist die Studie aufgebaut?
Die Studie gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Theoretischer Bezugsrahmen, Forschungsmethode, Darstellung und Diskussion der Ergebnisse sowie Zusammenfassung und Fazit. Der theoretische Bezugsrahmen beinhaltet einen detaillierten Vergleich der Lehrpläne und schulischen Gegebenheiten in Hamburg und Schleswig-Holstein, inklusive demografischer Daten und Arbeitszeitmodelle, sowie den Forschungsstand zu Arbeitsanforderungen, Belastungen und Bewältigungsmechanismen im Lehrerberuf, speziell im Sportunterricht.
Welche Methoden wurden in der Studie angewendet?
Die Studie beschreibt detailliert die Methodik der Untersuchung, einschließlich der Untersuchungsplanung, des Instruments der Datenerhebung (Fragebögen), der Durchführung der Studie und der statistischen Methoden der Datenauswertung. Die empirischen Forschungshypothesen werden präzise formuliert.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Der Abschnitt "Darstellung und Diskussion der Ergebnisse" präsentiert deskriptive Statistiken der Stichprobe und Analysen mittels prüfender Statistik. Die Ergebnisse werden detailliert dargestellt und diskutiert, wobei die einzelnen Forschungshypothesen im Kontext der theoretischen Überlegungen überprüft werden. Vergleiche zwischen den Bundesländern, Geschlechtern und Berufserfahrungsgruppen werden durchgeführt und interpretiert. Zusammenhänge zwischen Stressoren und Widerstandsressourcen werden analysiert und erklärt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Studie?
Das Kapitel "Zusammenfassung und Fazit" fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und zieht Schlussfolgerungen aus der Studie. Es werden die zentralen Befunde hinsichtlich der unterrichtlichen Belastungen, Bewältigungsstrategien und der Unterschiede zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie?
Schlüsselwörter sind: Sportlehrer, Unterrichtsbelastung, Stress, Bewältigung, Ressourcen, soziale Unterstützung, Hamburg, Schleswig-Holstein, Lehrergesundheit, Lehrpläne, Vergleichsstudie, empirische Forschung.
- Citar trabajo
- Miriam Haupt (Autor), 2005, Eine vergleichende Analyse von unterrichtlichen Belastungen und Bewältigungsweisen von Sportlehrerinnen und Sportlehrern an Gymnasien in Hamburg und Schleswig-Holstein, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47417