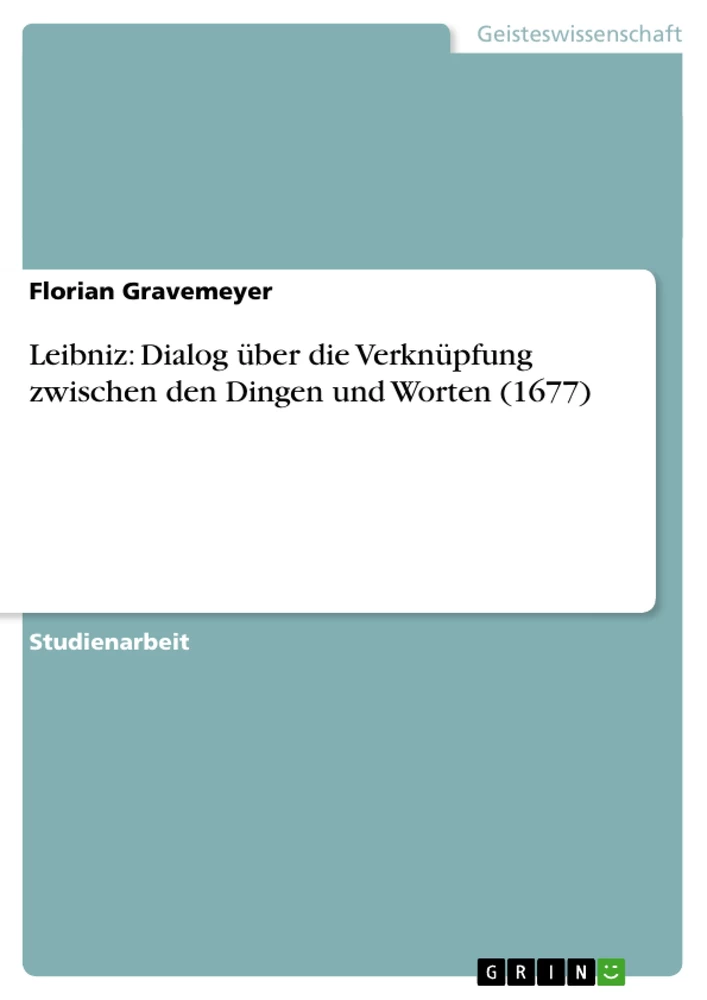Leibniz exponiert in dieser frühen Arbeit das ontologische Grundproblem der Verknüpfung zwischen Dingen und Worten, durch die Form des sokratischen Dialoges. Die Dialogpartner stehen sich dabei wie Lehrer und Schüler gegenüber. A führt mit didaktischem Geschick in den jeweiligen Gedankengang ein, entwickelt die Diskussion durch eine kritisch skeptische Grundhaltung und der Einführung abstrakter Argumentationsebenen. B wird so nicht nur zum logischen Argumentieren angeleitet, er lernt vielmehr aus der Demonstration von Beweisverfahren seines Gegenübers die Bedeutung von nachprüfbaren Grundsätzen für einen gelungenen Diskurs kennen.
Ausgehend vom praktischen Wissen um geometrische Figuren wird auf einer erkenntnistheoretischen Ebene, über die Form des logischen Urteils, der Wahrheitsbegriff deduziert. Als Entitäten können Denken und Sein jedoch nicht unverbunden nebeneinander bestehen. Es gilt eine Theorie der Entsprechung zu finden, in der die subjektbestimmte Form der Erkenntnis mit deren Inhalt als bestmöglich übereinstimmend gedacht werden kann. Leibniz steht hier durchaus noch unter dem Einfluss der scholastischen Tradition, die in der Korrespondenztheorie, Wahrheit gemäß einer „Adaequatio rei et intellectus“ suchte. Eine Lösung ist auf der Seite des erkennenden Subjektes, das heißt den Prinzipien von Erkenntnis, zu finden. Die Entscheidbarkeit eines Urteils, mit dem Geltungsanspruch einer deutlichen Erkenntnis, muss auf dem Wege methodischer Prüfung einsichtig sein. Die Methode kennzeichnet sich dabei als eine bestimmte, charakteristische Regel beim Umgang mit Ze ichen und Symbolen. Diese Zeichen manifestieren sich als Zahlen oder Begriffe in den Definitionen der Arithmetik und Geometrie. Inwieweit also die Zeichen als solche ihre Entsprechung in den „ersten Elementen“ finden, -etwa als ideelle Abbilder oder Analogien der Wirklichkeit, kann unberücksichtigt bleiben. Die problemlose Übertragung der Resultate unserer Rechenoperation auf gegebene Materie bestätigt vielmehr eine Adäquatheit von Denken und Sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Darstellung des Gedankenganges
- Ausgangsfrage: Formulierung der These
- Die Bedeutung der Zeichen im Dialog
- Ein metalogisches Beispiel: "Lucifer"
- Die Übertragung auf eine metalogische Ebene
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert G.W. Leibniz' Dialog „Über die Verknüpfung zwischen den Dingen und Worten“ aus dem Jahr 1677 und beleuchtet die darin dargelegte Argumentation zur Verbindung von Denken und Sein. Der Dialog stellt einen frühen Entwurf von Leibniz' Ideen zur Logik, Sprache und Erkenntnis dar.
- Das ontologische Grundproblem der Verknüpfung zwischen Dingen und Worten
- Die Rolle der Zeichen und Symbole in der Erkenntnis
- Die Bedeutung des logischen Urteils und der Wahrheit
- Die Suche nach einer adäquaten Beziehung zwischen Denken und Sein
- Der Einfluss der Scholastik und der Ansatz einer universalen Grammatik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Leibniz stellt in seinem Dialog das Problem der Verbindung zwischen Dingen und Worten im Kontext eines sokratischen Dialogs zwischen zwei Partnern dar. A, der Lehrer, führt B, den Schüler, mit didaktischem Geschick in die Argumentation ein und entwickelt die Diskussion durch eine kritisch-skeptische Haltung. Der Dialog beginnt mit der Frage nach der Beziehung zwischen geometrischen Figuren und ihrer Darstellung in Worten, wobei Leibniz die Notwendigkeit einer Theorie der Entsprechung zwischen Denken und Sein betont.
Darstellung des Gedankenganges
Ausgangsfrage: Formulierung der These
Der Dialog startet mit der Frage, wie man einen Faden zu einer Figur mit größtmöglichem Flächeninhalt krümmen kann. B argumentiert, dass der Kreis die Figur mit dem größten Flächeninhalt sei, und stützt sich dabei auf die Anschauung und die Anwendung geometrischen Wissens. A zeigt jedoch die Widersprüchlichkeit dieser Argumentation auf, indem er die Wahrheit eines Urteils auf die „besondere Natur der Frage“ zurückführt.
Die Bedeutung der Zeichen im Dialog
A argumentiert weiter, dass die Erkenntnis sich aus einem reflexiven Akt im Denken erschließen muss und das „was von niemanden gedacht wird“, nicht wahr sein kann. Er führt den Begriff des „Denkbaren“ ein, der sich im Gegensatz zum „tatsächlich Gedachten“ in Aussagen über Erfahrungsgegenstände manifestiert. Die Verbindung zwischen ontologischen und logischen Elementen in der Erkenntnis wird als Voraussetzung für die Verifikation von Urteilen dargestellt.
Ein metalogisches Beispiel: "Lucifer"
Leibniz verwendet das Beispiel des Wortes "Lucifer" um die Beziehung zwischen Worten, Begriffen und Gegenständen zu verdeutlichen. Er argumentiert, dass die Zusammensetzung des Wortes aus den Teilen "lux" und "fero" eine logische Struktur aufzeigt, die nicht auf quantitative Verhältnisse, sondern auf eine äquivalente Beziehung zum bezeichneten Gegenstand verweist.
Die Übertragung auf eine metalogische Ebene
Der Dialog endet mit der Übertragung des Kerngedankens auf eine metalogische Ebene, in der gedankliche Inhalte auf adäquate Zeichen reduziert werden können. Leibniz betont die Notwendigkeit einer fundierten Entsprechung des Zeichens mit dem konkreten Gegenstand, ohne jedoch eine eindeutige Lösung des ontologischen Problems der Verbindung zwischen Dingen und Worten zu liefern.
Schlüsselwörter
Der Dialog behandelt zentrale Themen wie die Verknüpfung zwischen Dingen und Worten, die Rolle der Zeichen und Symbole in der Erkenntnis, die Bedeutung des logischen Urteils, die Suche nach einer adäquaten Beziehung zwischen Denken und Sein und den Einfluss der Scholastik auf Leibniz' Gedanken. Weitere wichtige Begriffe sind: sokratischer Dialog, didaktisches Philosophieren, geometrische Figuren, Wahrheit, Erkenntnis, Zeichen, Symbole, Metalogik, Universalgrammatik.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Leibniz' Dialog von 1677?
Leibniz thematisiert das ontologische Grundproblem der Verbindung zwischen Dingen (Sein) und Worten (Denken) in Form eines sokratischen Dialogs.
Welche Rolle spielen Zeichen und Symbole in der Erkenntnis?
Zeichen manifestieren Begriffe. Leibniz argumentiert, dass die Adäquatheit von Denken und Sein durch die methodische Anwendung von Regeln im Umgang mit diesen Zeichen bestätigt wird.
Was verdeutlicht das Beispiel "Lucifer" im Text?
Es zeigt die logische Struktur von Worten auf (lux + fero), die auf eine äquivalente Beziehung zum bezeichneten Gegenstand verweist.
Wie definiert Leibniz Wahrheit in diesem Dialog?
Wahrheit wird auf einer erkenntnistheoretischen Ebene über die Form des logischen Urteils deduziert, angelehnt an die scholastische Korrespondenztheorie.
Warum nutzt Leibniz die Geometrie als Ausgangspunkt?
Anhand geometrischer Figuren lässt sich zeigen, wie abstrakte Begriffe und Definitionen präzise auf die materielle Wirklichkeit anwendbar sind.
- Citar trabajo
- Florian Gravemeyer (Autor), 2004, Leibniz: Dialog über die Verknüpfung zwischen den Dingen und Worten (1677), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47456