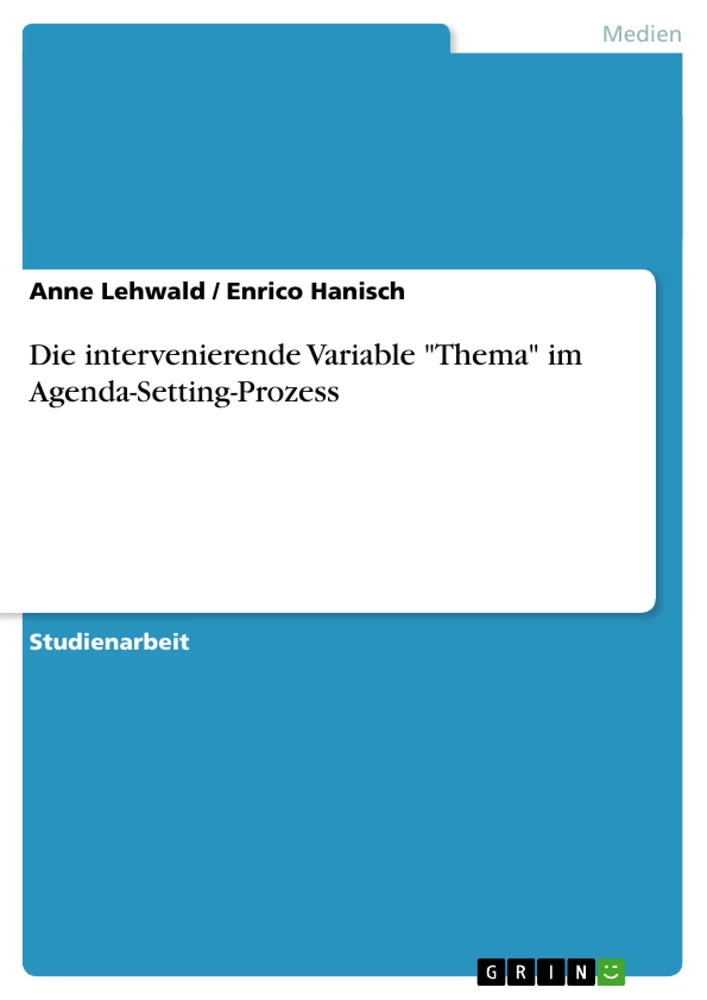Mehr als 350 Untersuchungen zum Agenda-Setting- Effekt der Massenmedien wurden seit der Pionierstudie von Maxwell McCombs und Donald Shaw im Jahr 1972 publiziert (Selb 2003, S. 4). Die Mehrheit dieser empirischen Studien hat die relativ einfache Grundannahme, dass die Medienagenda in die Publikumsagenda diffundiert, keineswegs bestätigt. Es wurden intervenierende Variablen identifiziert, die die Stärke des Agenda-Setting- Effekts beeinflussen (Brosius / Weimann 1995, S. 312). Eine dieser intervenierenden Variablen ist das Thema. Wir wollen mit dieser Hausarbeit über „Themenabhängige Agenda-Setting- Effekte“ einen systematischen Überblick über Modifikationen auf der Themenebene geben, die das Ausmaß der Agenda-Setting-Effekte zu beeinflussen vermögen. Innerhalb einer kurzen Darstellung des aktuellen Forschungsstandes und der Untersuchungsmethoden des Agenda-Settings wird die Untersuchung
intervenierender Variablen in den Forschungsprozess eingeordnet und verschiedene Definitionen des zentralen Begriffs „Thema“ werden vorgestellt. Warum einige Themen trotz mäßiger Berichterstattung hohe öffentliche Aufmerksamkeit erlangen, während manche von den Medien stark betonte Themen einen untergeordneten Platz auf der Publikumsagenda einnehmen (Selb 2003, S. 48), wird im Hauptteil der Arbeit erläutert. Die Wirkung der Eigenschaften der Themen auf den Agenda-Setting- Effekt steht im Mittelpunkt. Der aktuelle Forschungsstand über die Bedeutung von Themenmerkmalen wie Personalisierung, geografische und psychologische Nähe, Überraschung, Abstraktheit und Konkretheit sowie die Aufdringlichkeit wird dargestellt.
Eine Übersicht über in der Arbeit erläuterte Agenda-Setting-Studien und der Versuch einer Zuordnung der untersuchten Themen zu den Wirkungsmodellen von Hans-Bernd Brosius und Hans-Mathias Kepplinger schließt sich an. Zudem werden die Bedeutung des Themenwettbewerb zwischen „Victim- and Killer-Issues“ sowie das Verhältnis der Wirkungstheorien der „Obtrusive Contingency“ und dem „Cognitive Priming“ erläutert.
Den Abschluss der Arbeit bildet ein ausführlicher Kritikteil, der sowohl methodische als auch konzeptionelle Aspekte hinterfragt, gefolgt von einen Resümee.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Überblick über die Agenda-Setting-Forschung
- Allgemeine Erkenntnisse und Methoden
- Vier Phasen der Agenda-Setting-Forschung
- Definition: „Thema“ – „Issue“ - „politische Streitfrage“
- Eigenschaften von Themen
- Personalisierung, Nähe, Konflikt, Überraschung, Negativismus und Eindeutigkeit
- Obtrusiveness versus Unobtrusiveness
- Die Dependenztheorie als eine Grundlage des Obtrusiveness-Konzepts
- Das Obtrusiveness-Konzept nach Harold Zucker
- Weitere Studien zu Aufdringlichkeit
- Abweichende Definitionen
- Festlegung der Aufdringlichkeit
- Untersuchung von Winfried Schulz
- Abstrakte versus konkrete Themen
- Lokale versus nationale Themen
- Studie von Palmgreen und Clarke (Politische Nähe)
- Exkurs: Inhaltsanalyse von Burdach (Geographische Nähe)
- Zeitpunkt der Themenuntersuchung und Themenverlauf
- Interdependenzen von Themen
- Katalysatoreffekte und Trigger Events
- Themenwettbewerb: Victim- und Killer-Issues
- Agenda-Setting als Nullsummenspiel
- Killer-Themen nach Brosius & Kepplinger
- Systematisierung
- Übersicht über die vorgestellten Studien
- Themeneigenschaften, die zu starken Agenda-Setting-Effekten führen
- Themenzuordnung zu den Modellen von Kepplinger
- „Obtrusive Contingency“ versus „Cognitive Priming“
- Das Modell des „Cognitive Priming“
- Vergleich der beiden Wirkungsmodelle
- „Obtrusiveness“ als rezipientenspezifisches Merkmal
- Lee's analytisches Modell
- Kritik
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Hausarbeit ist es, einen systematischen Überblick über Modifikationen auf der Themenebene im Agenda-Setting-Prozess zu geben, welche das Ausmaß der Agenda-Setting-Effekte beeinflussen können. Die Arbeit setzt sich mit dem Forschungsstand im Bereich des Agenda-Settings auseinander und beleuchtet die Bedeutung des „Themas“ als intervenierende Variable.
- Erläuterung der Eigenschaften von Themen und deren Einfluss auf den Agenda-Setting-Effekt
- Untersuchung von Themenmerkmalen wie Personalisierung, Nähe, Überraschung, Abstraktheit und Konkretheit sowie Aufdringlichkeit
- Systematische Einordnung verschiedener Agenda-Setting-Studien und deren Zuordnung zu Wirkungsmodellen
- Analyse von Themenwettbewerb und dem Verhältnis der Wirkungsmodelle „Obtrusive Contingency“ und „Cognitive Priming“
- Kritik an methodischen und konzeptionellen Aspekten im Bereich des Agenda-Settings
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Diese Einleitung führt in die Thematik des Agenda-Settings und des Einflusses von Themen auf dessen Effekte ein. Sie beleuchtet den aktuellen Forschungsstand und die Relevanz der intervenierenden Variablen „Thema“ im Kontext des Agenda-Setting-Prozesses.
Überblick über die Agenda-Setting-Forschung
Kapitel 2 bietet einen Überblick über die allgemeine Agenda-Setting-Forschung, einschließlich ihrer Erkenntnisse, Methoden und Phasen. Es umfasst die Definition des Begriffs „Thema“ im Rahmen des Agenda-Settings.
Eigenschaften von Themen
Dieses Kapitel behandelt verschiedene Eigenschaften von Themen und ihren Einfluss auf den Agenda-Setting-Effekt. Es werden Themenmerkmale wie Personalisierung, Nähe, Konflikt, Überraschung, Negativismus, Eindeutigkeit und Aufdringlichkeit sowie das Verhältnis von abstrakten und konkreten Themen beleuchtet.
Interdependenzen von Themen
Kapitel 4 konzentriert sich auf die Wechselwirkungen zwischen Themen und die Auswirkungen dieser Interdependenzen auf den Agenda-Setting-Effekt. Es umfasst Themen wie Katalysatoreffekte, Trigger Events, den Themenwettbewerb zwischen „Victim- and Killer-Issues“ und die Rolle des Agenda-Settings als Nullsummenspiel.
Systematisierung
Kapitel 5 bietet eine systematische Einordnung der in der Arbeit erläuterten Agenda-Setting-Studien. Es wird die Zuordnung von untersuchten Themen zu den Wirkungsmodellen von Brosius und Kepplinger dargestellt und die Beziehung der Modelle „Obtrusive Contingency“ und „Cognitive Priming“ beleuchtet.
Das Modell des „Cognitive Priming“
Kapitel 6 stellt das „Cognitive Priming“-Modell im Kontext des Agenda-Settings vor und erläutert seine Bedeutung für die Untersuchung von Themenabhängigen Agenda-Setting-Effekten.
Vergleich der beiden Wirkungsmodelle
Kapitel 7 vergleicht die Wirkungsmodelle „Obtrusive Contingency“ und „Cognitive Priming“ und analysiert ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
„Obtrusiveness“ als rezipientenspezifisches Merkmal
Dieses Kapitel untersucht den Einfluss des Rezipienten auf die Wahrnehmbarkeit und Aufdringlichkeit von Themen, die wiederum den Agenda-Setting-Effekt beeinflussen.
Lee's analytisches Modell
Kapitel 8 präsentiert Lee's analytisches Modell als Instrument zur Untersuchung von Agenda-Setting-Effekten. Das Modell integriert verschiedene Faktoren, die den Agenda-Setting-Prozess beeinflussen, und bietet eine systematische Herangehensweise an die Analyse von Themenabhängigen Effekten.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themengebiete dieser Hausarbeit sind Agenda-Setting, Themen, intervenierende Variablen, Aufdringlichkeit („Obtrusiveness“), „Cognitive Priming“, „Obtrusive Contingency“, Victim- und Killer-Issues, Themenwettbewerb, Inhaltsanalyse, Wirkungsmodelle und medienzentrierte Wirkungsforschung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Agenda-Setting-Effekt?
Der Effekt beschreibt die Beobachtung, dass die Medienagenda (die Themen, über die viel berichtet wird) die Publikumsagenda (das, was die Menschen für wichtig halten) maßgeblich beeinflusst.
Welche Rolle spielt das „Thema“ als intervenierende Variable?
Nicht alle Themen führen zu gleich starken Effekten. Merkmale wie Aufdringlichkeit (Obtrusiveness), Nähe, Abstraktheit oder Personalisierung bestimmen, wie stark das Publikum die Medienagenda übernimmt.
Was unterscheidet „Obtrusive“ von „Unobtrusive Issues“?
Aufdringliche Themen (obtrusive) erleben Menschen im Alltag selbst (z.B. Inflation). Unaufdringliche Themen (unobtrusive) kennen sie nur aus den Medien (z.B. Außenpolitik). Der Agenda-Setting-Effekt ist bei unaufdringlichen Themen meist stärker.
Was sind „Victim-“ und „Killer-Issues“?
Im Themenwettbewerb können starke Themen („Killer-Issues“) andere Themen von der Agenda verdrängen („Victim-Issues“), da die Aufmerksamkeit des Publikums begrenzt ist.
Was ist das Konzept des „Cognitive Priming“?
Es beschreibt, wie die mediale Betonung bestimmter Themen dazu führt, dass diese im Gedächtnis der Rezipienten leichter abrufbar werden und somit deren Bewertung politischer Realität prägen.
- Citar trabajo
- Anne Lehwald (Autor), Enrico Hanisch (Autor), 2005, Die intervenierende Variable "Thema" im Agenda-Setting-Prozess, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47488