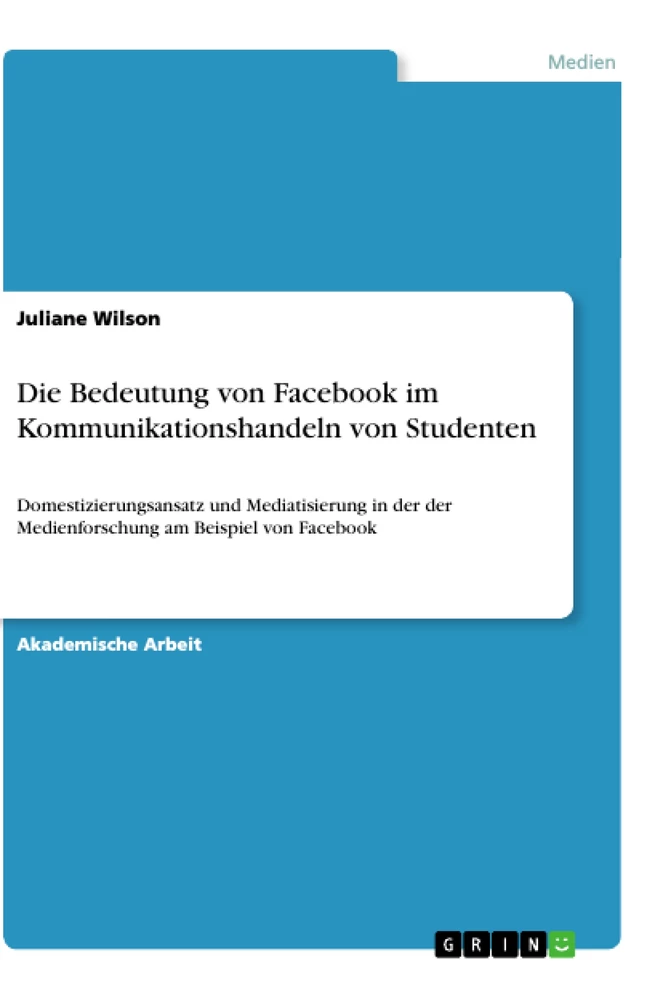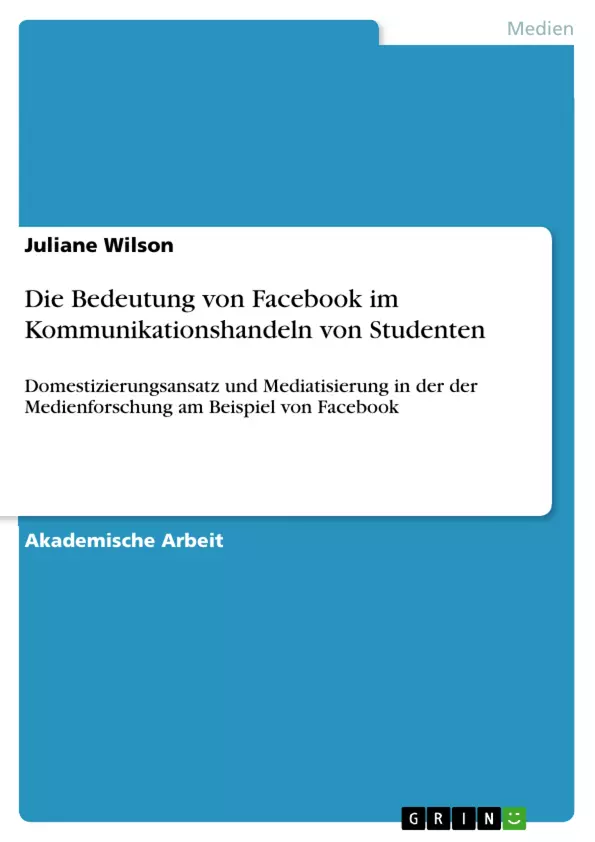Im Rahmen dieser exemplarischen Untersuchung soll einerseits der Einfluss Facebooks auf die Kommunikationspraktiken im studentischen Alltag und andererseits das kommunikative Handeln innerhalb des sozialen Netzwerkes untersucht werden. Mittels eines qualitativen Medientagebuchs und parallel dazu geführten qualitativen Kurzinterviews sollen Nutzungs- und Kommunikationshandeln, als auch die Motivation für den Gebrauch von Facebook im studentischen Alltag analysiert werden. So kann einerseits gezeigt werden, welche Rolle Facebook in der sozialen Kommunikation im studentischen Alltag spielt und wie andererseits jenes Kommunikationsmedium in das Alltagshandeln der Studenten integriert wird. Dabei sollen für die Fragestellung relevante klassische Kommunikationsmedien, wie beispielsweise das Festnetztelefon, Handy, SMS und E-Mail eine Rolle spielen und mit dem Kommunikationshandeln über das soziale Netzwerk Facebook verglichen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Rahmen
- Die Diffusion von Medien in den Alltag: Domestizierungsansatz und Mediatisierung
- Das webbasierte soziale Netzwerk Facebook: ein elektronisch mediatisierter Kommunikationsraum
- Methodisches Vorgehen
- Auswahl der Fälle und theoretische Grundüberlegungen
- Die Methode des Medientagebuchs
- Offene qualitative Interviews
- Auswertung der Ergebnisse
- Portraits von Laura und Claudia
- Portrait von Laura
- Portrait von Claudia
- Gründe für die Wahl des Mediums Facebook in der Alltagskommunikation
- Unabhängigkeit von räumlicher und zeitlicher Nutzung
- Nutzungscharakteristika und Nutzungsgründe von Facebook
- Die Integration von Facebook in den studentischen Medienalltag
- Substituierung klassischer Kommunikationsmedien durch Facebook
- Überbelastung durch Kommunikationszwang
- Portraits von Laura und Claudia
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Forschungsarbeit untersucht den Einfluss von Facebook auf das Kommunikationshandeln im studentischen Alltag. Die Hauptziele sind die Analyse der Nutzungshäufigkeit verschiedener Kommunikationstools, die Bestimmung der Tageszeiten der Nutzung und die Erforschung der damit verbundenen Motivationen. Die Arbeit basiert auf der These, dass soziale Netzwerke das kommunikative Handeln von Studenten nachhaltig verändern.
- Der Einfluss von Facebook auf die Kommunikationspraktiken im studentischen Alltag.
- Das kommunikative Handeln innerhalb des sozialen Netzwerks Facebook.
- Der Vergleich des Kommunikationshandelns über Facebook mit klassischen Kommunikationsmedien.
- Die Integration von Facebook in den Alltag der Studenten.
- Die Bedeutung, die Nutzer Facebook in ihrem Alltag zuschreiben.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der zunehmenden Bedeutung webbasierter sozialer Netzwerke, insbesondere Facebook, im Alltag ein. Sie stellt die These auf, dass soziale Netzwerke das Kommunikationshandeln von Studenten nachhaltig verändern und skizziert die Forschungsfrage und die Methodik der Arbeit.
Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel erläutert den Domestizierungsansatz und die Mediatisierungstheorie als methodologische Grundlage der Untersuchung. Es beschreibt die Diffusion von Medien in den Alltag und deren Einfluss auf Kultur, Beziehungen und Alltagshandeln. Darüber hinaus wird das soziale Netzwerk Facebook als ein „elektronisch mediatisierter Kommunikationsraum“ charakterisiert und seine Rolle in der heutigen Gesellschaft beleuchtet.
Methodisches Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt die Auswahl der Fallstudien (zwei Studentinnen), die methodischen Grundlagen (Medientagebuch und qualitative Interviews), und die Begründung der Wahl dieser Methoden im Kontext der Medienethnographie. Es wird detailliert auf das Vorgehen bei der Datenerhebung und -auswertung eingegangen, wobei die qualitative Inhaltsanalyse im Mittelpunkt steht.
Auswertung der Ergebnisse: Dieser Abschnitt präsentiert die Ergebnisse der Studie anhand von detaillierten Portraits der beiden Probandinnen, Laura und Claudia, und analysiert deren Facebook-Nutzung. Es werden die Gründe für die Wahl von Facebook als Kommunikationsmedium, die Unabhängigkeit von Ort und Zeit, die Nutzungscharakteristika und die Integration von Facebook in den studentischen Alltag beleuchtet. Der Vergleich mit klassischen Kommunikationsmedien sowie die Problematik der Überlastung durch den Kommunikationszwang werden ebenfalls diskutiert.
Schlüsselwörter
Facebook, studentische Alltagskommunikation, Mediatisierung, Domestizierung, qualitative Inhaltsanalyse, Medientagebuch, qualitative Interviews, Kommunikationstools, soziale Netzwerke, Kommunikationshandeln, Nutzungsverhalten, klassische Medien, Smartphone, Entgrenzung, Individualisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Forschungsarbeit: Der Einfluss von Facebook auf die studentische Alltagskommunikation
Was ist das Thema der Forschungsarbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Facebook auf das Kommunikationsverhalten von Studierenden im Alltag. Im Mittelpunkt stehen die Nutzungsintensität, die Tageszeiten der Nutzung und die dahinterstehenden Motivationen. Die zentrale These ist, dass soziale Netzwerke das Kommunikationsverhalten von Studenten nachhaltig verändern.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Studie basiert auf einer qualitativen Forschungsmethode. Es wurden zwei Fallstudien (zwei Studentinnen) mit Hilfe von Medientagebüchern und offenen qualitativen Interviews untersucht. Die Daten wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf den Domestizierungsansatz und die Mediatisierungstheorie. Diese Ansätze helfen, die Integration von Medien in den Alltag und deren Auswirkungen auf Kultur, Beziehungen und Alltagshandeln zu verstehen. Facebook wird als „elektronisch mediatisierter Kommunikationsraum“ betrachtet.
Wer sind die Probandinnen?
Die Studie basiert auf den Erfahrungen von zwei Studentinnen, Laura und Claudia. Ihre individuellen Portraits und Nutzungsgewohnheiten von Facebook werden detailliert analysiert.
Welche Aspekte der Facebook-Nutzung werden untersucht?
Die Analyse umfasst die Gründe für die Wahl von Facebook als Kommunikationsmedium, die Unabhängigkeit von Ort und Zeit, die Nutzungscharakteristika, die Integration von Facebook in den studentischen Alltag, den Vergleich mit klassischen Kommunikationsmedien und die Problematik der Überlastung durch den Kommunikationszwang.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse zeigen, wie Facebook in den studentischen Alltag integriert ist und welche Rolle es in der Kommunikation spielt. Es wird untersucht, inwieweit Facebook klassische Kommunikationsmedien ersetzt und ob es zu einer Überlastung durch Kommunikationszwang führt. Detaillierte Ergebnisse sind in den Kapiteln zur Auswertung der Ergebnisse und den Portraits der Probandinnen zu finden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Facebook, studentische Alltagskommunikation, Mediatisierung, Domestizierung, qualitative Inhaltsanalyse, Medientagebuch, qualitative Interviews, Kommunikationstools, soziale Netzwerke, Kommunikationshandeln, Nutzungsverhalten, klassische Medien, Smartphone, Entgrenzung, Individualisierung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Rahmen, die Beschreibung des methodischen Vorgehens, die Auswertung der Ergebnisse und ein Resümee. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis befindet sich im Dokument.
Welche Forschungsfrage wird bearbeitet?
Die Arbeit untersucht, wie Facebook das Kommunikationsverhalten von Studierenden beeinflusst und welche Rolle es in ihrem Alltag spielt. Es geht um die Analyse der Nutzungsintensität, der Tageszeiten der Nutzung und der dahinterstehenden Motivationen im Vergleich zu klassischen Kommunikationsmedien.
- Citation du texte
- Juliane Wilson (Auteur), 2012, Die Bedeutung von Facebook im Kommunikationshandeln von Studenten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/475290