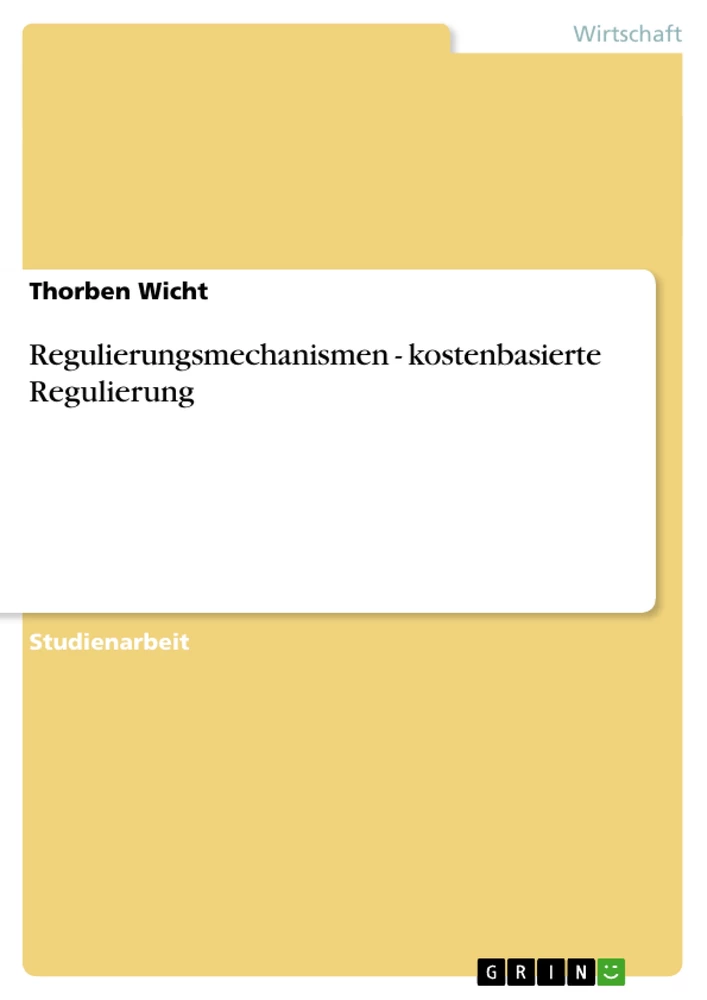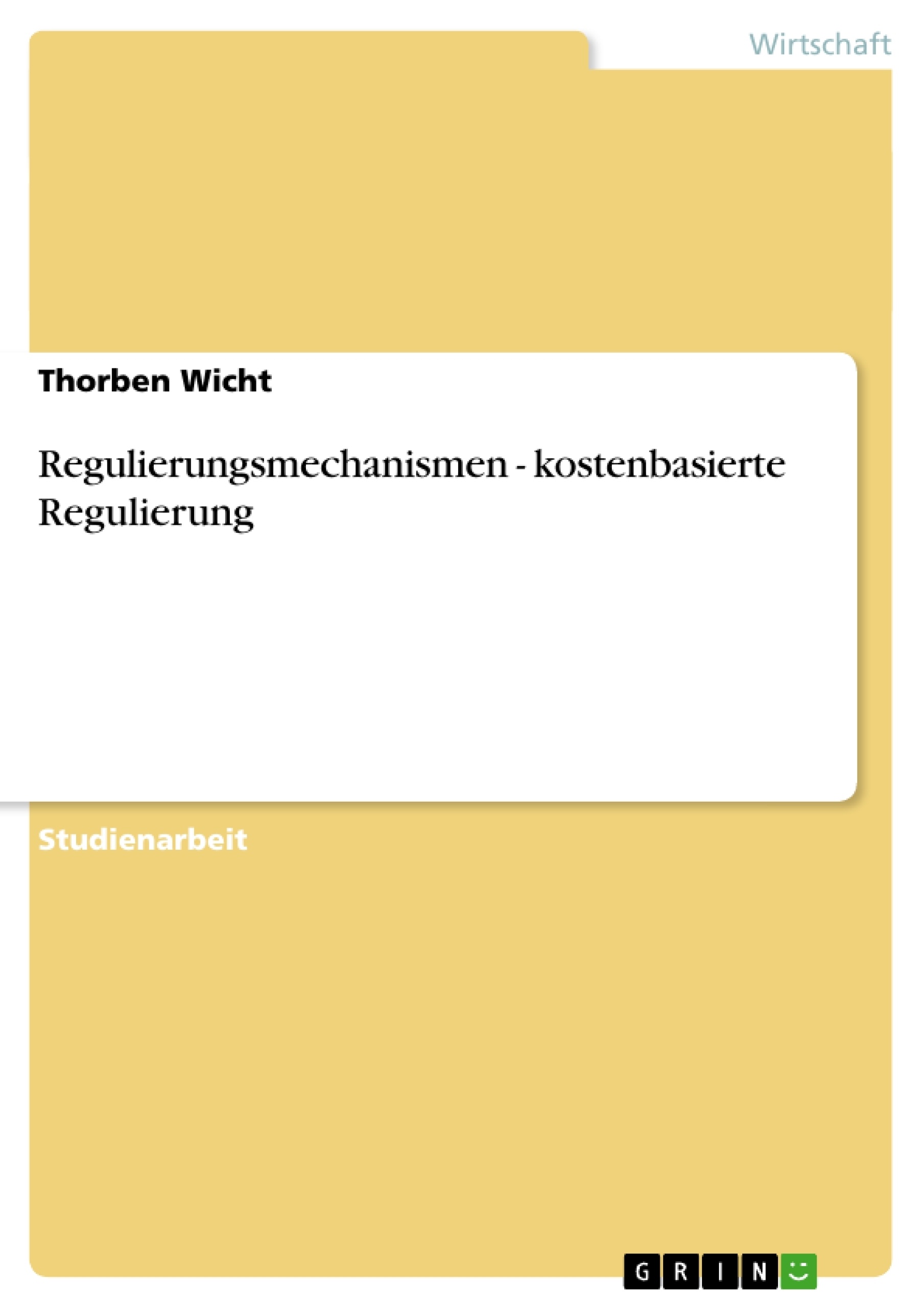Öffentliche Regulierung ermöglicht es bei offensichtlich vorliegenden Marktversagen aktiv in Marktprozesse und in das Wirtschaftsgeschehen einzugreifen.
Gestörte Marktstrukturen können beispielsweise vorliegen, wenn die gesamte Produktion eines Marktes durch ein einziges Unternehmen zu geringeren Kosten herstellbar ist, als durch zwei oder mehrere Unternehmen (natürliches Monopol).
Versorgungsunternehmen (Gas, Wasser, Strom, Fernwärme), Transportunternehmen (Eisenbahn, Spedition) sowie Post- und Telekommunikationsunternehmen sind klassische Bespiele für natürliche Monopolunternehmen.
Unternehmen mit natürlichen Monopolstrukturen haben keinen Anreiz wohlfahrtsmaximal zu produzieren, da sie durch das Setzen eines höheren Preises verbunden mit einer geringeren Ausbringungsmenge ihren Gewinn (sog. Monopolgewinn) maximieren können – im Vergleich zur Wettbewerbssituation, in der immer wohlfahrtsmaximal produziert wird, d.h. in der der Preis den Grenzkosten entspricht. Verlangt ein mit anderen Unternehmen direkt im Wettbewerb stehendes Unternehmen einen höheren Preis, so verliert es die Nachfrage und scheidet aus dem Markt aus.
Ziel der Regulierungsinstanzen ist es, das gewinnmaximale Verhalten des Monopolisten zu unterbinden und den daraus resultierenden Wohlfahrtsverlust zu minimieren. Nicht die Produzentenrente sondern die Maximierung der Konsumentenrente steht im Vordergrund der Regulierungstätigkeit.
Welche Möglichkeiten bestehen für die Regulierungsinstanz das angesprochene Ziel (Korrektur des Marktversagens) zu erreichen? Welche strategischen Verhaltensweisen der regulierten Unternehmen lassen sich dabei beobachten?
Für die Durchführung dieser Aufgabe stehen der Regulierungsinstanz diverse Regulierungsmethoden zur Verfügung.
Eine Möglichkeit der Regulierung ist der Einsatz kostenbasierter Regulierungsmethoden, wie zum Beispiel die in Amerika übliche Rentabilitätsregulierung. Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt auf der ihrer Wirkungen. Insbesondere werden die strategischen Verhaltensanreize, die sich für das regulierte Unternehmen ergeben, untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischen Grundlagen
- Natürliches Monopol
- Preisbildung im natürlichen Monopol
- Regulierung
- Begriffsdefinition
- Regulierungsziele und -methoden
- Methoden der kostenbasierten Regulierung
- Einführung
- Rentabilitätsregulierung
- Kostenzuschlagsregulierung
- Weitere ausgewählte Methoden
- Wirkung der Rentabilitätsregulierung - Averch-Johnson-Modell
- Einführung
- Auswirkung unterschiedlicher erlaubter Renditen auf das Verhalten regulierter Unternehmen
- kritische Betrachtung sowie Erweiterungsansätze
- Ergebnisse
- Strategische Verhaltensanreize für regulierte Unternehmen
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der kostenbasierten Regulierung, insbesondere mit der Rentabilitätsregulierung, die in den USA gängig ist. Das Ziel ist es, die Auswirkungen dieser Regulierungsmethode auf das Verhalten von regulierten Unternehmen zu untersuchen und dabei die strategischen Verhaltensanreize zu analysieren.
- Natürliche Monopole und die Herausforderungen der Preissetzung
- Regulierungsziele und -methoden im Kontext von Marktversagen
- Kostenbasierte Regulierung als Instrument zur Korrektur von Marktversagen
- Das Averch-Johnson-Modell und seine Auswirkungen auf das Verhalten regulierter Unternehmen
- Strategische Verhaltensanreize, die sich aus der Rentabilitätsregulierung ergeben
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik der Regulierung und beleuchtet die Bedeutung von natürlichen Monopolen und den damit verbundenen Herausforderungen. Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Regulierung, insbesondere die Begriffsdefinition und die Regulierungsziele und -methoden, erläutert. Anschließend stellt das dritte Kapitel verschiedene kostenbasierte Regulierungsmethoden, wie die Rentabilitätsregulierung und die Kostenzuschlagsregulierung, vor. Kapitel vier analysiert die Auswirkungen der Rentabilitätsregulierung auf das Verhalten regulierter Unternehmen anhand des Averch-Johnson-Modells. Es werden die strategischen Verhaltensanreize untersucht, die sich für das Unternehmen durch unterschiedliche erlaubte Renditen ergeben. Die Arbeit schließt mit einem Ausblick auf weitere wichtige Aspekte der Regulierung und den daraus resultierenden Schlussfolgerungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die kostenbasierte Regulierung, insbesondere die Rentabilitätsregulierung, und beleuchtet die Auswirkungen auf das Verhalten von Unternehmen mit natürlichen Monopolstrukturen. Dazu werden wichtige Themen wie Marktversagen, Wohlfahrtsverlust, strategische Verhaltensanreize, Preisbildung, Grenzkosten und das Averch-Johnson-Modell behandelt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein natürliches Monopol?
Ein natürliches Monopol entsteht, wenn ein einzelnes Unternehmen die gesamte Marktnachfrage kostengünstiger befriedigen kann als mehrere Wettbewerber, oft bei Versorgungsbetrieben.
Was ist das Ziel staatlicher Regulierung?
Ziel ist die Korrektur von Marktversagen, die Unterbindung von Monopolgewinnen und die Maximierung der Konsumentenrente durch faire Preisbildung.
Wie funktioniert die Rentabilitätsregulierung?
Hierbei wird dem Unternehmen eine bestimmte Verzinsung auf das eingesetzte Kapital erlaubt. Dies ist eine in den USA weit verbreitete Form der kostenbasierten Regulierung.
Was beschreibt das Averch-Johnson-Modell?
Es beschreibt den Effekt, dass regulierte Unternehmen dazu neigen, übermäßig viel Kapital einzusetzen (Überinvestition), um die absolute Basis für ihre erlaubte Rendite zu erhöhen.
Welche strategischen Verhaltensanreize entstehen für Monopolisten?
Unternehmen könnten versuchen, Kosten künstlich aufzublähen oder ineffizient zu produzieren, wenn die Regulierung keine Anreize zur Kostensenkung bietet.
- Citar trabajo
- Thorben Wicht (Autor), 2004, Regulierungsmechanismen - kostenbasierte Regulierung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47637