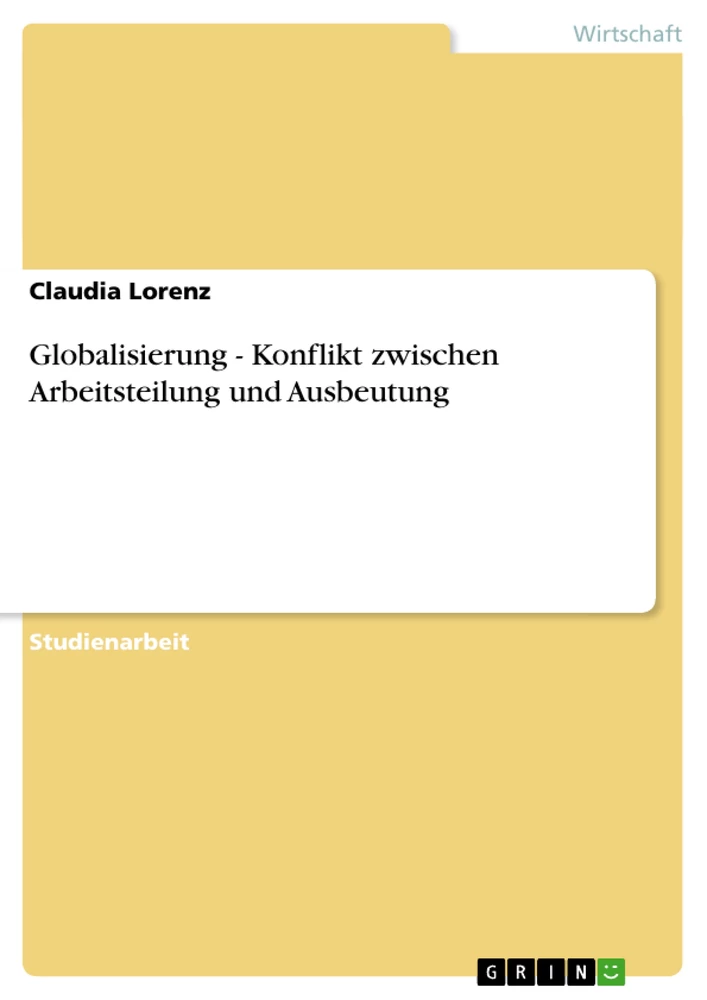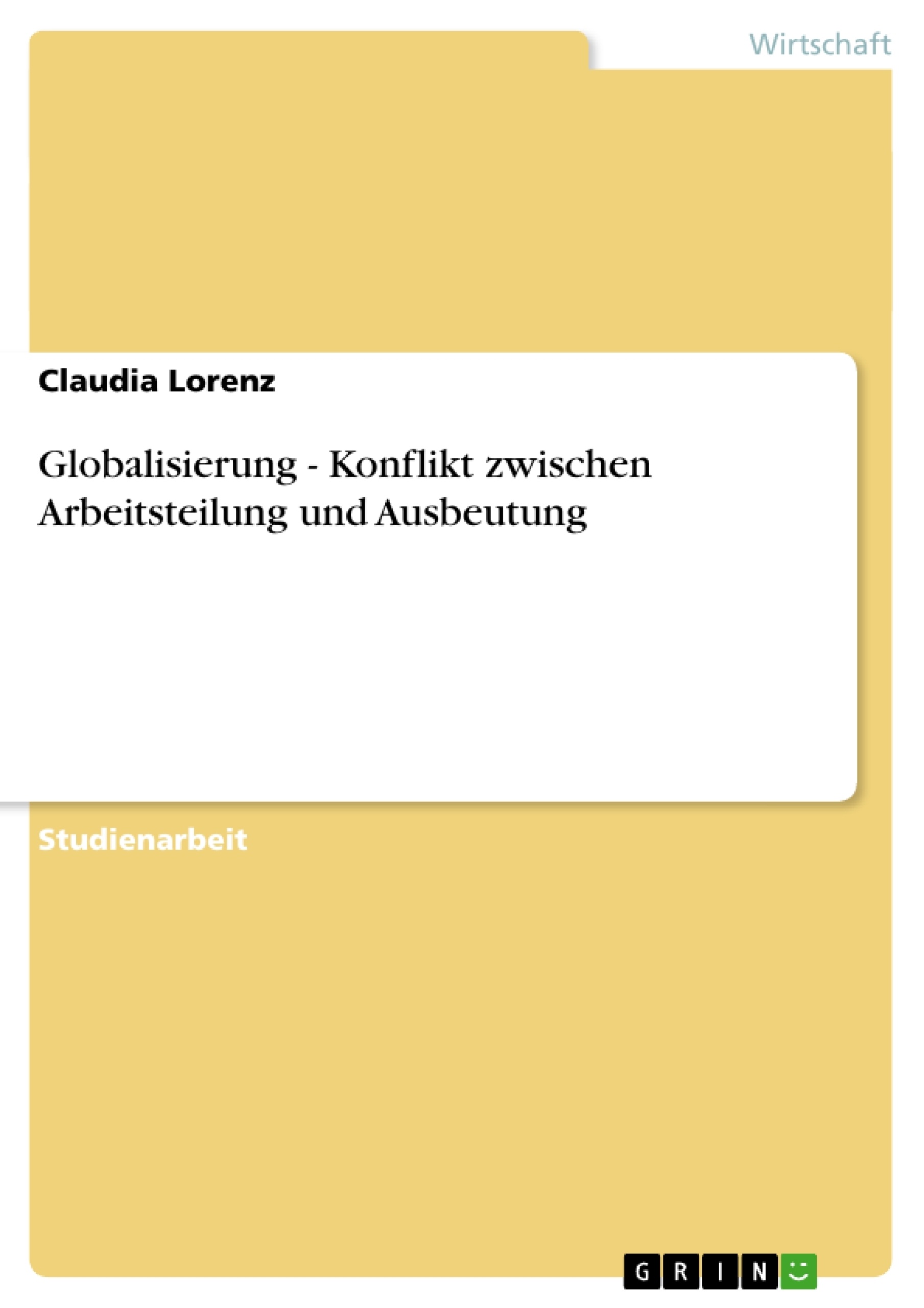Nach Ulrich Beck ist Globalisierung „sicher das am meisten gebrauchte – missbrauchte – und am seltensten definierte, wahrscheinlich missverständlichste, nebulöseste und politisch wirkungsvollste (Schlag- und Streit-)Wort der letzten,
aber auch der kommenden Jahre.“ Nach einer Definition des Begriffes „Globalisierung“ wird der Frage nachgegangen,
welche Gründe es für diese wirtschaftliche Entwicklung gibt. Dabei wird untersucht, welche Formen internationale Arbeitsteilung annehmen kann. Insbesondere der Handel spielt in der Globalisierung eine wichtige Rolle. Schließlich war er das erste Gebiet, in dem die Internationalisierung als Vorstufe
der Globalisierung stattfand. Aufgrund der großen Bedeutung des Handels wird in dieser Arbeit die Globalisierung vor allem unter diesem Aspekt mit Schwerpunkt auf die afrikanischen Entwicklungsländer und das Schwellenland Brasilien betrachtet
werden. Welche Folgen hat die Liberalisierung des Handels nicht nur auf das deutsche Sozialsystem, sondern auch auf den Handel mit Entwicklungsländern und deren wirtschaftliche Situation? Und warum sind einige Entwicklungsländer im Rahmen der Globalisierung erfolgreicher als andere? Tatsache ist, dass nicht alle Staaten uneingeschränkt am Globalisierungstrend
teilnehmen möchten und deshalb verschiedene Schutzmechanismen etabliert haben, was am Beispiel der EU dargestellt wird. Doch auch diese Beschränkungen werden durch internationale Abkommen schrittweise abgebaut, um mehr Staaten die gleichberechtigte Teilnahme am globalen Handel zu ermöglichen.
In den 1980ern und 1990ern profitierten vor allem die Industrieländer und einige asiatische Schwellenländer. Ohne den wirtschaftlichen Erfolg Chinas stieg die Zahl derer, die in absoluter Armut leben, zwischen 1990 und 1999 um 21
Millionen Menschen an. Wie sollte die Globalisierung gestaltet werden und welche mikroökonomischen Maßnahmen in den Entwicklungsländern sind notwendig, um dieser Armut entgegenzuwirken?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen zur Globalisierung
- Begriffe der Internationalisierung und Globalisierung
- Ursachen und treibende Kräfte der Globalisierung
- Internationale Arbeitsteilung – Grenzüberschreitende Unternehmensaktivitäten
- Die Rolle des Handels
- Regionalisierung/Internationale Freihandelszonen
- GATT und WTO
- Die Liberalisierung des Handels und ihre Folgen
- Auswirkungen der Globalisierung auf das Sozialsystem Deutschlands
- Auswirkungen der Globalisierung auf Entwicklungsländer
- Erfolgsfaktoren
- Wie geht es den afrikanischen Ländern heute?
- Beispiel für ein durch die Globalisierung erfolgreiches Schwellenland Brasilien
- Schutz trotz oder wegen der Globalisierung?
- Die EU und der Handel mit Entwicklungsländern
- Das Handelsabkommen von Cotonou
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit befasst sich mit dem Phänomen der Globalisierung und analysiert die Wechselwirkungen zwischen Arbeitsteilung und Ausbeutung im globalen Kontext. Sie untersucht die Ursachen und treibenden Kräfte der Globalisierung, die Rolle des internationalen Handels und dessen Auswirkungen auf das deutsche Sozialsystem und Entwicklungsländer. Besonderes Augenmerk wird auf die wirtschaftliche Situation afrikanischer Länder und das Beispiel Brasiliens als erfolgreiches Schwellenland gelegt. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Schutzmechanismen, die Staaten zur Abwehr der Globalisierung einrichten, sowie die Bemühungen der EU um einen gerechteren Handel mit Entwicklungsländern.
- Definition und Ursachen der Globalisierung
- Rolle des internationalen Handels in der Globalisierung
- Auswirkungen der Globalisierung auf das Sozialsystem Deutschlands und Entwicklungsländer
- Schutzmechanismen gegen die Globalisierung
- Chancen und Risiken der Globalisierung für Entwicklungsländer
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Bedeutung des Globalisierungskonzepts und stellt die Forschungsfrage nach dem Konflikt zwischen Arbeitsteilung und Ausbeutung im globalen Kontext. Kapitel 2 behandelt die Begriffe der Internationalisierung und Globalisierung, sowie deren Ursachen und treibende Kräfte. Kapitel 3 befasst sich mit der internationalen Arbeitsteilung und den grenzüberschreitenden Unternehmensaktivitäten. Kapitel 4 analysiert die Rolle des internationalen Handels, insbesondere die Bedeutung von Freihandelszonen, GATT und WTO, sowie die Folgen der Handelsliberalisierung. Kapitel 5 untersucht die Auswirkungen der Globalisierung auf Entwicklungsländer, wobei die Erfolgsfaktoren, die Situation afrikanischer Länder und das Beispiel Brasiliens als erfolgreiches Schwellenland im Fokus stehen. Kapitel 6 behandelt die Schutzmechanismen gegen die Globalisierung, speziell die Rolle der EU und das Handelsabkommen von Cotonou.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselbegriffe dieser Arbeit sind: Globalisierung, Internationalisierung, Arbeitsteilung, Ausbeutung, internationaler Handel, Freihandelszonen, GATT, WTO, Entwicklungsländer, Schwellenländer, Schutzmechanismen, EU, Cotonou-Abkommen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptursachen der Globalisierung?
Zu den treibenden Kräften gehören der technologische Fortschritt, die Liberalisierung des Welthandels sowie die zunehmende internationale Arbeitsteilung.
Welche Rolle spielen GATT und WTO in der Globalisierung?
Diese internationalen Organisationen und Abkommen fördern die Liberalisierung des Handels durch den schrittweisen Abbau von Handelshemmnissen.
Wie wirkt sich die Globalisierung auf Entwicklungsländer aus?
Die Auswirkungen sind zwiespältig: Während Schwellenländer wie Brasilien profitieren, leiden viele afrikanische Staaten unter Armut und mangelnder Teilhabe am globalen Handel.
Was ist das Cotonou-Abkommen?
Es ist ein Handelsabkommen zwischen der EU und Staaten in Afrika, der Karibik und dem Pazifik, das einen gerechteren Handel und Entwicklung fördern soll.
Welchen Einfluss hat die Handelsliberalisierung auf das deutsche Sozialsystem?
Die Arbeit untersucht, wie der globale Wettbewerbsdruck und die Liberalisierung des Handels die sozialen Sicherungssysteme in Industrieländern wie Deutschland beeinflussen.
Warum sind manche Staaten bei der Globalisierung erfolgreicher als andere?
Der Erfolg hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter politische Stabilität, Infrastruktur, Bildungsniveau und die Fähigkeit, Schutzmechanismen effektiv zu nutzen.
- Quote paper
- Claudia Lorenz (Author), 2005, Globalisierung - Konflikt zwischen Arbeitsteilung und Ausbeutung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47646