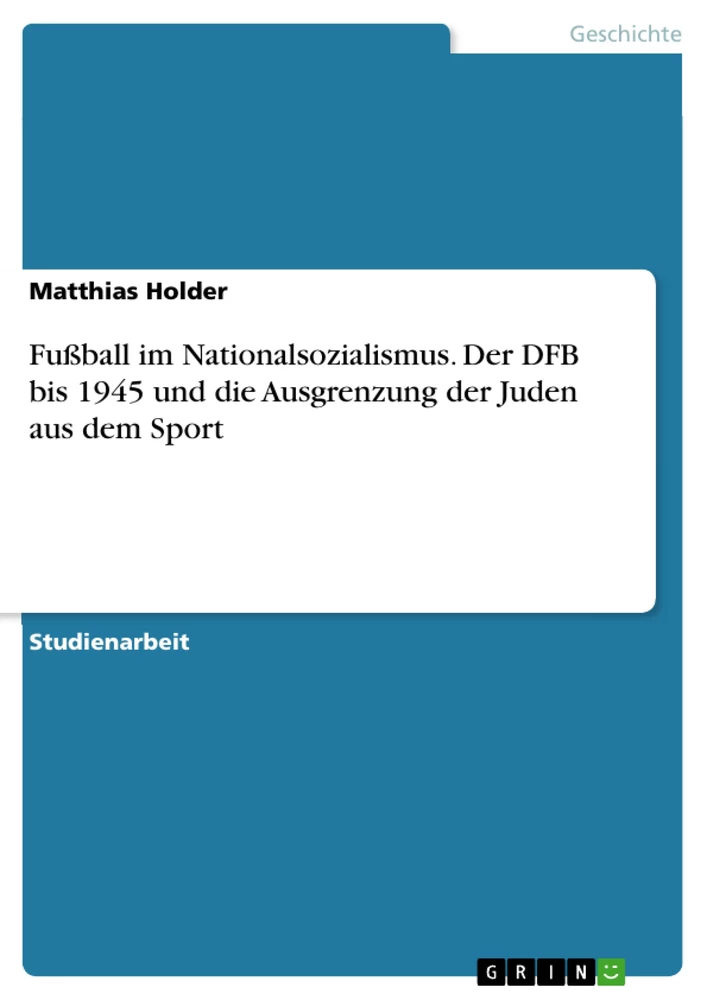Schon seit der Antike lässt sich ein Zusammenhang zwischen Sport und Politik herstellen. Sport entwickelte sich über den natürlichen Trieb zur Bewegung und zum Spiel zu einem Massenphänomen, das nicht selten von politischer Einflussnahme verschont blieb. Oftmals erhofften sich Politiker durch Anteilnahme an Sportereignissen einen Prestigegewinn und damit auch einen Machtzuwachs. So ist es nicht überraschend, dass Sport in der Zeit des Nationalsozialismus ein populäres Mittel war um in alle Lebensbereiche der Bewohner des „Dritten Reiches“ durchzudringen zu können. Als zum Ende des Jahres 1932 der Deutsche Fußball-Bund (DFB) rund eine Million aktive Mitglieder zählte, entwickelte sich der DFB zum größten Sportverband im baldigen „Dritten Reich“. Die Nationalsozialisten machten auch vor dem Deutschen Fußball-Bund keinen Halt, gliederten diesen in den „NS-Apparat“ ein und unterwarfen den Bund der nationalsozialistischen Ideologie.
Ohne auf die Geschichte zur Entstehung des Fußballs einzugehen, möchte ich mich in meiner Arbeit auf die Geschichte des DFB zur Zeit des Nationalsozialismus fokussieren. Um aber ein Grundverständnis für die Geschichte des DFB zur Zeit des Nationalsozialismus zu schaffen werde ich im ersten Teil meiner Arbeit, bewusst kurzgehalten, auf die ersten Jahre des DFB bis hin zur Weimarer Republik eingehen. Im anschließenden Teil der Arbeit wurden die Gleichschaltungen des DFB und seine Umstrukturierungen in der Zeit des Nationalsozialismus von mir bearbeitet. Um die Stellung des jüdischen Sports zu beschreiben gebe ich in Kapitel 4 einen Überblick über Antisemitismus und die Ausgrenzung der Juden aus dem Sport. Anhand der Biografie von Julius Hirsch wird diese Thematik und die Vorgänge der Ausgrenzung im Kapitel 4.2 veranschaulicht.
So stelle ich mir am Anfang dieser Arbeit die Fragen: Wie verhielt sich der DFB vor der Zeit des Nationalsozialismus und während des Zeit des herrschenden „NS-Regimes“? Profitierte der DFB von der nationalsozialistischen Sportpolitik? Auf die Zeit nach dem Nationalsozialismus könnte man auch eingehen, dies würde aber den Rahmen der Arbeit sprengen. Ich werde aber bei der Erwähnung einiger Quellen in der Einleitung kurz auf das Verhalten des DFB nach dem Jahr 1945 eingehen. Eine weitere Kernfrage meiner Arbeit ist: Wie organisierten sich die jüdischen Sportler und welche Schicksale teilten sie? Darauf gehe ich im Kapitel 4 näher ein und versuche die Fragen entsprechend zu erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Deutsche Fußball-Bund bis 1933
- 2.1 Die ersten Jahre des Deutschen Fußball-Bundes
- 2.2 Der DFB in der Weimarer Republik
- 3. Fußball und der DFB zur Zeit des Nationalsozialismus
- 3.1 Die erste Gleichschaltung
- 3.2 Die zweite Gleichschaltung und die Jahre 1936 – 1945
- 4. Antisemitismus im Fußball und die Geschichte eines Opfers: Julius Hirsch
- 4.1 Die Ausgrenzung der Juden aus dem Fußballsport
- 4.2 Julius Hirsch. Das Schicksal eines ehemaligen Nationalspielers.
- 5. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Kontext des Nationalsozialismus. Sie beleuchtet die Entwicklung des DFB vor 1933 und analysiert dessen Gleichschaltung unter dem NS-Regime. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Ausgrenzung jüdischer Sportler aus dem Fußball und dem Schicksal von Julius Hirsch als Beispiel für die Folgen dieser Politik.
- Der DFB vor dem Nationalsozialismus
- Die Gleichschaltung des DFB unter dem NS-Regime
- Antisemitismus im deutschen Fußball
- Das Schicksal jüdischer Sportler
- Der Einfluss der nationalsozialistischen Ideologie auf den Sport
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Zusammenhang zwischen Sport und Politik dar und führt in die Thematik der Arbeit ein. Sie skizziert die Bedeutung des DFB als größten Sportverband im "Dritten Reich" und kündigt die Fokussierung auf die Geschichte des DFB während des Nationalsozialismus an. Die Einleitung benennt die zentralen Forschungsfragen: das Verhalten des DFB vor und während des NS-Regimes, der Nutzen des DFB aus der nationalsozialistischen Sportpolitik, sowie die Organisation und Schicksale jüdischer Sportler. Es wird erwähnt, dass die Zeit nach 1945 aus Umfangsgründen nicht umfassend behandelt werden kann. Die Einleitung erwähnt auch die verwendeten Quellen, darunter das Werk von Nils Havemann, das als objektive und umfassende Quelle hervorgehoben wird, im Gegensatz zu subjektiveren Werken wie dem von Carl Koppehel.
2. Der Deutsche Fußball-Bund bis 1933: Dieses Kapitel beschreibt die Anfänge des DFB und dessen Entwicklung bis zur Weimarer Republik. Es wird der anfängliche Charakter des Fußballs als Sport der Mittelschicht und des Bildungsbürgertums hervorgehoben, im Gegensatz zur Arbeiterklasse, die aufgrund von Verletzungsrisiko und Kosten zunächst weniger beteiligt war. Der DFB bemühte sich um die Erweiterung seiner Mitgliederbasis, suchte Kontakt zu Kaiserhaus und Militär, um seine Position zu stärken. Die Unterstützung durch das Militär unterstreicht den frühen Einfluss von staatlichen Stellen auf den Fußball in Deutschland.
Schlüsselwörter
Deutscher Fußball-Bund (DFB), Nationalsozialismus, Antisemitismus, Judenverfolgung, Sportpolitik, Gleichschaltung, Julius Hirsch, Weimarer Republik, NS-Regime.
FAQ: Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Nationalsozialismus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Kontext des Nationalsozialismus. Sie beleuchtet die Entwicklung des DFB vor 1933, analysiert dessen Gleichschaltung unter dem NS-Regime und fokussiert sich auf die Ausgrenzung jüdischer Sportler, insbesondere das Schicksal von Julius Hirsch.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den DFB vor dem Nationalsozialismus, die Gleichschaltung des DFB unter dem NS-Regime, Antisemitismus im deutschen Fußball, das Schicksal jüdischer Sportler und den Einfluss der nationalsozialistischen Ideologie auf den Sport.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet Kapitel zur Einleitung, dem DFB bis 1933 (inkl. der ersten Jahre und der Weimarer Republik), Fußball und DFB zur Zeit des Nationalsozialismus (inkl. der Gleichschaltungsphasen), Antisemitismus im Fußball und dem Schicksal von Julius Hirsch (inkl. der Ausgrenzung jüdischer Sportler und dem Schicksal von Julius Hirsch), sowie eine Schlussbemerkung.
Wie wird der DFB vor 1933 dargestellt?
Das Kapitel beschreibt die Anfänge des DFB und dessen Entwicklung bis zur Weimarer Republik. Es hebt den anfänglichen Charakter des Fußballs als Sport der Mittelschicht hervor und zeigt die Bemühungen des DFB um Mitgliedergewinnung und die Stärkung seiner Position durch Kontakte zu Kaiserhaus und Militär.
Wie wird die Gleichschaltung des DFB unter dem NS-Regime behandelt?
Die Arbeit analysiert die Gleichschaltung des DFB in zwei Phasen. Sie untersucht die Auswirkungen der nationalsozialistischen Ideologie auf den Fußball und die Rolle des DFB unter dem NS-Regime.
Welche Rolle spielt Antisemitismus in der Arbeit?
Ein Schwerpunkt liegt auf der Ausgrenzung jüdischer Sportler aus dem Fußball. Das Schicksal von Julius Hirsch dient als Beispiel für die Folgen dieser Politik.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit nennt Nils Havemanns Werk als objektive und umfassende Quelle, im Gegensatz zu subjektiveren Werken wie dem von Carl Koppehel.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Verhalten des DFB vor und während des NS-Regimes, den Nutzen des DFB aus der nationalsozialistischen Sportpolitik und die Organisation und Schicksale jüdischer Sportler.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Deutscher Fußball-Bund (DFB), Nationalsozialismus, Antisemitismus, Judenverfolgung, Sportpolitik, Gleichschaltung, Julius Hirsch, Weimarer Republik, NS-Regime.
Wird die Zeit nach 1945 behandelt?
Die Zeit nach 1945 wird aus Umfangsgründen nicht umfassend behandelt.
- Citation du texte
- Matthias Holder (Auteur), 2016, Fußball im Nationalsozialismus. Der DFB bis 1945 und die Ausgrenzung der Juden aus dem Sport, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/476714