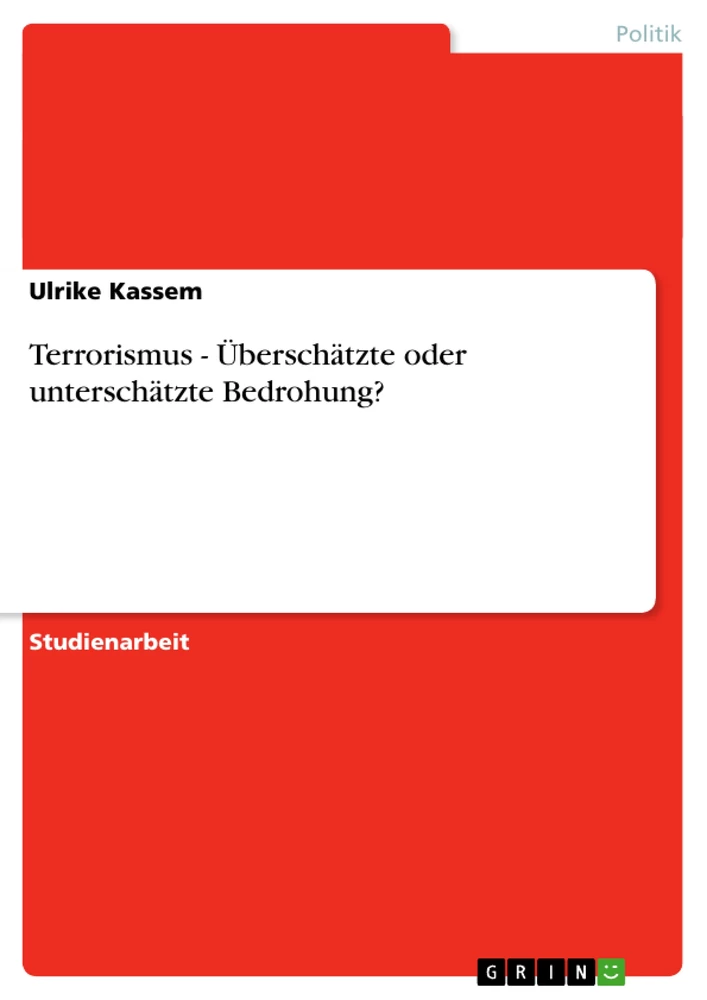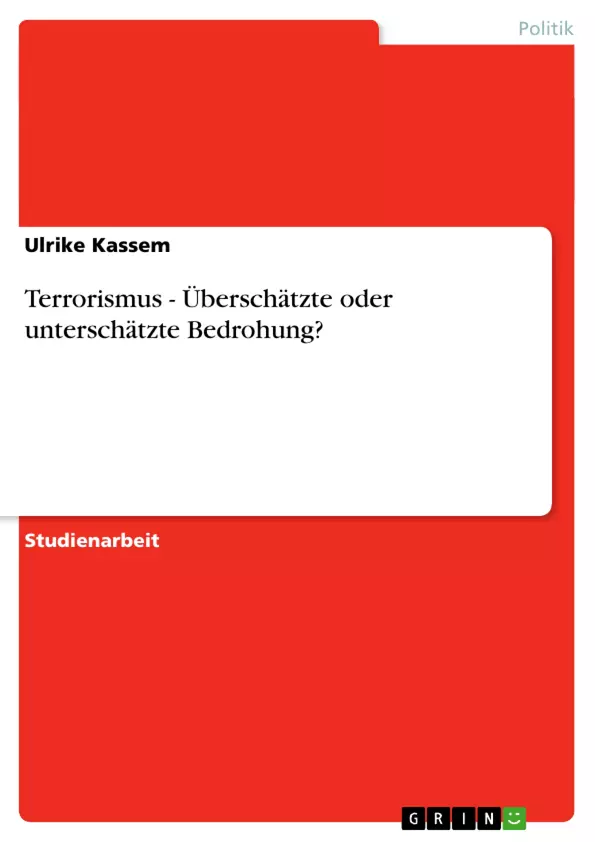Es ist das zurzeit zweifellos populärste politische Thema, dem sich der Soziologe Peter Waldmann in „Politik im 21. Jahrhundert“ zugewandt hat. Über kein zweites Feld wird derzeit so massenwirksam debattiert wie über den Terrorismus. Und es ist, zumindest in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, wohl auch das aktuellste, dringlichste aller Themen. Im von den USA ausgerufenen „fight against terrorism“, dem Kampf gegen Terrorismus, stehen die Vereinigten Staaten und England vor einem Krieg gegen den Irak und patrouillieren unverändert UN-Truppen in Afghanistan – auf der Suche nach den Drahtziehern der Al Qaida, die für die mittlerweile bekanntesten Terroranschläge aller Zeiten stehen, die Flugzeugattentate auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington am 11. September 2001.
Waldmann versucht, Licht in die vielen dunklen Winkel des Phänomens Terrorismus zu werfen. Er gibt Einblick in die Schwierigkeit, schon allein dessen Ausmaß zu erkennen und Terrorismus als Begriff zu definieren, analysiert Ursprünge sowie verschiedene Formen von Terrorismus, grenzt diese Art der Gewalt von anderen ab und skizziert die Motivationen, die Terroristen handeln lässt, um schließlich zu den zwei zweifellos entscheidenden Fragen vorzudringen: Wie sieht der Terrorismus der Zukunft aus? Und: In welchem Umfang wird die – momentan einzigartige – emotionale Kraft des Begriffes Terrorismus missbraucht, um daraus „politisches Kapital“ zu schlagen? In diesen beiden Kernpunkten liegt das wirkliche Problem, das in Waldmanns Essay behandelt wird: Die scheinbar wachsende Differenz zwischen tatsächlichem Terrorismus und dessen Darstellung in der Öffentlichkeit sowie die durch ihn möglich werdenden Konsequenzen, die terroristische Gewalt in wachsendem Maße nach sich zieht. Das Gros dieser Konsequenzen sind zunehmend unverhältnismäßige Reaktionen betroffener Staaten oder Völker auf Terrorakte und mögliche Terrorakte, die nicht aus einer Angst vor Terrorismus selbst resultieren. Und es sind die Instrumentalisierung von Glauben und/oder Kultur sowie die verhängnisvolle Verflechtung von Terrorismus mit kriegerischen Mitteln verfeindeter Staaten, zum Beispiel der Möglichkeit zur Beschaffung oder Herstellung von Massenvernichtungswaffen. Aktuelle Beispiele sind Nordkorea und wiederum der Irak.
Inhaltsverzeichnis
- Thema und Problem
- Die Schlüsselbegriffe
- Risiken und Chancen
- Aktuelle und künftige Politik
- Die Qualität des Essays
- Die Relevanz des Textes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay von Peter Waldmann befasst sich mit dem Phänomen des Terrorismus und untersucht dessen Ausmaß, Ursprünge, Formen und Motivationen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Frage, wie sich Terrorismus in der Zukunft entwickeln wird und inwieweit der Begriff zur Instrumentalisierung politischer Ziele missbraucht wird. Der Essay thematisiert die Unterschiede zwischen dem tatsächlichen Terrorismus und seiner Darstellung in der Öffentlichkeit sowie die Folgen, die aus terroristischen Handlungen resultieren.
- Die Definition und Abgrenzung von Terrorismus
- Die Rolle von Globalisierung und Massenvernichtungswaffen im Kontext des Terrorismus
- Die Motivationen von Terroristen und die Ursachen für terroristische Gewalt
- Die Folgen von Terrorismus und die Reaktionen der Staaten
- Die Instrumentalisierung des Terrorismus zu politischen Zwecken
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel thematisiert die Problematik, Terrorismus zu definieren und dessen Ausmaß zu erfassen. Waldmann stellt heraus, dass das Phänomen des Terrorismus in der öffentlichen Wahrnehmung stark überzeichnet wird und die tatsächliche Bedrohung durch terroristische Gewalt möglicherweise überschätzt wird. Im zweiten Kapitel werden die wichtigsten Schlüsselbegriffe des Essays erläutert, darunter „Terrorismus“, „Globalisierung“ und „Massenvernichtungswaffen“. Waldmann diskutiert die Bedeutung dieser Begriffe im Kontext des Terrorismus und analysiert deren Einfluss auf die Entwicklung des Phänomens. Das dritte Kapitel widmet sich den Risiken und Chancen, die mit dem Terrorismus verbunden sind. Waldmann analysiert die Motive und Strategien von Terroristen und geht auf die Folgen von terroristischen Anschlägen ein. Außerdem werden verschiedene Formen von Terrorismus vorgestellt und deren unterschiedliche Charakteristika erläutert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe, die im Essay von Peter Waldmann eine wesentliche Rolle spielen, sind „Terrorismus“, „Globalisierung“, „Massenvernichtungswaffen“ und „Bedrohung“. Die Analyse des Phänomens „Terrorismus“ steht im Mittelpunkt des Textes, wobei die Wechselwirkungen mit den Schlüsselbegriffen „Globalisierung“ und „Massenvernichtungswaffen“ besondere Aufmerksamkeit erhalten. Der Begriff „Bedrohung“ wird im Zusammenhang mit der zunehmenden Gefahr durch Terrorismus betrachtet, wobei Waldmann kritisch hinterfragt, wie die Bedrohungslage durch Terrorismus angemessen eingeschätzt und bewertet werden kann.
Häufig gestellte Fragen
Wird die Bedrohung durch Terrorismus in der Öffentlichkeit überschätzt?
Der Essay von Peter Waldmann legt nahe, dass eine Differenz zwischen tatsächlichem Terrorismus und dessen Darstellung besteht, wobei die emotionale Kraft des Begriffs oft zu einer Überzeichnung der realen Gefahr führt.
Wie wird Terrorismus instrumentalisiert?
Der Begriff wird häufig genutzt, um "politisches Kapital" zu schlagen, unverhältnismäßige staatliche Reaktionen zu rechtfertigen oder Kriege gegen unliebsame Staaten zu führen (z.B. Instrumentalisierung von Angst).
Welche Rolle spielt die Globalisierung für den modernen Terrorismus?
Globalisierung erleichtert Terroristen die Vernetzung, die Beschaffung von Mitteln und die mediale Verbreitung ihrer Taten, was die Reichweite und Wirkung von Anschlägen massiv erhöht.
Was sind die größten Risiken des Terrorismus der Zukunft?
Besorgniserregend sind die Verflechtung von Terrorismus mit staatlichen Akteuren und die potenzielle Beschaffung von Massenvernichtungswaffen.
Warum reagieren Staaten oft unverhältnismäßig auf Terrorakte?
Oft resultieren diese Reaktionen nicht aus der Angst vor dem Terrorismus selbst, sondern dienen der Demonstration von Stärke oder der Durchsetzung anderer politischer Interessen.
- Citation du texte
- Ulrike Kassem (Auteur), 2003, Terrorismus - Überschätzte oder unterschätzte Bedrohung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47686