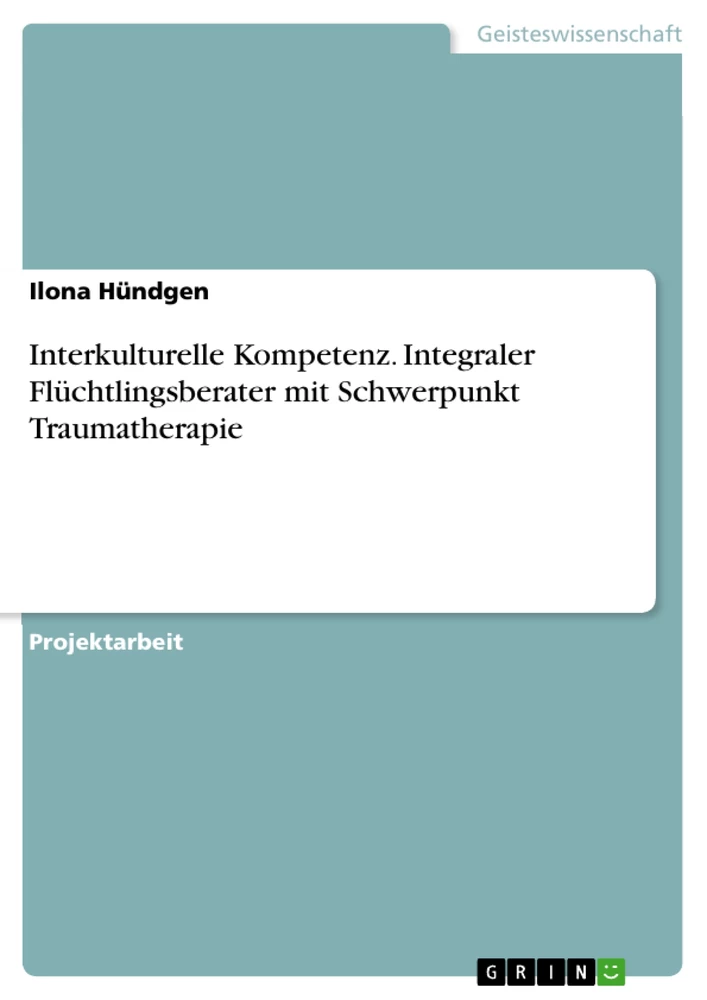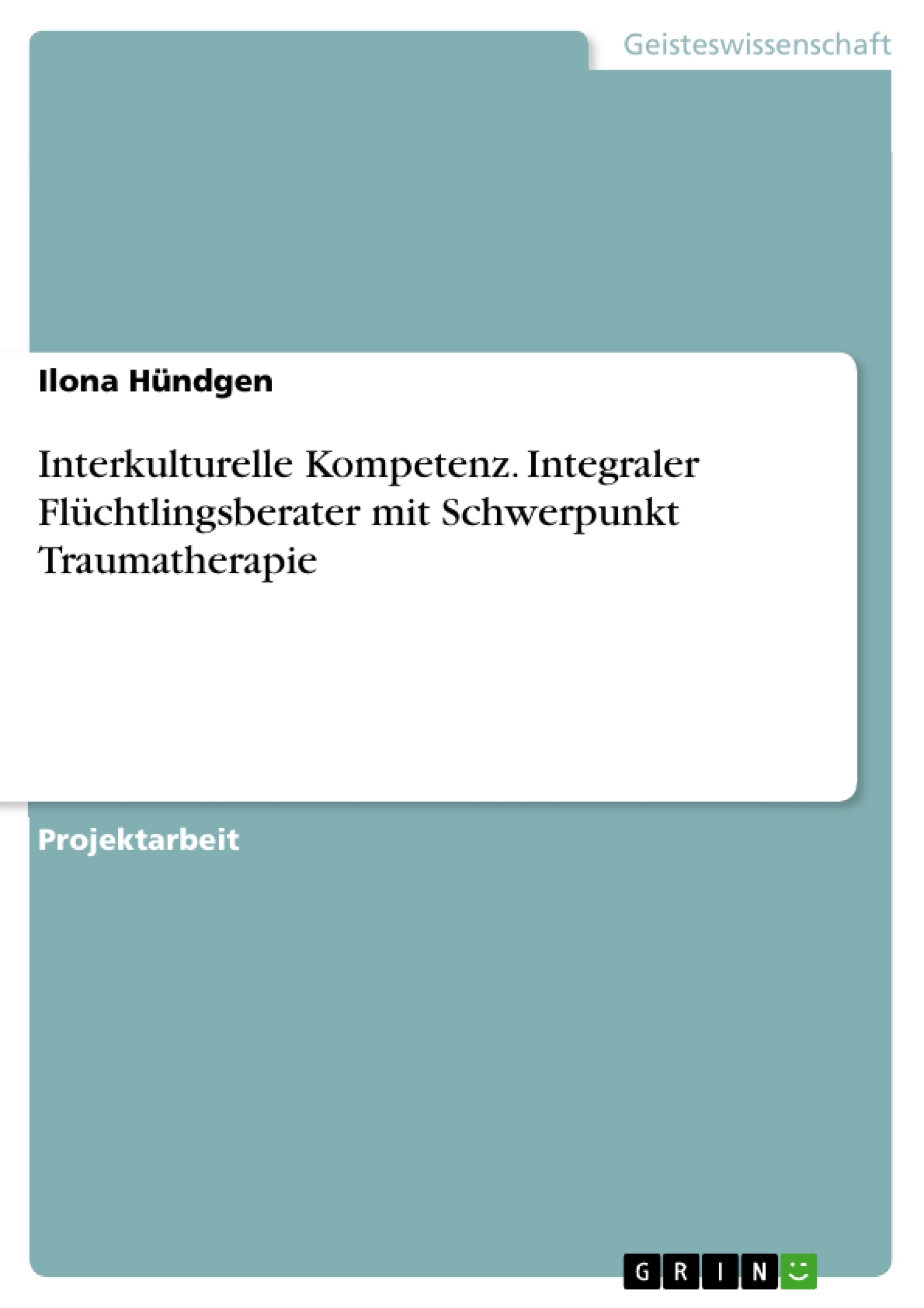Interkulturelle Kompetenz ist eine wesentliche Voraussetzung für die beraterische und therapeutische Arbeit mit Flüchtlingen und Migranten.
Es ist viel Hintergrundwissen über kulturspezifische Einstellungen und Verhaltensweisen erforderlich, um zu Flüchtlingen und Migranten eine Vertrauensbasis aufbauen und interkulturelle Psychoedukation sowie interkulturelle Beratung und Therapie durchführen zu können. Interkulturelles Wissen, interkulturelle Erfahrung, Kultursensibilität und empathisches Verhalten ermöglichen es, auf die Bedürfnisse der Klienten bzw. Patienten optimal einzugehen und die Beratung bzw. Therapie zu optimieren.
Interkulturelle Handlungskompetenz (als praxisbezogene Teilkompetenz der interkultuellen Kompetenz) ist z.B. im globalen Business und in internationalen Hilfsprojekten, z.B. in Afrika, unverzichtbar. Globaler Handel zwischen den unterschiedlichsten Kulturkreisen ist heutzutage ein Milliardengeschäft. In Zusatzstudiengängen, in Studienfächern wie „Global Management“ sowie in Workshops zur interkulturellen Handlungskompetenz lassen sich interkulturelle (Handlungs)Kompetenzen für ganz unterschiedliche berufliche und private Anwendungsbereiche erwerben.
Wer Freunde im Ausland hat, kann sich durch interkulturelle Kompetenz besser verständigen, schneller dazulernen, mehr Freude haben und leichter sein persönliches Netzwerk ausbauen. Insbesondere Offenheit, Toleranz und Gleichberechtigung sind auch im privaten Leben wichtige Kompetenzen. In der Flüchtlingsberatung ist ein hohes Niveau an interkultureller Kompetenz ein Muss. Als FlüchtlingsberaterIn muss man mit der Kultur und Religion der Flüchtlinge und Migranten vertraut sein und über entsprechende psychoedukative Materialien in unterschiedlichen Sprachen verfügen. FlüchtlingsberaterIn bzw. FlüchtlingstherapeutIn zu sein bedeutet, lebenslang zu lernen, und zwar um so mehr, je fremder die Kulturen im Vergleich zu der Kultur sind, aus der man selbst stammt (Kulturunterschiede). Kennt man die Bedingungen, Verlaufsprozesse und Wirkungen interkulturellen Handelns und Erlebens, kann dies maßgeblich dazu beitragen, Verständnisprobleme, Irritationen, Fehlurteile und Handlungsblockaden, die im Zusammenleben mit Vertretern unterschiedlicher Kulturen entstehen können, zu beheben und zu mehr Handlungswirksamkeit in der globalen Kommunikation und Kooperation sowie nicht zuletzt auch in der interkulturellen psychosozialen Beratung und Psychotherapie zu gelangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Interkulturelle Kompetenz
- 2.1 Was ist „interkulturelle Kompetenz“?
- 2.2 Was bedeutet „interkulturelle Kompetenz“ im Unterschied zu den Begriffen „Eigenkultur“ und „Fremdkultur“?
- 3 Interkulturelle Handlungskompetenz und ihre Teilkompetenzen
- 4 Welchen kulturellen Hintergrund haben ich, meine Eltern und meine Großeltern? Welche kulturellen Geschichten verbinde ich mit deren Geschichte?
- 5 Welche eigenen Erfahrungen verbinde ich mit „interkultureller Kompetenz“ und „interkultureller Handlungskompetenz“? Welche Möglichkeiten und Grenzen der Einflussnahme sehe ich?
- 5.1 Eigene interkulturelle Erfahrungen
- 5.2 Möglichkeiten der Einflussnahme
- 5.3 Grenzen der Einflussnahme
- 6 Meine interkulturellen Kompetenzen
- 6.1 Profil meiner bereits vorhandenen interkulturellen Kompetenzen
- 6.1.1 Meine bereits vorhandenen allgemeinen interkulturellen Kompetenzen
- 6.1.2 Meine bereits vorhandenen beraterischen und therapeutischen interkulturellen Kompetenzen
- 6.2 In welchen Bereichen sind meine interkulturellen Kompetenzen schon gut ausgeprägt, und in welchen Bereichen besteht noch Entwicklungsbedarf?
- 7 Welche Verbindung besteht zwischen dem Berliner Partizipations- und Integrationsgesetz und meinem Aufgabenbereich als Fachbearbeiterin für Flüchtlinge?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Projektarbeit befasst sich mit der Bedeutung von interkultureller Kompetenz im Kontext der beraterischen und therapeutischen Arbeit mit Flüchtlingen und Migranten. Die Arbeit analysiert verschiedene Definitionen und Komponenten von interkultureller Kompetenz und untersucht deren Relevanz für die Praxis der Flüchtlingsberatung. Neben der theoretischen Auseinandersetzung werden persönliche Erfahrungen und Kompetenzen der Autorin im Bereich interkultureller Kompetenz beleuchtet und in den Kontext des Berliner Partizipations- und Integrationsgesetz gestellt.
- Definitionen und Facetten von „interkultureller Kompetenz“
- Analyse der Komponenten und Dimensionen von interkultureller Kompetenz
- Relevanz von interkultureller Kompetenz in der Flüchtlingsberatung
- Persönliche Erfahrungen und Kompetenzen im Bereich der interkulturellen Kommunikation
- Zusammenhang zwischen interkultureller Kompetenz und dem Berliner Partizipations- und Integrationsgesetz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Bedeutung von interkultureller Kompetenz im Kontext der Arbeit mit Flüchtlingen und Migranten dar und skizziert den Rahmen der vorliegenden Arbeit. Kapitel 2 beschäftigt sich mit Definitionen und Komponenten der interkulturellen Kompetenz. Es werden verschiedene Definitionen von „interkultureller Kompetenz“ vorgestellt und in ihren jeweiligen Kontext gestellt. Weiterhin werden wichtige Teilkompetenzen und Dimensionen der interkulturellen Kompetenz, wie zum Beispiel die affektive, kognitive und verhaltensbezogene Dimension, dargestellt. Kapitel 3 untersucht die Bedeutung der interkulturellen Handlungskompetenz und die Relevanz der entsprechenden Teilkompetenzen für die Praxis der Flüchtlingsberatung. Die Autorin reflektiert in Kapitel 4 ihren eigenen kulturellen Hintergrund und die persönlichen Erfahrungen, die sie mit „interkultureller Kompetenz“ und „interkultureller Handlungskompetenz“ verbindet. In Kapitel 5 beleuchtet sie die eigenen Erfahrungen mit „interkultureller Kompetenz“ und untersucht die eigenen Möglichkeiten und Grenzen der Einflussnahme im interkulturellen Kontext. Kapitel 6 widmet sich dem Profil der eigenen interkulturellen Kompetenzen und analysiert sowohl bereits vorhandene Stärken als auch Bereiche mit Entwicklungsbedarf. Die Arbeit schließt mit einer Analyse der Verbindung zwischen dem Berliner Partizipations- und Integrationsgesetz und dem Aufgabenbereich der Autorin als Fachbearbeiterin für Flüchtlinge.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Kompetenz, interkulturelle Handlungskompetenz, Flüchtlingsberatung, interkulturelle Psychoedukation, kulturspezifische Einstellungen, Verhaltensweisen, Vertrauensbasis, Kultursensibilität, empathisches Verhalten, Berliner Partizipations- und Integrationsgesetz, globale Kommunikation, Kooperation, interkulturelle psychosoziale Beratung, Psychotherapie.
- Arbeit zitieren
- Dr. Ilona Hündgen (Autor:in), 2019, Interkulturelle Kompetenz. Integraler Flüchtlingsberater mit Schwerpunkt Traumatherapie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/476894