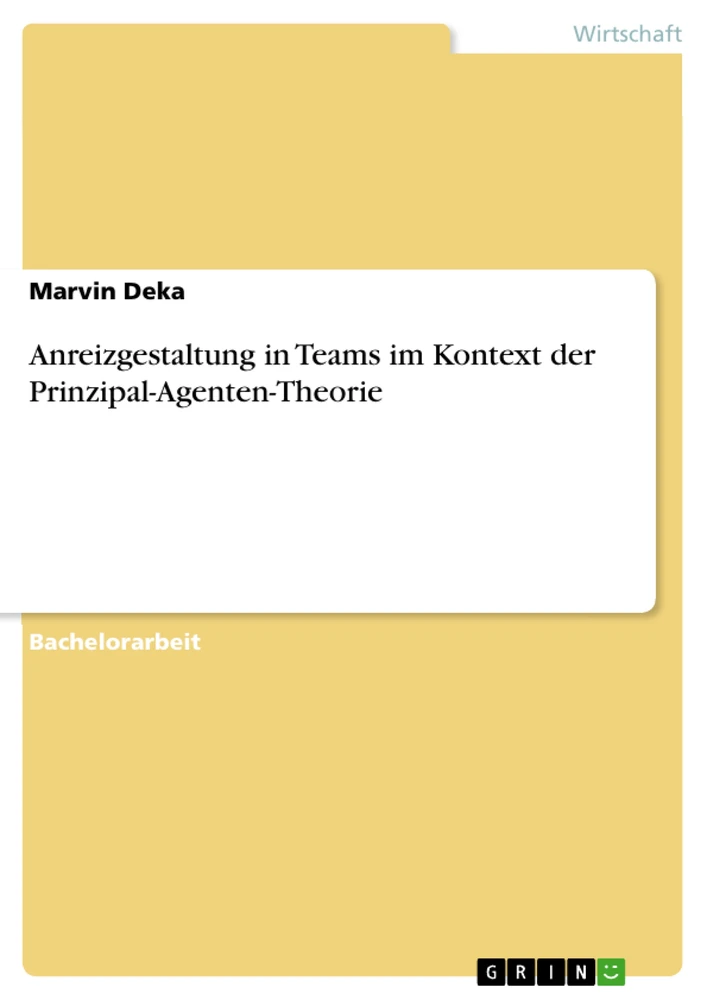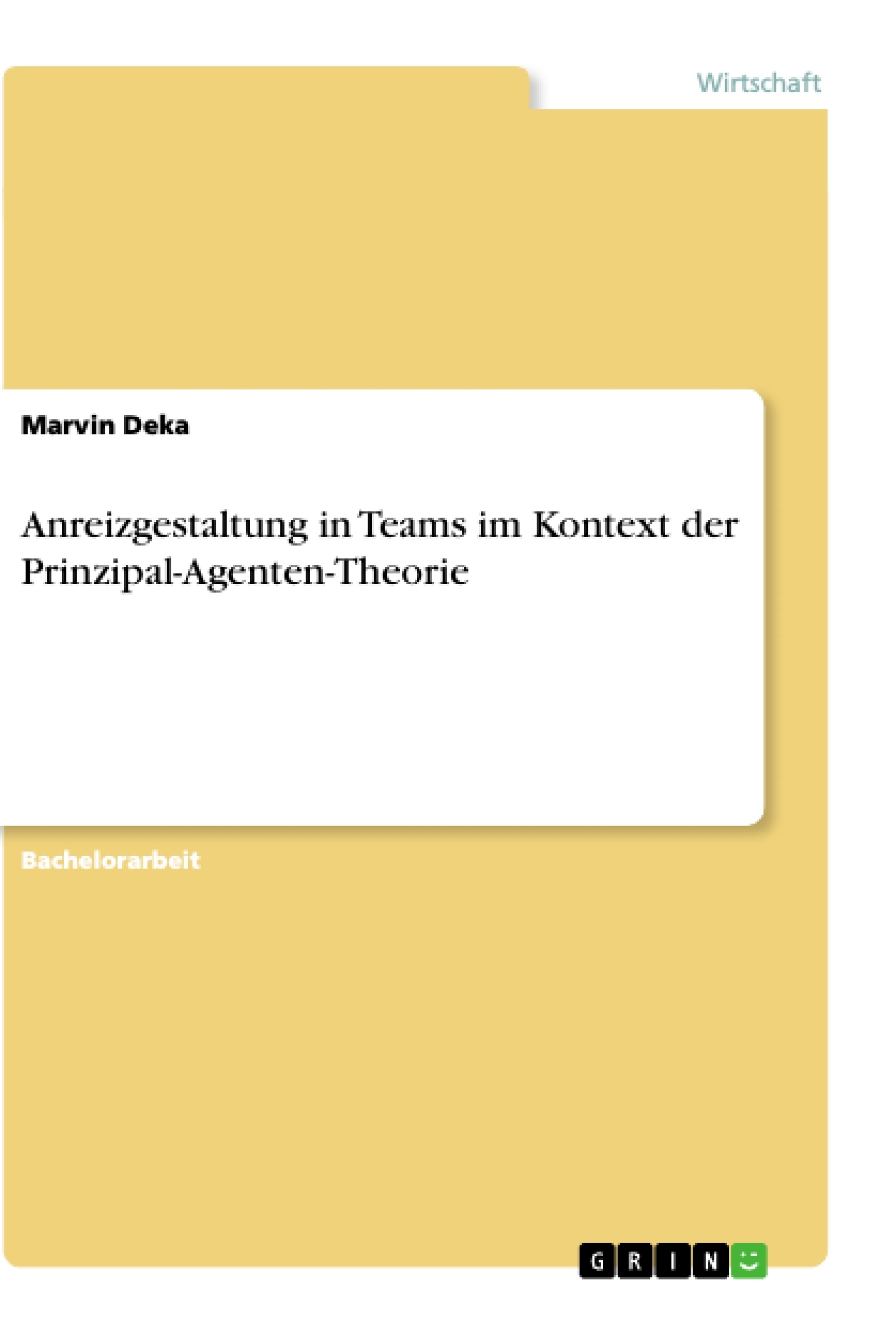Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob die im Modell nach Holmström (1982) entwickelten optimalen Team-Anreizsysteme in das Modell von Kvaløy/Olsen (2006) so übertragen werden können, dass diese Anreizsysteme dort ebenfalls optimal sind. Diese Frage wird mithilfe eines theoretischen Vergleichs der beiden Multi-Agenten-Modelle beantwortet. Zu Beginn dieser Arbeit wird ein Überblick über Aufbau und Literatur des Prinzipal-Agenten-Modells mit einem Prinzipal und mehreren Agenten gegeben. Die Konzepte der individuellen, gemeinschaftlichen sowie relativen Leistungsentlohnung werden dabei als verschiedene Ansätze zur teamorientierten Anreizgestaltung vorgestellt und voneinander abgegrenzt. In einem weiteren Schritt werden Voraussetzungen und Eigenschaften der optimalen Team-Anreizsysteme des Modells nach Holmström (1982) entwickelt und kritisch betrachtet. Schwerpunkt liegt dabei auf den Ansätzen der relativen und gemeinschaftlichen Leistungsmessung. Selbiges gilt für das Modell von Kvaløy/Olsen (2006). In einem letzten Schritt werden die optimalen Lösungen des einperiodigen Modells auf Übertragbarkeit und Optimalität im mehrperiodigen Kontext geprüft. Ein Anreizsystem wird als übertragbar angenommen, wenn die Eigenschaften des Systems vollständig abgebildet werden können und die Modellannahmen nach Kvaløy/Olsen (2006) dessen Anwendbarkeit zulassen. Dieses Anreizsystem gilt als optimal, wenn sich der Gewinn des Prinzipals durch Anwendung des Systems im Vergleich zum optimalen Ausgangsvertrag nicht verschlechtert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Anreizsysteme im Multi-Agenten-Fall
- Grundlagen der Prinzipal-Agenten-Theorie
- Der Team-Begriff und resultierende Probleme
- Ansätze für Anreizsysteme im Team-Kontext
- Beschreibung des einperiodigen Modells anhand von Holmström (1982)
- Aufbau des Grundmodells
- JPE in Abhängigkeit von Gruppenbestrafungen und Gruppenboni
- RPE in Abhängigkeit von Unsicherheits- und Risikofaktoren
- Beschreibung des mehrperiodigen Modells anhand von Kvaløy/Olsen (2006)
- Aufbau des Grundmodells und grundlegender Überblick
- JPE und der Peer-Monitoring-Vorteil
- RPE und der Commitment-Vorteil
- Prüfung auf Übertragbarkeit und Optimalität
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Gestaltung von Anreizsystemen in Teams im Kontext der Prinzipal-Agenten-Theorie. Sie beleuchtet die Herausforderungen, die durch die Koordination und Motivation von mehreren Agenten entstehen, und analysiert verschiedene Ansätze für die Entwicklung effizienter Anreizstrukturen in Teams.
- Grundlagen der Prinzipal-Agenten-Theorie
- Team-spezifische Probleme und Anreizkonflikte
- Modelle für Anreizsysteme in Teams
- Analyse der Effizienz und Optimierung von Anreizsystemen
- Übertragbarkeit und praktische Implikationen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Prinzipal-Agenten-Theorie und ihren zentralen Annahmen. Anschließend werden spezifische Herausforderungen und Probleme im Kontext von Teams beleuchtet. Im Anschluss daran werden verschiedene Ansätze für Anreizsysteme in Teams vorgestellt und anhand von ein- und mehrperiodigen Modellen analysiert. Die Arbeit fokussiert auf die Analyse der Effizienz von Joint Performance Evaluation (JPE) und Relative Performance Evaluation (RPE) in Teams, wobei insbesondere der Peer-Monitoring-Vorteil und der Commitment-Vorteil untersucht werden. Schließlich wird die Übertragbarkeit der theoretischen Erkenntnisse auf die Praxis diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Anreizgestaltung, Prinzipal-Agenten-Theorie, Teams, Joint Performance Evaluation (JPE), Relative Performance Evaluation (RPE), Peer-Monitoring, Commitment, Effizienz, Optimalität und Übertragbarkeit auf die Praxis.
- Citar trabajo
- Marvin Deka (Autor), 2016, Anreizgestaltung in Teams im Kontext der Prinzipal-Agenten-Theorie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/476899