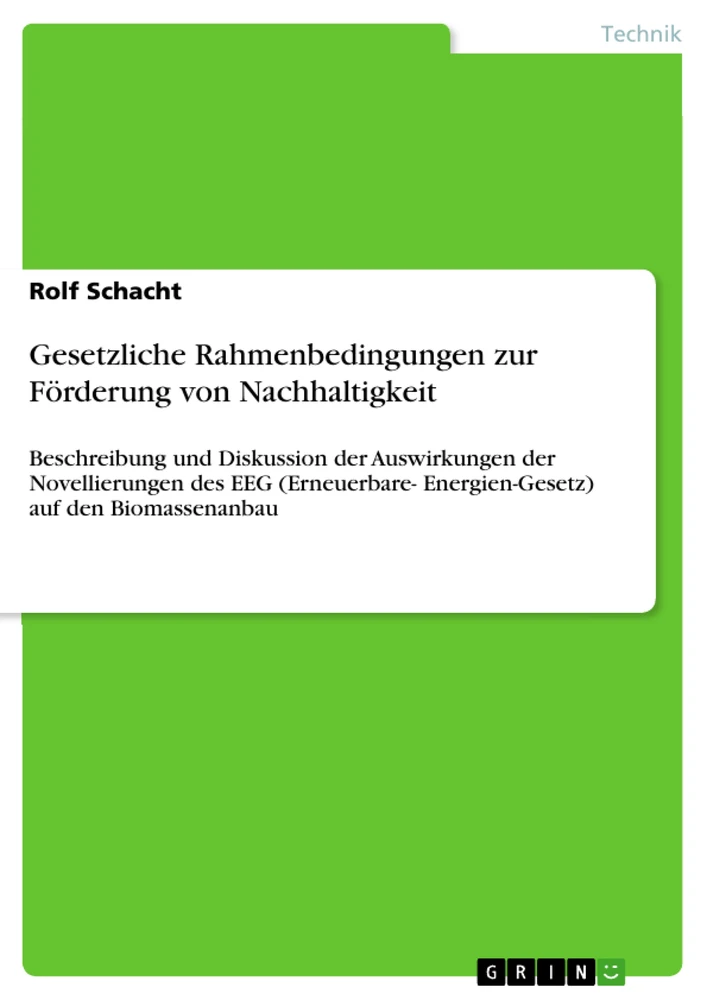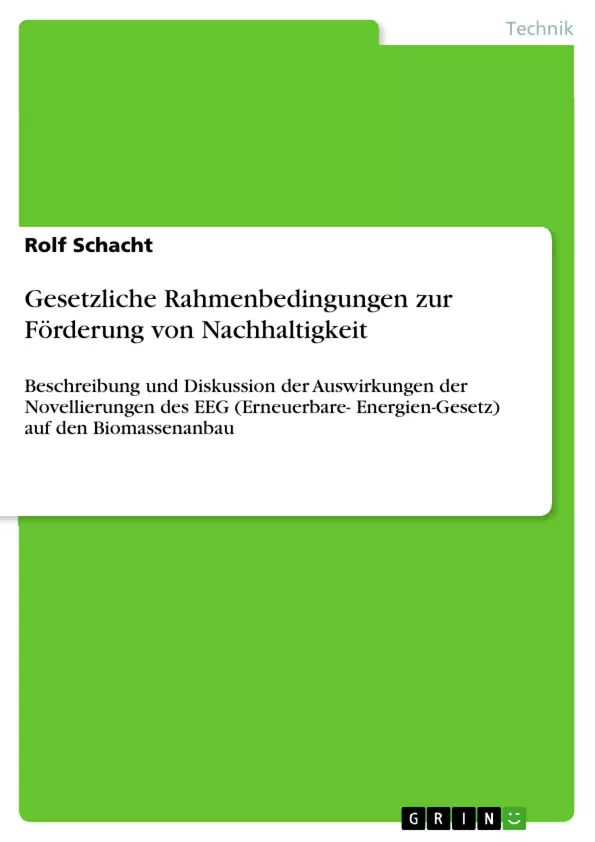11. März 2011, 14:46 Uhr Ortszeit Fukushima, zu diesem Zeitpunkt änderte sich die Entwicklung der Energiewende in Deutschland drastisch. Durch eine Reihe an katastrophalen Un- und Störfällen erreichte die Katastrophe im japanischen Kernkraftwerk Fukushima Daiichi die höchste Stufe sieben auf der INES-Skala . Die bereits etwa 1990 begonnene Energiewende in Deutschland, durch das Energieeinspeisungsgesetz, welches zu Beginn des Jahres 1991 in Kraft trat, wurde schneller und radikaler vorangetrieben. Seit 2000, mit Einführung des Erneuerbare-Energie-Gesetzes (EEG) und dessen Anpassungen in den Jahren 2004, 2009, 2012, 2014 und aktuell in 2016/2017, versucht die Bundesregierung die Wende in der Energiewirtschaft voranzutreiben. Bereits zwei Tage nach der Katastrophe wurden die sieben ältesten Kernkraftwerke in Deutschland vom Netz genommen, allein diese Tatsache zwingt die Energiewirtschaft und Politik zur Alternativenbildung um Versorgungsengpässe und -lücken zu vermeiden.
Der global kontinuierliche Anstieg des Energiebedarfes wird überwiegend aus fossilen und daraus resultierend endlichen Energieträgern gedeckt. Durch die Endlichkeit fossiler Brennstoffe und Energieträger, ist die Energieversorgung nur temporär gesichert und es müssen Alternativen entwickelt, vorangetrieben und gefördert werden. Die Energiewende ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten das meist diskutierte Thema in Politik und Gesellschaft. Die Folgen des Klimawandels werden Jahr für Jahr stärker wahrgenommen und auch die Gesellschaft fordert immer inständiger die Abkehr von alten überholten Energiegewinnungsmethoden.
„Alle Länder werden ihre Emissionen erheblich reduzieren müssen, um die Ziele des Pariser Abkommens zu verwirklichen. Welchen Pfad sie dorthin wählen, wird abhängen von länderspezifischen Faktoren, unter anderem ihrem Einkommensniveau, sein.“ In Deutschland versucht die Bundesregierung diese Klimaziele und den damit verbundenen Wandel durch die Durchsetzung des EEG voranzutreiben und zu fördern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichtlicher Abriss
- EEG Förderinstrument der Bioenergie
- Biomasseanlagen
- Halmartige Biomasse
- Flüssige Biomasse
- Holzartige Biomasse
- Umweltfolgen der Bioenergie
- Halmartige Biomasse
- Flüssige Biomasse
- Holzartige Biomasse
- Bioenergiedorf
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, einen historischen Überblick über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zu geben und die Auswirkungen seiner Novellierungen auf den Biomassenanbau in Deutschland zu beleuchten. Die Arbeit befasst sich insbesondere mit den Folgen der Gesetzesänderungen für die verschiedenen Arten von Biomasse und betrachtet dabei sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte.
- Entwicklung des EEG von 1991 bis 2017
- Auswirkungen der EEG-Novellierungen auf den Biomassenanbau
- Ökologische und ökonomische Folgen des Biomasse-Anbaus
- Analyse der unterschiedlichen Biomasse-Arten
- Das Konzept des Bioenergiedorfs
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema ein und beschreibt die Bedeutung des EEG für die Energiewende in Deutschland. Kapitel 2 beleuchtet die historische Entwicklung des EEG und die Motivationen für dessen Einführung. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den verschiedenen Arten von Biomasse, die im Rahmen des EEG gefördert werden, und deren Einsatzmöglichkeiten. Kapitel 4 analysiert die ökologischen Folgen des Biomasse-Anbaus und diskutiert die verschiedenen Perspektiven auf die Nachhaltigkeit der Bioenergiegewinnung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Erneuerbare Energien, Biomasse, EEG, Energiewende, Nachhaltigkeit, Umweltfolgen und Bioenergiedorf. Dabei werden die verschiedenen Biomasse-Arten, wie halmartige Biomasse, flüssige Biomasse und holzartige Biomasse, sowie die Herausforderungen und Chancen der Bioenergiegewinnung im Fokus betrachtet. Die Arbeit analysiert die Folgen des EEG für den Biomassenanbau und beleuchtet die Diskussion um die nachhaltige Energieversorgung in Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Welche Auswirkungen hatte die Katastrophe von Fukushima auf das EEG?
Fukushima führte 2011 zu einer radikalen Beschleunigung der Energiewende in Deutschland, einschließlich des sofortigen Atomausstiegs und häufigerer Novellierungen des EEG.
Was wird im Rahmen des EEG als Biomasse gefördert?
Gefördert wird die Stromerzeugung aus verschiedenen Arten von Biomasse, darunter halmartige (z.B. Stroh), flüssige (z.B. Gülle) und holzartige Biomasse.
Welche ökologischen Folgen hat der Biomasseanbau?
Neben der CO2-Einsparung gibt es Kritik an Monokulturen (Vermaisung), dem Einsatz von Düngemitteln und der Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion.
Was ist ein Bioenergiedorf?
Ein Bioenergiedorf deckt seinen Energiebedarf (Strom und Wärme) größtenteils durch lokal produzierte Biomasse und fördert so die regionale Nachhaltigkeit.
Wann trat das erste Energieeinspeisungsgesetz in Kraft?
Das ursprüngliche Gesetz trat bereits Anfang 1991 in Kraft und legte den Grundstein für die Förderung erneuerbarer Energien in Deutschland.
- Arbeit zitieren
- Rolf Schacht (Autor:in), 2018, Gesetzliche Rahmenbedingungen zur Förderung von Nachhaltigkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/477499