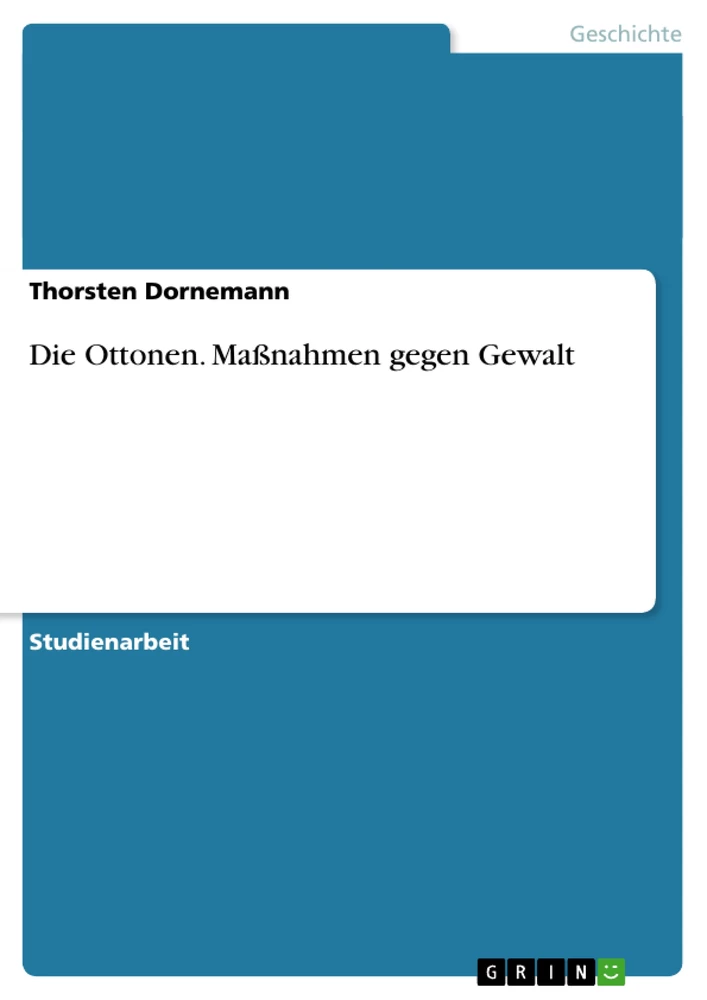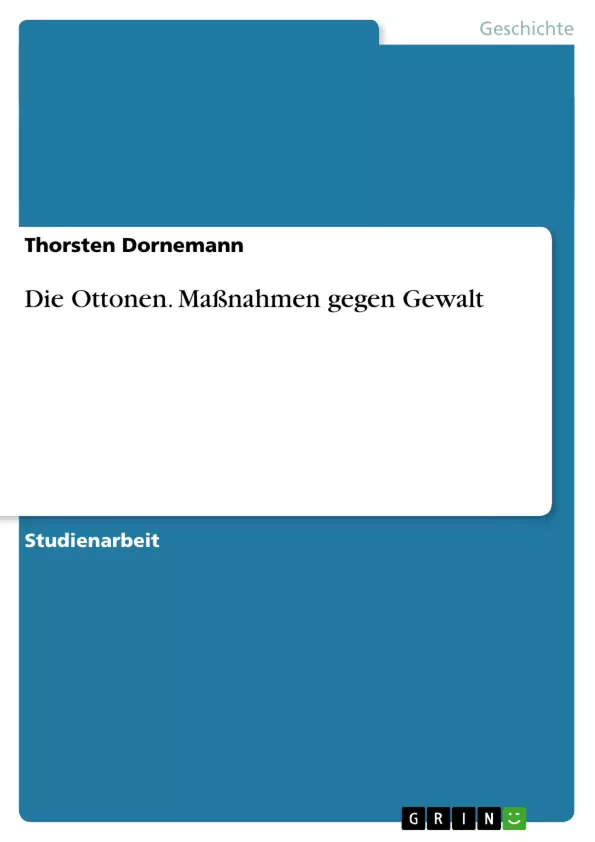Eine Regierung ist nur solange an der Macht, wie sie ihr Gewaltmonopol verteidigen und durchsetzen kann. Dies ist eine Regel, die zeitlos Bestand hat und ebenso für das Mittelalter zutrifft. In dieser Zeit ist ein König nur solange an der Macht, wie er allein in seinem Land das Gewaltmonopol besitzt und dieses auch durchzusetzen vermag. Dies galt bei der Machterlangung der Karolinger über die Merowinger, als auch bei dem Verlust der Königswürde der Karolinger an das Geschlecht der Ottonen. Dass ein Wechsel des Königsgeschlechts zumindest anfänglich ein Legitimationsproblem darstellt, sollte unbestritten sein, da die neuen Herrscher, wie in diesem Fall, nicht aus dem ehemaligen Königsgeschlecht stammen und sich somit nicht auf eine Königstradition berufen können. Zudem schaffen Übernahmen Begehrlichkeiten von anderen Großen des Reiches wie z.B. den Herzögen. So muss eine neue Machtbalance zwischen dem neuen Königsgeschlecht und den Großen gefunden werden. Bei den Ottonen ist zu erkennen, dass sie, um diese Balance zu finden, empfindliche Zugeständnisse dem Adel gegenüber machen mussten. An dieser Stelle sei an die Erbbarkeit von Lehen und an den Verlust der Königsboten, die den Willen des Königs durchsetzten, erinnert. Dennoch erreichte das Ostfränkische Reich eine Stabilität, im Gegensatz zum Westfränkischen Reich, die als ziemlich ungewöhnlich zu bezeichnen ist.
Das Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen, ob es bei den Ottonen Maßnahmen gab Gewalt einzudämmen. Dabei beschränkt sich die Arbeit auf die Beschreibung der Maßnahmen. Ihre Beurteilung und Auswertung kann nicht durchgeführt werden; dies würde den Rahmen der Arbeit sprengen.
Der Aufbau der Arbeit gestaltet sich wie folgt: In den Kapiteln zwei bis vier soll anhand von Quellen nachgewiesen werden, welche herrschaftliche Funktion die Ottonen ausführten und einsetzten um Frieden, zum Beispiel durch Freundschaftsschwüre, zu wahren und Gewalt, wie zum Beispiel Fehden, zu unterbinden. In den Kapiteln fünf und sechs werden konkrete Maßnahmen gegen Gewalt geschildert und beleuchtet. Auch wird anhand der Quellen untersucht, welche Aufgaben und Intentionen die einzelnen Protagonisten, zum Beispiel Heinrich II. und Burkhard von Worms, für ihr Vorgehen hatten. Das Fazit fast die wesentlichen Aussagen der Arbeit noch einmal zusammen und bewertet diese.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- AMICITIAE
- Freundschaft zwischen Heinrich I. und König Karl dem Einfältigen
- Amicitiae zwischen Heinrich von Sachsen und den Grossen
- HERRSCHERLICHE FRIEDENSWAHRUNG
- Königsschutz
- Friedensbann
- Landfrieden
- HOFTAGE ODER DIE INSTITUTION DER BERATUNG
- DER WELTLICHE LEITFADEN DES BURCHARD VON WORMS
- GRUNDHERRSCHAFT UNTER HEINRICH DEM II
- Die Urkunde über die Streitigkeiten zwischen der bischöflichen Kirche von Worms und der Abtei Lorsch
- Die Urkunde über die Streitigkeiten zwischen dem Kloster Fulda und dem Kloster Hersfeld
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Maßnahmen zur Eindämmung von Gewalt im Reich der Ottonen, ohne diese zu bewerten oder auszuwerten. Sie konzentriert sich auf die Beschreibung der Maßnahmen und beleuchtet dabei den Einfluss der Ottonen auf die Friedenssicherung und Gewaltbegrenzung im damaligen Kontext.
- Die Rolle der "amicitiae" (Freundschaft) im Aufbau einer neuen Machtbalance und Friedenssicherung
- Die Rolle des Königs im Schutz und der Friedenssicherung
- Die Bedeutung von Hoftagen als Plattform der Beratung und Konfliktlösung
- Der Einfluss von Persönlichkeiten wie Burkhard von Worms und Heinrich II. auf die Maßnahmen gegen Gewalt
- Die Rolle von Urkunden in der Dokumentation und Durchsetzung von Maßnahmen gegen Gewalt
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel beleuchtet die Bedeutung von "amicitiae" (Freundschaft) im Herrscherbild der Ottonen und untersucht die Inhalte und Verpflichtungen, die mit dieser Freundschaft verbunden waren. Anhand der "Bonner Verträge" wird die Freundschaft zwischen Heinrich I. und König Karl dem Einfältigen von Frankreich analysiert.
Das dritte Kapitel beleuchtet die herrschaftliche Friedenswahrung durch die Ottonen. Es analysiert die Funktionen von Königsschutz, Friedensbann und Landfrieden als Instrumente zur Unterbindung von Gewalt.
Kapitel vier beschäftigt sich mit der Institution der Beratung am Hof und deren Bedeutung in der Konfliktlösung und Friedenssicherung.
Kapitel fünf widmet sich dem weltlichen Leitfaden von Burkhard von Worms und analysiert dessen Einfluss auf die Maßnahmen gegen Gewalt.
Kapitel sechs untersucht die Grundherrschaft unter Heinrich II. anhand von zwei Urkunden: Die erste Urkunde behandelt die Streitigkeiten zwischen der bischöflichen Kirche von Worms und der Abtei Lorsch, die zweite Urkunde beleuchtet die Streitigkeiten zwischen den Klöstern Fulda und Hersfeld.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Gewalt, Frieden, Freundschaft ("amicitiae"), Herrschaft, Königsschutz, Friedensbann, Landfrieden, Hoftage, Beratung, Burkhard von Worms, Heinrich II., Urkunden, Streitigkeiten, Kloster, Kirche.
Häufig gestellte Fragen
Welche Maßnahmen ergriffen die Ottonen zur Friedenssicherung?
Zu den Instrumenten gehörten Freundschaftsschwüre (amicitiae), der Königsschutz, der Friedensbann und die Institution der Hoftage zur Beratung.
Was bedeutete "amicitiae" im mittelalterlichen Herrschaftssystem?
Es handelte sich um formale Freundschaftsbündnisse, wie zwischen Heinrich I. und Karl dem Einfältigen, die zur Stabilisierung der Machtbalance dienten.
Welche Rolle spielte Burchard von Worms bei der Gewaltprävention?
Burchard von Worms verfasste einen weltlichen Leitfaden, der als rechtliche und moralische Orientierung zur Eindämmung von Gewalt und Fehden diente.
Wie wurden Konflikte zwischen Klöstern und Kirchen gelöst?
Anhand von Urkunden, wie unter Heinrich II., wurden Streitigkeiten (z.B. zwischen Worms und Lorsch) dokumentiert und rechtlich beigelegt.
Warum hatten die Ottonen anfangs ein Legitimationsproblem?
Da sie nicht aus dem vorherigen Königsgeschlecht der Karolinger stammten, mussten sie ihre Herrschaft durch Bündnisse und Zugeständnisse an den Adel neu festigen.
- Citation du texte
- Thorsten Dornemann (Auteur), 2004, Die Ottonen. Maßnahmen gegen Gewalt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47805