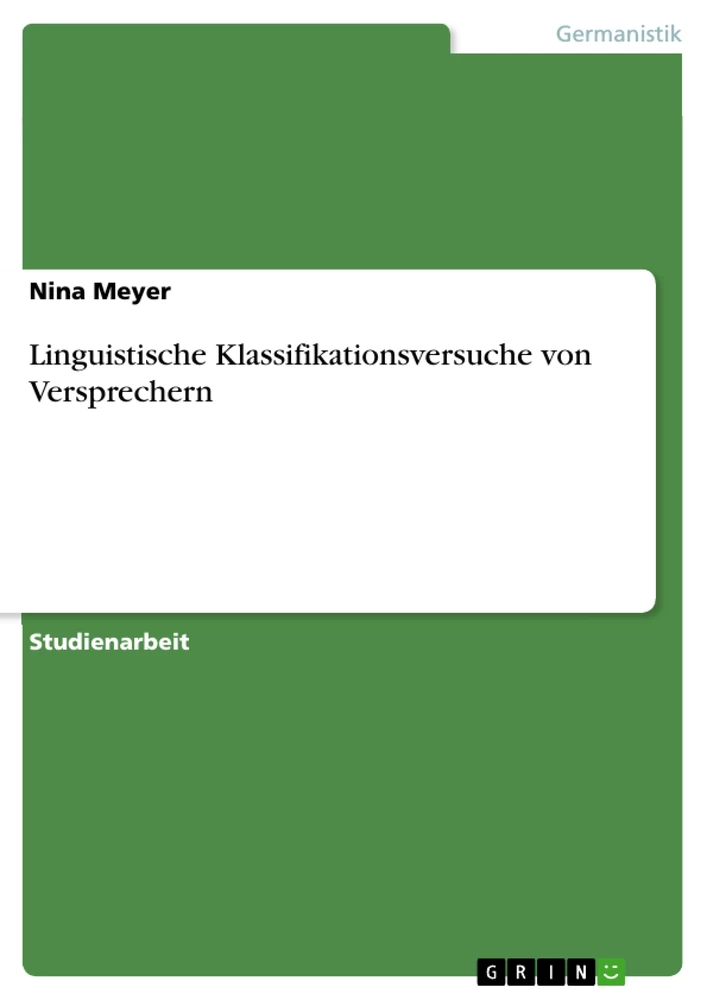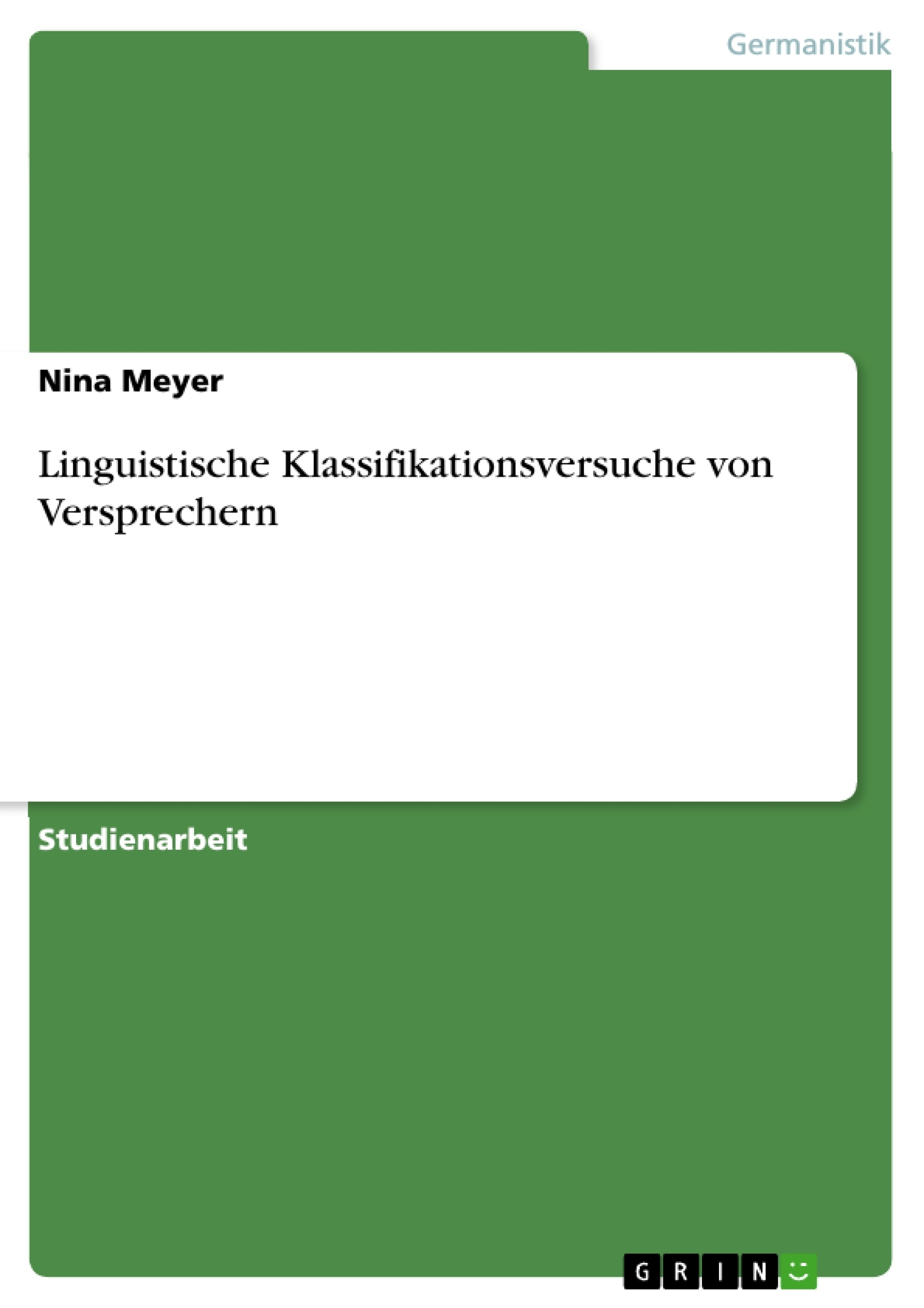Äußert jemand 'Sie hat mir Honig in die Augen geschmiert', bestellt eine Person eine Pischelmuzza oder putzt gar der 'Kralli', so verbreitet sich bei den Rezipienten solcher Versprecher allgemeine Heiterkeit. Die Schöpferkraft der Sprache scheint sich bei Sprechfehlern einen Augenblick über die konventionellen Sprachregeln hinwegzusetzen.
Bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts beschäftigt sich eine Reihe von Linguisten mit dem Phänomen der Versprecher, wie sie im Sprachzentrum unseres Gehirns zustande kommen und welche Hinweise sie z.B. über den Aufbau des mentalen Lexikons liefern. In dieser Arbeit werden in Kapitel 1 zunächst allgemeine Fakten zu den Versprechern vorgestellt. Darauf folgend wird auf Schwierigkeiten bei der wissenschaftlichen Analyse und Interpretation von Versprechersammlungen hingewiesen. Kapitel 3 beschreibt kurz Rudolf Meringers Kategorisierung von Versprechern. Dies dient als Grundlage für das folgende Kapitel in dem Nora Wiedenmanns Klassifikation von Sprechfehlern dargestellt wird. Kapitel 5 geht, bezogen auf die Versprecherforschung, zum einen auf einige linguistische Erkenntnisse ein, die Wiedenmann aus ihren Versprechersammlungen ableitet und zum anderen auf linguistische Erkenntnisse bezogen auf den Aufbau des mentalen Lexikons.
Diese Hausarbeit bezieht sich in erster Linie auf Nora Wiedenmanns Ausführungen in „Versprecher: Phänomene und Daten.“, sowie Helen Leuningers Werk „Reden ist Schweigen, Silber ist Gold.“ Für weitere verwendete Literatur verweise ich auf das Literaturverzeichnis.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeine Fakten zu Versprechern
- Schwierigkeiten bei der wissenschaftlichen Analyse und Interpretation von Versprechersammlungen
- Meringers Klassifikation der Versprecher
- Vertauschung
- Antizipationen
- Postpositionen
- Kontamination
- Substitution
- Nora Wiedenmanns Klassifikation der Versprecher
- Versprecher oberhalb der Lautebene
- Assoziative Versprecher
- Perzeptiv induzierte Versprecher
- Versprecher auf der Lautebene
- Antizipatorischer Versprecher
- (Reine) Antizipation
- Metathese und Mehrfachvertauschung
- Shift in zwei Varianten
- Repetitorische Versprecher
- Antizipatorischer Versprecher
- Versprecher oberhalb der Lautebene
- Linguistische Erkenntnisse durch die Versprecherforschung
- Nora Wiedemanns linguistische Erkenntnisse
- Affrikaten und Diphthonge
- Freudsche Versprecher
- Linguistische Erkenntnisse bezogen auf das mentale Lexikon
- Die Organisation des mentalen Lexikons nach Bedeutungskriterien
- Das mentale Lexikon als ein nach Formkriterien organisiertes Gebilde
- Wortarten
- Wortteilchen - Die innere Struktur der Wörter
- Nora Wiedemanns linguistische Erkenntnisse
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Versprecher, basierend auf den Arbeiten von Helen Leuniger und Nora Wiedenmann. Ziel ist es, einen Überblick über verschiedene Klassifikationen von Versprechern zu geben und die linguistischen Erkenntnisse zu beleuchten, die sich aus der Versprecherforschung, insbesondere im Hinblick auf die Organisation des mentalen Lexikons, ableiten lassen.
- Klassifizierung von Versprechern nach Meringer und Wiedenmann
- Analyse der linguistischen Implikationen von Versprechern
- Der Einfluss von Versprechern auf das Verständnis des mentalen Lexikons
- Untersuchung der Bedingungen, unter denen Versprecher auftreten
- Die Rolle von Aufmerksamkeit und Konzentration bei der Entstehung von Sprechfehlern
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Versprecher ein und beschreibt die allgemeine Heiterkeit, die diese Sprechfehler oft hervorrufen. Sie skizziert die Forschungsgeschichte und den Fokus der Arbeit, der auf den Klassifikationen von Meringer und Wiedenmann sowie den daraus abzuleitenden linguistischen Erkenntnissen liegt. Die Arbeit konzentriert sich primär auf die Werke von Nora Wiedenmann und Helen Leuniger.
Allgemeine Fakten zu Versprechern: Dieses Kapitel beleuchtet die Natur von Versprechern als alltäglichen Bestandteil des Sprechens, entgegen der Intention des Sprechers. Es wird betont, dass Versprecher unabhängig von der Komplexität des gesprochenen Materials auftreten können und verschiedene sprachliche Ebenen betreffen. Der begrenzte Kapazität des Arbeitsspeichers wird als Erklärung für die Lokalisierung von Versprechern innerhalb von Sätzen angeführt. Die Ausführungen basieren auf Beobachtungen von Helen Leuninger, die Zusammenhänge zwischen Konzentration, Entspannung und der Häufigkeit von Versprechern beschreibt. Auch der Einfluss von phonetischer Ähnlichkeit (z.B. bei Wörtern mit gleichen Anlauten) auf die Entstehung von Versprechern wird diskutiert.
Schwierigkeiten bei der wissenschaftlichen Analyse und Interpretation von Versprechersammlungen: (Diese Zusammenfassung wurde ausgelassen, da der Text hierfür keine ausreichenden Informationen liefert.)
Meringers Klassifikation der Versprecher: Dieses Kapitel bietet eine kurze Darstellung von Rudolf Meringers Klassifizierung von Versprechern. Obwohl der Text hier nur eine kurze Beschreibung liefert, dient diese als Grundlage für das Verständnis der detaillierteren Klassifikation von Nora Wiedenmann, die in einem späteren Kapitel behandelt wird. Die fehlende Detaillierung in diesem Abschnitt verdeutlicht die Bedeutung der folgenden Kapitel, die eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Thema bieten.
Nora Wiedenmanns Klassifikation der Versprecher: Dieses Kapitel beschreibt die Klassifikation von Sprechfehlern nach Nora Wiedenmann, differenziert nach Ebenen oberhalb und auf der Lautebene. Die Klassifizierung oberhalb der Lautebene umfasst assoziative und perzeptiv induzierte Versprecher. Die Klassifizierung auf der Lautebene beinhaltet antizipatorische Versprecher (mit Unterkategorien wie reine Antizipation, Metathese und Shift) sowie repetitorische Versprecher. Diese differenzierte Betrachtungsweise ermöglicht eine detaillierte Analyse der verschiedenen Mechanismen, die zu Sprechfehlern führen.
Linguistische Erkenntnisse durch die Versprecherforschung: Dieses Kapitel behandelt linguistische Erkenntnisse, die aus der Versprecherforschung, speziell der von Nora Wiedenmann, gewonnen werden konnten. Es beleuchtet den Beitrag der Versprecherforschung zum Verständnis des mentalen Lexikons und seiner Organisation nach Bedeutungs- und Formkriterien. Die Analyse umfasst Aspekte wie die Rolle von Wortarten und Wortteilchen und liefert Einblicke in die innere Struktur von Wörtern. Die Diskussion um Freudsche Versprecher wird ebenfalls angesprochen, jedoch ohne nähere Detaillierung im vorliegenden Text-Auszug.
Schlüsselwörter
Versprecher, Sprechfehler, mentales Lexikon, Sprachproduktion, Linguistik, Klassifikation, Meringer, Wiedenmann, Wortarten, Lautebene, Bedeutungskriterien, Formkriterien, Antizipation, Substitution.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Versprechern nach Meringer und Wiedenmann
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Phänomen der Versprecher, basierend auf den Forschungsarbeiten von Helen Leuniger und insbesondere Nora Wiedenmann. Der Fokus liegt auf der Klassifizierung von Versprechern und den daraus abzuleitenden linguistischen Erkenntnissen, vor allem im Hinblick auf die Organisation des mentalen Lexikons.
Welche Klassifikationen von Versprechern werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Klassifikationen von Versprechern nach Rudolf Meringer und Nora Wiedenmann. Meringers Klassifikation wird kurz vorgestellt, während Wiedenmanns System detaillierter erläutert wird. Wiedenmanns System unterscheidet zwischen Versprechern oberhalb und auf der Lautebene, mit verschiedenen Unterkategorien wie Antizipationen, Substitutionen und Repetitionen.
Wie ist Wiedenmanns Klassifikation aufgebaut?
Wiedenmanns Klassifikation gliedert Versprecher in zwei Hauptypen: Versprecher oberhalb der Lautebene (assoziative und perzeptiv induzierte Versprecher) und Versprecher auf der Lautebene. Letztere beinhalten antizipatorische Versprecher (mit Unterkategorien wie reine Antizipation, Metathese und Shift) und repetitorische Versprecher. Diese differenzierte Einteilung ermöglicht eine detaillierte Analyse der Mechanismen, die zu Sprechfehlern führen.
Welche linguistischen Erkenntnisse werden aus der Versprecherforschung gewonnen?
Die Analyse von Versprechern liefert Erkenntnisse über die Organisation des mentalen Lexikons. Die Arbeit untersucht die Organisation des Lexikons nach Bedeutungs- und Formkriterien, einschließlich der Rolle von Wortarten und Wortteilchen. Es wird auch der Einfluss von phonetischer Ähnlichkeit auf die Entstehung von Versprechern diskutiert. Freudsche Versprecher werden erwähnt, jedoch ohne detaillierte Betrachtung im vorliegenden Text-Auszug.
Welche Themen werden in den einzelnen Kapiteln behandelt?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu einer Einleitung, allgemeinen Fakten zu Versprechern, Schwierigkeiten bei der Analyse von Versprechersammlungen, Meringers Klassifikation, Wiedenmanns Klassifikation und den daraus resultierenden linguistischen Erkenntnissen, sowie einer Zusammenfassung. Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Fokus der Arbeit. Die Kapitel zu den Klassifikationen bieten detaillierte Beschreibungen der jeweiligen Systeme. Das Kapitel zu den linguistischen Erkenntnissen beleuchtet den Beitrag der Versprecherforschung zum Verständnis des mentalen Lexikons.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Versprecher, Sprechfehler, mentales Lexikon, Sprachproduktion, Linguistik, Klassifikation, Meringer, Wiedenmann, Wortarten, Lautebene, Bedeutungskriterien, Formkriterien, Antizipation, Substitution.
Welche Rolle spielt das mentale Lexikon in dieser Analyse?
Das mentale Lexikon steht im Zentrum der linguistischen Analyse. Die Arbeit untersucht, wie die Analyse von Versprechern Aufschluss über die Organisation und den Aufbau des mentalen Lexikons geben kann, sowohl hinsichtlich der Bedeutung als auch der formalen Aspekte wie Wortarten und Wortteile.
Wer sind die wichtigsten Forscher, die in dieser Arbeit behandelt werden?
Die wichtigsten Forscher sind Rudolf Meringer und Nora Wiedenmann, deren Klassifikationen von Versprechern im Detail analysiert werden. Zusätzlich wird die Arbeit von Helen Leuniger erwähnt, die Beobachtungen zu den Bedingungen der Entstehung von Versprechern liefert.
- Citation du texte
- Nina Meyer (Auteur), 2005, Linguistische Klassifikationsversuche von Versprechern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47812