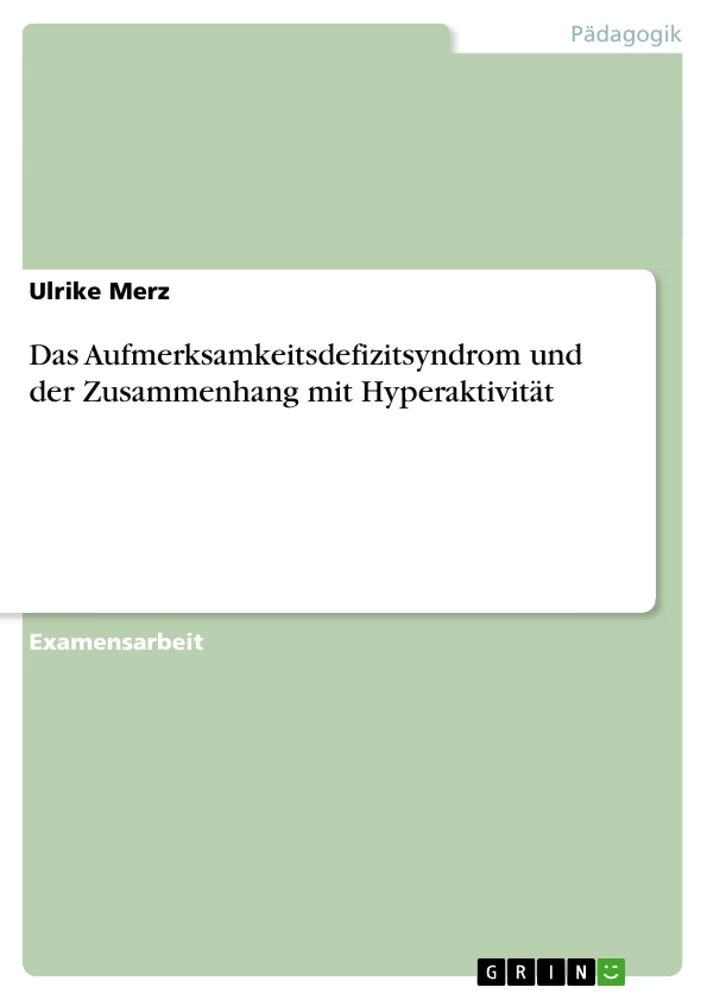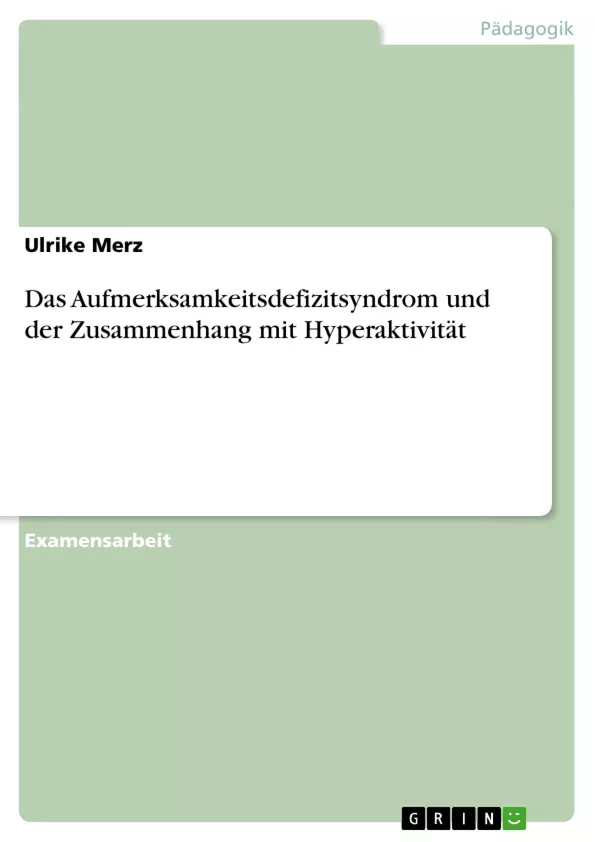Betrachtet man in den letzten Jahren die Veröffentlichungen zum Thema des Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms beziehungsweise der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, welche ich im Folgenden durch die Bezeichnung AD(H)S abkürzen werde, stellt man fest, dass neben der entsprechenden Fachliteratur jedes Jahr eine Flut von 'Elternratgebern' neu erscheint. Durch diesen vielfältigen Zuwachs an neuen Büchern, aber auch immer wieder erscheinenden Artikeln in der Zeitung, wird deutlich, wie stark über AD(H)S und die damit verbundenen Probleme in der Öffentlichkeit diskutiert wird.
Hinzu kommt, dass AD(H)S heutzutage eine der am häufigsten diagnostizierten Verhaltensstörungen im Kindes- und Jugendalter darstellt, die die Entwicklung der Kinder in Bezug auf das soziale Umfeld und im Hinblick auf die schulische Laufbahn beeinflusst.
Immer mehr Eltern und Lehrer bzw. Erzieher haben Probleme mit den oftmals sehr anstrengenden Kindern und suchen Hilfe bei Ärzten oder Psychologen. Vor allem in der Schule werden in immer mehr Fällen Verhaltensstörungen bei Kindern festgestellt, die die Situation im Klassenverband und somit auch die Lernvoraussetzungen schwieriger gestalten. Dies ist mir sowohl während meiner studiumsbegleitenden Praktika als auch bei verschiedenen Hospitationen in der Schule aufgefallen. Im Hinblick auf diese Veränderungen finde ich es wichtig eine Unterscheidung zu treffen, welche Faktoren für die Verhaltensauffälligkeiten maßgebend sind, da sich in Bezug auf die gehäufte Erscheinung von 'Problemkindern' die Frage stellt, inwiefern die heutigen Gesellschaftsformen und die damit verbundenen Lebensweisen einen Einfluss auf die Zunahme dieser Kinder haben.
In den letzten Jahren lässt sich unter anderem eine Auflösung traditioneller Gesellschaftsformen, in denen stabile Lebensmuster, wie Ehe, Familie oder beispielsweise auch die Berufstätigkeit eine Rolle gespielt haben, beobachten. Stattdessen besteht eine immer größere Forderung nach Mobilität und eine Zunahme an verschiedenen Lebensformen (Pluralität), so dass unsere Gesellschaft heute durch eine Vielzahl verschiedener Verhaltensweisen geprägt ist. Aufgrund dessen sind uns viele der Symptome einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung mittlerweile sehr geläufig. Möchte man den Begriff AD(H)S allerdings von den gesellschaftlichen Veränderungen abgrenzen und ihm so eine spezifische Bedeutung geben, muss das Krankheitsbild sorgfältig analysiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit und ohne Hyperaktivität – Übersicht über den aktuellen Wissensstand und die Einordnung bisheriger Untersuchungen
- 3. Erscheinungsbild der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
- 3.1 Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom in Verbindung mit Hyperaktivität
- 3.1.1 Aufmerksamkeitsstörungen
- 3.1.2 Hyperaktivität
- 3.1.3 Impulsivität
- 3.2 Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ohne Hyperaktivität (ADS)
- 3.3 Positive Eigenschaften von aufmerksamkeitsgestörten und hyperaktiven Kindern
- 3.4 Komorbide Begleiterscheinungen
- 3.4.1 Soziale Schwierigkeiten
- 3.4.1.1 Soziale Störungen ohne oppositionelle Verhaltensweisen
- 3.4.1.2 Oppositionelle Verhaltensweisen
- 3.4.2 Depressive Störungen
- 3.4.3 Angststörungen
- 3.4.4 Lernstörungen/Teilleistungsstörungen
- 3.4.5 Tic-Störungen
- 3.4.1 Soziale Schwierigkeiten
- 3.5 Verlauf der Krankheit
- 3.5.1 Säuglingsalter – Kleinkindalter
- 3.5.2 Vorschulalter
- 3.5.3 Grundschulalter
- 3.5.4 Jugendalter
- 3.5.5 Erwachsenalter
- 3.1 Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom in Verbindung mit Hyperaktivität
- 4. Ursachen der AD(H)S - Entstehung und Entwicklung der Krankheit
- 4.1 Psychosoziale Belastungen und Einfluss von Umweltbedingungen
- 4.2 Biologische Ursachen der AD(H)S
- 4.2.1 Neurochemische Befunde
- 4.2.2 Neurophysiologische und neuroanatomische Befunde
- 4.2.3 Neuropsychologische Befunde
- 4.2.4 Psychogenetische Befunde
- 4.3 Nahrungsmittelallergien als Ursache für die Entstehung einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
- 4.4 Gehirnschädigung bzw. eine verlangsamte Entwicklung einer oder mehrerer Bereiche des Gehirns
- 5. Verbreitung und Diagnose des Syndroms
- 5.1 Prävalenz der Krankheit
- 5.2 Diagnosekriterien
- 5.2.1 Diagnosekriterien nach der „International Classification of Diseases\" (ICD-10)
- 5.2.2 Diagnosekriterien des 'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders' (DSM-IV)
- 5.3 Anamnese
- 5.4 Testpsychologische Untersuchungen
- 5.5 Körperliche und neurologische Untersuchungen
- 5.6 Apparative Zusatzbefunde
- 6. Therapiemöglichkeiten
- 6.1 Medikamentöse Therapie
- 6.2 Psychotherapeutische Verfahren
- 6.2.1 Verhaltenstraining
- 6.2.1.1 Verhaltensmodifikation
- 6.2.1.2 Die Marburger Trainings
- 6.2.2 Selbstinduktionstraining
- 6.2.3 Familienzentrierte Maßnahmen
- 6.2.1 Verhaltenstraining
- 6.3 Alternative Therapiemöglichkeiten
- 6.3.1 Entspannungsverfahren
- 6.3.2 Psychomotorische Arbeit mit hyperaktiven Kindern
- 6.3.3 Therapeutisches Reiten
- 6.3.4 Oligoantigene Diät
- 7. Aufmerksamkeitsgestörte, hyperaktive Kinder und Jugendliche
- 7.1 AD(H)S im Unterricht
- 7.2 meine persönliche Erfahrungen mit verhaltensauffälligen Kindern
- 7.2.1 Jens
- 7.2.2 Phillip
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit und ohne Hyperaktivität (AD(H)S), einer neurobiologischen Entwicklungsstörung. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über den aktuellen Wissensstand zum Thema AD(H)S zu geben, die Symptome, Ursachen, Diagnose und Therapiemöglichkeiten zu beleuchten. Die Arbeit analysiert auch die Auswirkungen von AD(H)S auf den Alltag von betroffenen Kindern und Jugendlichen, insbesondere im schulischen Kontext.
- Erscheinungsbild und Diagnostik von AD(H)S
- Ursachen und Einflussfaktoren von AD(H)S
- Therapiemöglichkeiten bei AD(H)S
- AD(H)S im schulischen Kontext und die Herausforderungen für Lehrkräfte
- Persönliche Erfahrungen mit verhaltensauffälligen Kindern im Schulalltag
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema AD(H)S ein und skizziert die Relevanz des Themas. Das zweite Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Wissensstandes über AD(H)S. Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Erscheinungsbild der AD(H)S, beschreibt die Symptome und die komorbiden Begleiterscheinungen. Kapitel vier beleuchtet die Ursachen und die Entwicklung der Krankheit, unterteilt in psychosoziale, biologische, neuropsychologische und psychogenetische Einflussfaktoren. Das fünfte Kapitel befasst sich mit Verbreitung und Diagnose des Syndroms, inklusive Prävalenz und den Diagnosekriterien der ICD-10 und DSM-IV. Kapitel sechs präsentiert die Therapiemöglichkeiten, unterteilt in medikamentöse und psychotherapeutische Ansätze. Das siebte Kapitel widmet sich dem Leben mit AD(H)S im schulischen Kontext und den Herausforderungen für Lehrkräfte. Die persönlichen Erfahrungen der Autorin mit verhaltensauffälligen Kindern im Schulalltag runden den Überblick ab.
Schlüsselwörter
Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Hyperaktivität, Impulsivität, Diagnosekriterien, ICD-10, DSM-IV, Therapiemöglichkeiten, medikamentöse Therapie, psychotherapeutische Verfahren, Verhaltenstraining, AD(H)S im Unterricht, schulische Integration, Lernstörungen, komorbide Störungen, neurobiologische Entwicklungsstörung.
Häufig gestellte Fragen zu AD(H)S
Was ist der Unterschied zwischen ADS und ADHS?
ADHS beinhaltet das Symptom der Hyperaktivität, während ADS (Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom) ohne diese körperliche Unruhe auftritt.
Welche biologischen Ursachen hat AD(H)S?
Es gibt neurochemische Befunde (Störungen im Botenstoffhaushalt), neuroanatomische Veränderungen im Gehirn sowie psychogenetische Faktoren.
Wie wird AD(H)S professionell diagnostiziert?
Die Diagnose erfolgt nach Kriterien der ICD-10 oder des DSM-IV durch Anamnese, testpsychologische Untersuchungen und körperliche Checks.
Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?
Es wird zwischen medikamentöser Therapie, Verhaltenstraining (z.B. Marburger Training) und alternativen Methoden wie therapeutischem Reiten unterschieden.
Haben betroffene Kinder auch positive Eigenschaften?
Ja, die Arbeit hebt hervor, dass aufmerksamkeitsgestörte und hyperaktive Kinder oft sehr kreativ, hilfsbereit und begeisterungsfähig sein können.
- Quote paper
- Ulrike Merz (Author), 2004, Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und der Zusammenhang mit Hyperaktivität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47862