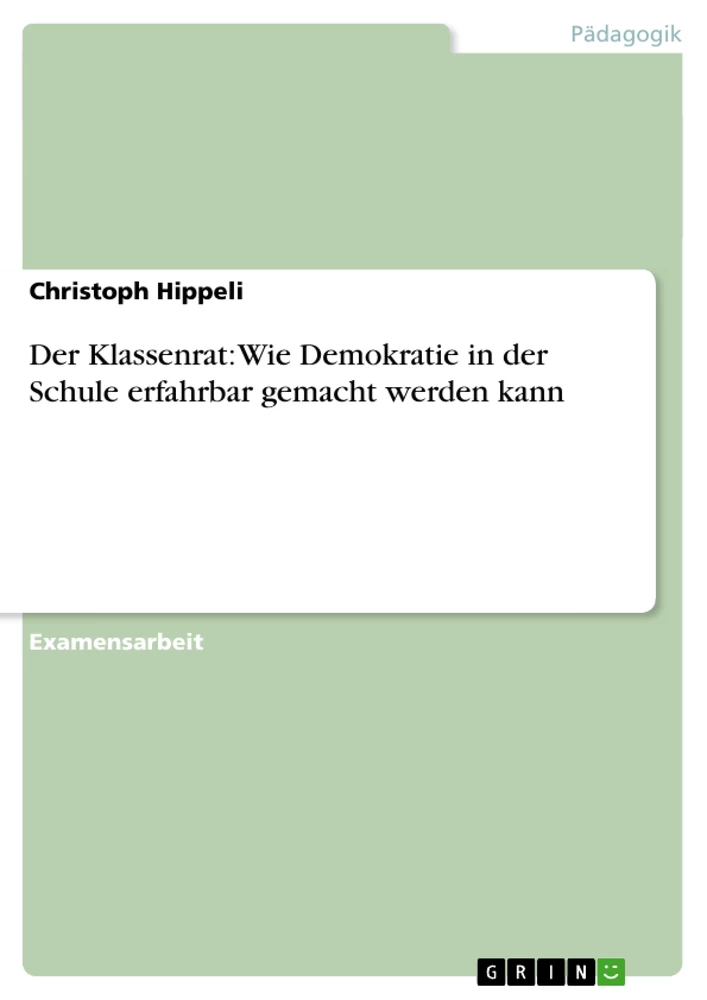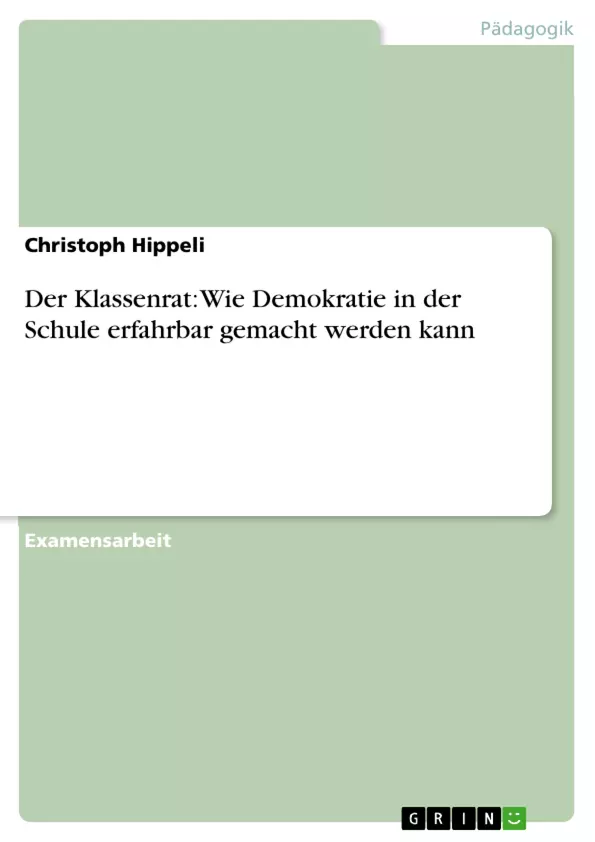Heute gibt es kaum einen Bereich, in dem solche Forderungen nicht gestellt werden. Seien es die Arbeiter in Betrieben, die Beamten oder die Angestellten des öffentlichen Dienstes, die Studenten an den Universitäten und Hochschulen oder gar die Bundeswehr und die Kirchen - zwei Institutionen, bei denen lange Zeit überhaupt nicht an Demokratisierung zu denken war. Überall dort wird mittlerweile verstärkt demokratische Mitbestimmung und aktive Teilhabe gefordert, teilweise auch schon praktiziert. Daher war es nur eine logische Folge, dass sich diese Entwicklung auch in einer der wichtigsten Institutionen unserer Gesellschaft zeigen musste: in der Schule.
In den meisten Verfassungen der Bundesländer ist den Schulen neben der Vermittlung von Bildung und fachlichem Wissen vorgeschrieben, „die Schüler im Geiste der Menschlichkeit, der Demokratie und der Freiheit zu erziehen und sie zu politisch bewussten und mündigen Staatsbürgern heranzubilden.“
Mehr und mehr setzt sich aber die Erkenntnis durch, dass unsere Schulen in ihren bislang eher autoritären Ausgestaltungen wohl kaum geeignet sind, derartige Ziele zu verwirklichen. Die Erziehung der Kinder und Jugendlichen kann nicht in einem System stattfinden, das nach dem Über- und Unterordnungsverhältnis aufgebaut ist. Denn dann kann man nicht erwarten, einen in demokratischen Denkweisen geschulten Staatsbürger vor sich zu haben, der zudem noch von der Idee der Demokratie überzeugt ist und diese auch lebt. Daher gilt es, die Grundlagen der Demokratie nicht nur theoretisch im Unterricht zu vermitteln, sondern dem Lernenden diese Idee praktisch, nämlich in der Schule, nahe zu bringen.
Aber ist die Schule dazu in der Lage? Lässt die Institution Schule Demokratie zu? Inwieweit ist die Institution Schule an sich demokratisch organisiert? Welche Möglichkeit der Mitgestaltung, der Partizipation haben Schüler? Wie kann Demokratielernen in der Schule aussehen?
Ziel dieser Arbeit ist es, Antworten auf diese Fragen zu suchen und sowohl theoretische Grundlagen als auch Möglichkeiten zur praktischen Umsetzung der anfänglich formulierten Forderungen aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Demokratie – eine Definition
- II. Demokratie und Schule
- 1. Schule als demokratische Institution?
- 2. Demokratie als Bildungsziel
- III. Ideengeschichtliche Entwicklung und theoretische Modelle der Demokratieerziehung sowie deren praktische Umsetzung
- 1. Ideengeschichte und theoretische Modelle
- 1.1. Die reformpädagogische Bewegung
- 1.2. Die konstruktivistische Pädagogik
- 1.3. John Dewey - Erziehung und Demokratie
- 1.4. Celestine Freinet - Demokratie in der Schule
- 2. Praktische Umsetzung der Theorie
- 2.1. „Herkömmliche“ Partizipationsformen
- 2.2. „Aktuelle“ Partizipationsformen
- 1. Ideengeschichte und theoretische Modelle
- IV. Der Klassenrat - Theorie
- 1. Der Klassenrat und seine Konzeptionen
- 1.1. Die Klassenversammlung nach Freinet
- 1.2. Der Klassenrat - ein individualpsychologischer Ansatz
- 2. Skizzierung eines möglichen Ablaufs
- 1. Der Klassenrat und seine Konzeptionen
- V. Der Klassenrat - Praxis
- 1. Die Adalbert-Stifter-Grundschule in Würzburg (ASV)
- 1.1. Administrativ-soziographische Gegebenheiten
- 1.2. Schulspezifische Aspekte der ASV Friedrichstraße
- 1.2.1. Räumliche Gegebenheiten
- 1.2.2. Organisation des Schullebens
- 1.2.3. Die Klasse 3a
- 2. Der Klassenrat in der Klasse 3a
- 2.1. Warum Klassenrat in der 3a?
- 2.2. Anbahnung und Entwicklung des Klassenrates in der 3a
- 2.3. Dokumentation einer Klassenratssequenz
- 2.3.1. Sitzung vom 03.06.2005
- 2.3.2. Sitzung vom 10.06.2005
- 2.3.3. Sitzung vom 17.06.2005
- 2.3.4. Sitzung vom 24.06.2005
- 3. Bewertung des Klassenrates
- 3.1. Positive Aspekte
- 3.2. Probleme, Grenzen, Schwierigkeiten
- 3.3. Ausblick für die Klasse 3a
- 3.4. Wie bewertet die Klasse 3a selbst den Klassenrat?
- 1. Die Adalbert-Stifter-Grundschule in Würzburg (ASV)
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Realisierbarkeit von Demokratie in der Schule und fokussiert den Klassenrat als ein mögliches Instrument zur Förderung demokratischer Handlungsweisen und Schlüsselqualifikationen bei Schülern. Ziel ist es, theoretische Grundlagen der Demokratieerziehung aufzuzeigen und die praktische Umsetzung anhand eines Fallbeispiels zu analysieren.
- Demokratie als Gesellschaftsform und Bildungsziel
- Theoretische Modelle der Demokratieerziehung (Reformpädagogik, Konstruktivismus, Dewey, Freinet)
- Partizipationsformen in der Schule (traditionell und aktuell)
- Konzeption und Ablauf eines Klassenrates
- Praktische Anwendung und Bewertung des Klassenrates in einem konkreten Schulkontext
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die wachsende Bedeutung demokratischer Mitbestimmung in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Sie stellt die Frage nach der Rolle der Schule als Ort der Demokratieerziehung und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich mit der Definition von Demokratie, deren Umsetzung in der Schule und dem Klassenrat als praktisches Beispiel auseinandersetzt.
I. Demokratie – eine Definition: Dieses Kapitel liefert eine fundierte Definition von Demokratie als Gesellschaftsform, legt den Fokus auf ihre zentralen Prinzipien und Werte und bildet die Grundlage für die spätere Diskussion der Umsetzung von Demokratie in der Schule.
II. Demokratie und Schule: Hier wird die Frage diskutiert, inwieweit die Schule als Institution demokratisch organisiert ist und ob sie den Anforderungen an die Demokratieerziehung gerecht wird. Es werden historische Aspekte der Schulpolitik beleuchtet, und das schulische Bildungs- und Erziehungsziel "Demokratie" wird kritisch betrachtet.
III. Ideengeschichtliche Entwicklung und theoretische Modelle der Demokratieerziehung sowie deren praktische Umsetzung: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene theoretische Konzepte der Demokratieerziehung, beginnend mit der reformpädagogischen Bewegung und dem Konstruktivismus, einschliesslich der Ansätze von John Dewey und Celestine Freinet. Es werden sowohl „herkömmliche“ als auch „aktuelle“ Formen demokratischer Partizipation in der Schule untersucht und gegeneinander abgewogen.
IV. Der Klassenrat - Theorie: Dieses Kapitel widmet sich der Theorie des Klassenrates. Es werden verschiedene Konzeptionen des Klassenrates vorgestellt, darunter die Klassenversammlung nach Freinet und ein individualpsychologischer Ansatz. Ein möglicher Ablauf eines Klassenrates wird skizziert, welcher als Grundlage für die praktische Umsetzung im folgenden Kapitel dient.
Schlüsselwörter
Demokratie, Demokratieerziehung, Schule, Klassenrat, Partizipation, Mitbestimmung, Schülermitwirkung, Konstruktivismus, Reformpädagogik, John Dewey, Celestine Freinet, Konfliktlösung, Schlüsselqualifikationen, Friedenserziehung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Demokratieerziehung in der Schule - Der Klassenrat als Beispiel
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument untersucht die Umsetzung von Demokratie in der Schule, wobei der Klassenrat als Instrument zur Förderung demokratischer Handlungsweisen und Schlüsselqualifikationen im Fokus steht. Es verbindet theoretische Grundlagen der Demokratieerziehung mit einer praktischen Fallstudie.
Welche Themen werden behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: Definition von Demokratie, Demokratie in der Schule, ideengeschichtliche Entwicklung und theoretische Modelle der Demokratieerziehung (Reformpädagogik, Konstruktivismus, Dewey, Freinet), Partizipationsformen in der Schule, Konzeption und Ablauf eines Klassenrates, praktische Anwendung und Bewertung eines Klassenrates an einer konkreten Grundschule.
Welche theoretischen Modelle der Demokratieerziehung werden vorgestellt?
Das Dokument behandelt die reformpädagogische Bewegung, den Konstruktivismus sowie die Ansätze von John Dewey und Celestine Freinet als relevante theoretische Modelle der Demokratieerziehung.
Wie wird der Klassenrat im Dokument behandelt?
Der Klassenrat wird sowohl theoretisch (Konzeptionen, Ablauf) als auch praktisch (Fallstudie an der Adalbert-Stifter-Grundschule in Würzburg) untersucht. Die Fallstudie beinhaltet eine detaillierte Beschreibung des Ablaufs mehrerer Klassenratssitzungen und deren Bewertung.
Welche Aspekte der Fallstudie werden betrachtet?
Die Fallstudie an der Adalbert-Stifter-Grundschule in Würzburg umfasst die administrativ-soziographischen Gegebenheiten der Schule, die Organisation des Schullebens, die Beschreibung der konkreten Klasse (3a), die Gründe für die Einführung des Klassenrates, die Anbahnung und Entwicklung des Klassenrates, die Dokumentation mehrerer Sitzungen und eine umfassende Bewertung des Klassenrates inklusive positiver Aspekte, Probleme und Ausblicke.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Demokratie, Demokratieerziehung, Schule, Klassenrat, Partizipation, Mitbestimmung, Schülermitwirkung, Konstruktivismus, Reformpädagogik, John Dewey, Celestine Freinet, Konfliktlösung, Schlüsselqualifikationen, Friedenserziehung.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Demokratiedefinition, Demokratie und Schule, ideengeschichtlicher Entwicklung und theoretischen Modellen, Klassenratstheorie, Klassenratspraxis (inkl. Fallstudie) und ein Schlusswort. Jedes Kapitel wird im Dokument zusammengefasst.
Worum geht es in der Einleitung und im Schlusswort?
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Bedeutung demokratischer Mitbestimmung. Das Schlusswort fasst die Ergebnisse zusammen und bietet einen Ausblick.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Das Dokument richtet sich an Personen, die sich wissenschaftlich mit Demokratieerziehung in der Schule auseinandersetzen, insbesondere an Lehramtsstudierende und Pädagogen.
- Arbeit zitieren
- Christoph Hippeli (Autor:in), 2005, Der Klassenrat: Wie Demokratie in der Schule erfahrbar gemacht werden kann, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47866