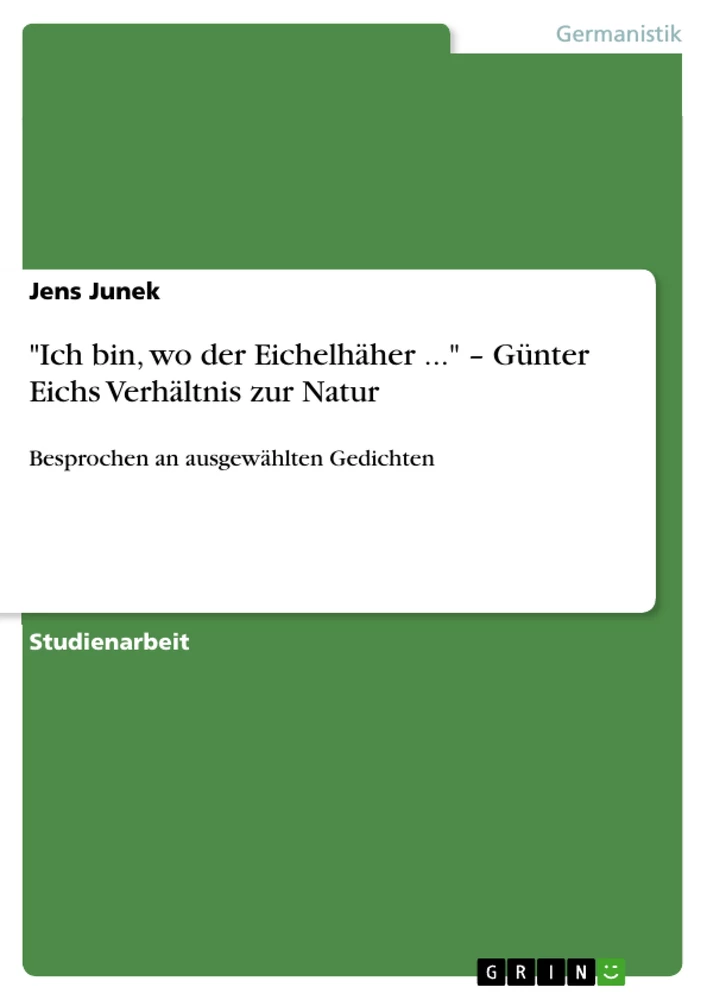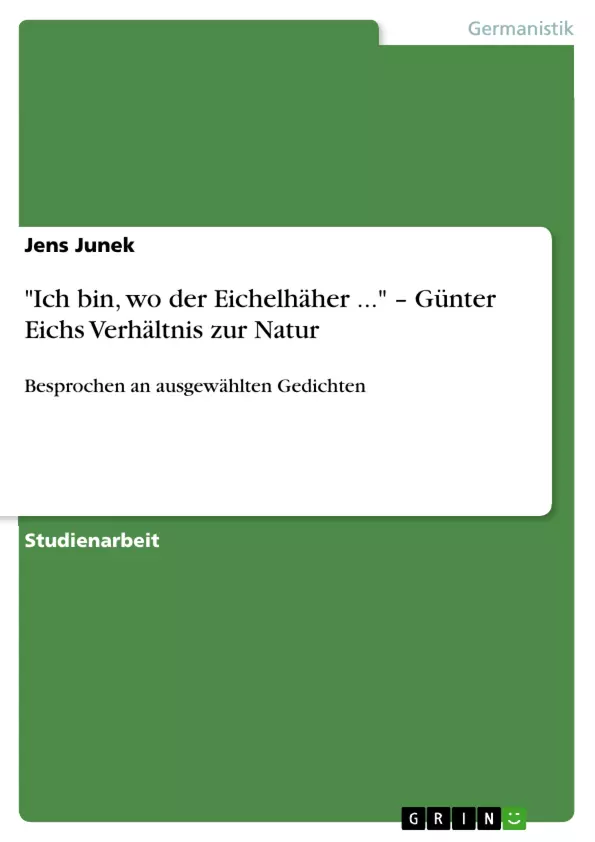„ach, Himbeerranken aussprechen,/ dir Beeren ins Ohr flüstern,/ die roten, die ins Moos fielen.“ – Der Gedanke der absoluten Verbundenheit mit der Natur, ja geradezu ein Aufgehen in ihr, ist zum einen ein Versuch der modernen Literatur in einer pluralistischen Welt wieder eine Mitte, einen festen Halt zu finden. Zum anderen ist er aber auch die ganz persönliche Suche nach dem Lebenssinn des großen Lyrikers und Erzählers Günter Eich. Was diesen Prozess so spannend macht, ist der Umstand, dass die Suche Eichs nach einer „tieferen Wahrheit“ in der Natur äußerst kritisch und reflektiert verläuft. So heißt es im erwähnten Gedicht weiter: „Dein Ohr versteht sie nicht,/ mein Mund spricht sie nicht aus,/ Worte halten ihren Verfall nicht auf.“
Diese Arbeit untersucht Günter Eichs Verhältnis zur Natur anhand ausgewählter Gedichte. Sie geht dabei weder streng chronologisch vor, noch erhebt sie Anspruch darauf, sämtliche bedeutsame Lyrik besprechen zu wollen. Vielmehr ist es das Ziel, durch die Interpretation bekannter wie auch nahezu unbekannter Texte den Wandlungsprozess in Eichs Haltung gegenüber der Natur nachvollziehen, vielleicht auch verstehen zu können. 1965 schreibt Günter Eich in einem Brief an das Goethe-Institut München: „Ich habe als verspäteter Expressionist und Naturlyriker begonnen, heute enthält meine Lyrik viel groteske Züge, das liegt wohl an einem Hang zum Realen, es ist mir nicht möglich, die Welt nur in der Auswahl des Schönen und Edlen und Feierlichen zu sehen.“ Diese Entwicklung weg von der Natur, hin zum Realen und darüber hinaus bis ins Groteske und Unverständliche soll Gegenstand dieser Arbeit sein. Es gilt, Eichs Haltung gegenüber der Natur auf verschiedenen Stufen seiner schriftstellerischen Entwicklung genau zu untersuchen und zu beschreiben, und möglichst Motive für den Wandel in dieser Beziehung herauszuarbeiten.
Die vorliegende Hauptseminararbeit wurde im September 2005 am Institut für Germanistische Literaturwissenschaft der Friedrich-Schiller-Universität in Jena angefertigt und mit der Note 1,7 bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. „Himbeerranken aussprechen“ — Die Bedeutung der Natur für Günter Eich
- 2. „Der Häher wirft mir die blaue Feder nicht zu“ - Zweifel an der Natur
- 3. „Natur ist eine Form der Verneinung“ — Abkehr von der Natur
- 4. „Ich will leben ohne Einverständnis“ — Verweigerung und Nichteinverständnis mit Natur und Gesellschaft
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung von Günter Eichs Verhältnis zur Natur anhand ausgewählter Gedichte. Ziel ist es, durch die Interpretation verschiedener Texte den Wandel in Eichs Haltung gegenüber der Natur nachzuvollziehen und mögliche Motive für diesen Wandel herauszuarbeiten. Die Arbeit konzentriert sich auf die schriftstellerische Entwicklung Eichs und betrachtet seine Lyrik nicht streng chronologisch.
- Eichs frühe Naturlyrik und die Bedeutung der Natur in seinen Werken
- Zunehmende Zweifel und kritische Auseinandersetzung mit der Natur
- Die Abkehr von der Natur und die Hinwendung zum Realen, Grotesken und Unverständlichen
- Die Rolle der Sprache als Bindeglied zwischen Natur und Denken
- Verweigerung und Nichteinverständnis mit Natur und Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit: die Untersuchung von Günter Eichs Verhältnis zur Natur durch die Analyse ausgewählter Gedichte. Sie betont, dass die Arbeit nicht chronologisch vorgeht und nicht alle bedeutenden Gedichte Eichs umfasst, sondern sich auf eine Auswahl konzentriert, die den Wandel in Eichs Naturverständnis verdeutlicht. Ein Zitat Eichs aus einem Brief von 1965 und ein weiteres aus einem Interview von 1967 unterstreichen die Entwicklung von einem "Naturlyriker" hin zu einer Lyrik mit "grotesken Zügen" und einem Hang zum Realen, wodurch die zentrale Forschungsfrage der Arbeit definiert wird.
1. „Himbeerranken aussprechen“ — Die Bedeutung der Natur für Günter Eich: Dieses Kapitel analysiert das Gedicht "Himbeerranken" von 1955. Der scheinbar einfache Titel täuscht über die Komplexität des Gedichts hinweg. Der erste Vers "Der Wald hinter den Gedanken" etabliert eine Verbindung zwischen Natur und Denken, die durch das Reimschema von "Himbeerranken" und "Gedanken" verstärkt wird. Die Mehrdeutigkeit der Pronomina in den folgenden Versen lässt die Interpretation zu, dass sowohl Natur als auch Denken der Vergänglichkeit unterliegen. Das Gedicht versucht, Natur und Denken zu verschmelzen. Die zweite Strophe zeigt den Wunsch nach Kommunikation mit der Natur durch Sprache, der jedoch durch den Ausruf "ach" als schwierig dargestellt wird. Die Verbindung von Natur und Denken wird weitergehend durch Bezug auf die Interpretationen von Kohlross und Oelmann vertieft und mit dem Gedicht "Die Herkunft der Wahrheit" in Zusammenhang gebracht.
Schlüsselwörter
Günter Eich, Naturlyrik, Verhältnis zur Natur, Wandel des Naturverständnisses, Sprache, Denken, Realismus, Groteske, Vergänglichkeit, Lyrikinterpretation.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Analyse von Günter Eichs Naturverständnis
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Verhältnisses von Günter Eich zur Natur anhand ausgewählter Gedichte. Sie verfolgt den Wandel in Eichs Haltung zur Natur und analysiert die Motive für diesen Wandel. Die Arbeit konzentriert sich auf die schriftstellerische Entwicklung Eichs und betrachtet seine Lyrik nicht streng chronologisch.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Eichs frühe Naturlyrik, zunehmende Zweifel und kritische Auseinandersetzung mit der Natur, die Abkehr von der Natur hin zum Realen, Grotesken und Unverständlichen, die Rolle der Sprache als Bindeglied zwischen Natur und Denken sowie die Verweigerung und das Nichteinverständnis mit Natur und Gesellschaft.
Welche Gedichte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert ausgewählte Gedichte von Günter Eich, um den Wandel in seinem Naturverständnis zu veranschaulichen. Ein konkret genanntes Gedicht ist "Himbeerranken" (1955), welches im Detail interpretiert wird. Die Arbeit umfasst jedoch nicht alle bedeutenden Gedichte Eichs.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, vier Hauptkapitel und einen Schluss. Die Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit und die Forschungsfrage. Die Kapitel analysieren verschiedene Aspekte von Eichs Naturverständnis anhand ausgewählter Gedichte. Die Kapitelüberschriften geben einen Hinweis auf die jeweiligen Schwerpunkte der Analyse.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine interpretative Methode. Ausgewählte Gedichte werden analysiert, um den Wandel in Eichs Naturverständnis nachzuvollziehen. Die Interpretationen werden durch Bezug auf andere Wissenschaftler (z.B. Kohlross und Oelmann) vertieft und in einen breiteren Kontext eingeordnet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Günter Eich, Naturlyrik, Verhältnis zur Natur, Wandel des Naturverständnisses, Sprache, Denken, Realismus, Groteske, Vergänglichkeit, Lyrikinterpretation.
Welche Zitate werden verwendet?
Die Arbeit verwendet Zitate aus einem Brief von Günter Eich aus dem Jahr 1965 und aus einem Interview von 1967, um die Entwicklung von Eichs Naturverständnis zu unterstreichen und die Forschungsfrage zu definieren. Zusätzlich werden Zitate aus den analysierten Gedichten verwendet.
Wie wird das Gedicht "Himbeerranken" interpretiert?
Die Interpretation von "Himbeerranken" betont die Verbindung zwischen Natur und Denken, die Mehrdeutigkeit der Sprache und den Wunsch nach Kommunikation mit der Natur. Die scheinbare Einfachheit des Titels steht im Gegensatz zur Komplexität des Gedichts. Die Analyse beleuchtet das Reimschema und die Bedeutung der Pronomina.
- Citation du texte
- Jens Junek (Auteur), 2005, "Ich bin, wo der Eichelhäher ..." – Günter Eichs Verhältnis zur Natur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48023