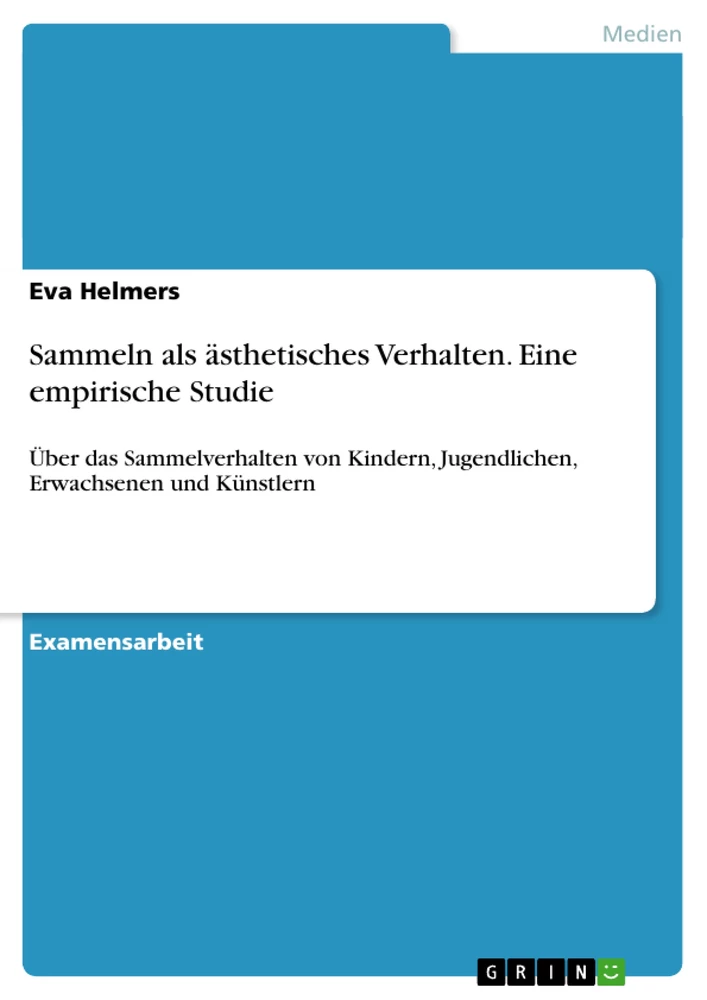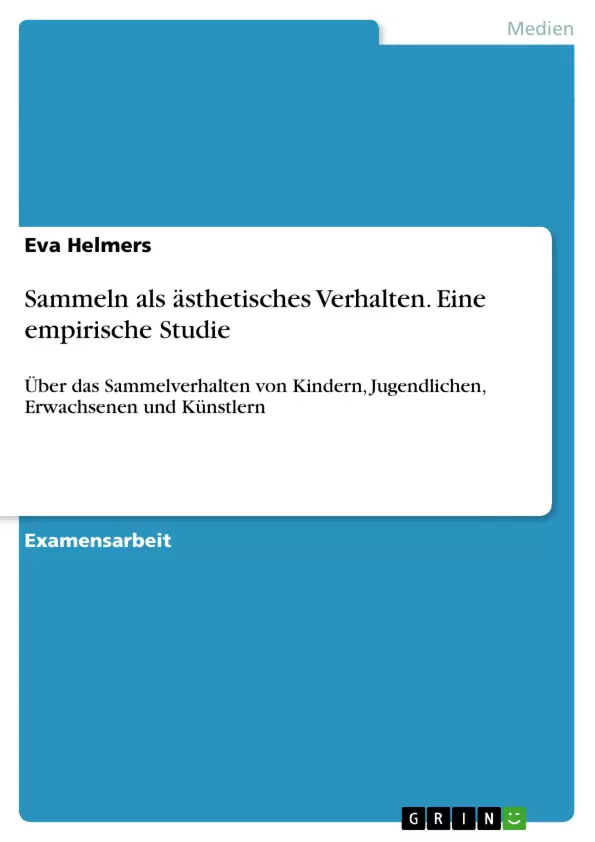„Der wahre Reichtum bestünde also in dem Besitz solcher Güter, welche man zeitlebens behalten, welche man zeitlebens genießen und an deren Genuss man sich bei immer vermehrten Kenntnissen immer mehr erfreuen könnte“. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Das Sammeln ist eine Beschäftigung, die Menschen seit jeher fasziniert. Zu allen Zeiten und in allen Kulturen werden Dinge entdeckt, bewundert, bestaunt, um dann gehortet, geordnet, und präsentiert zu werden. Was begehrt wird unterliegt einem ständigen Wandel und den ganz persönlichen Vorlieben des Sammlers. Gesammelt werden die kuriosesten und banalsten Dinge. Vom exquisiten Porzellan über Strickmuster, Kinokarten, toten Käfern, Souvenirs und Todesanzeigen bis hin zu Vogelstimmen und Barbiepuppen kann jedes noch so unscheinbare Objekt Anlass zum Sammeln geben. Es muss den Menschen nur in Staunen versetzen und seine Sinne reizen.
Heute werden die Menschen mit sinnlichen Reizen überflutet. Es gibt immer schönere, hochwertigere, buntere, ausgefallenere und attraktivere Angebote zum Sammeln. Das wählerische und lustvolle Zusammentragen von vielfältigen Objekten ist Bestandteil der Alltagskultur. Unsere Konsumkultur bietet eine unbegrenzte Produktpalette möglicher Sammelthemen, die ständig erweitert und vergrößert wird. Der Markt lockt mit Objekten, die in Serie hergestellt werden, aber auch mit limitierten Editionen. Der Sammler muss sich entscheiden, ob er eine Vollständigkeit seiner Sammlung anstrebt, oder gezielt nach außergewöhnlichen Gegenständen sucht, die er selbst zum Sammelobjekt erklärt. Er muss abwägen, wie er die Objekte aufbewahren und nach welchen Kriterien er sie ordnen möchte. Alle Sammler, ob jung ob alt, müssen mannigfache Entscheidungen im Zusammenhang mit ihren Sammlungen treffen. Sammeln impliziert zunächst eine differenzierte Wahrnehmung, im Weiteren einen handelnden Umgang mit den ausgewählten Objekten und schließlich die daraus resultierenden Erkenntnisse. Sammeln bedeutet ästhetisches Verhalten.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, das Sammeln als ästhetisches Verhalten zu untersuchen. Unterschiede und Gemeinsamkeiten des Sammelverhaltens und deren mögliche Ursachen werden in Zusammenhang mit Kindern, Erwachsenen und Künstlern herausgearbeitet. Ein aktueller Bezug wird durch empirische Studien zum Sammelverhalten von Erwachsenen und schwerpunktmäßig zum Sammelverhalten von Kindern und Jugendlichen hergestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen
- Definition des Begriffs „Sammeln”
- Definition des Begriffs „Ästhetisches Verhalten”
- Die Geschichte des Sammelns
- Sammlungen der Jungsteinzeit und der Antike
- Kirchliche Sammlungen im Mittelalter
- Kunst und Wunderkammern der Renaissance
- Entwicklung des heutigen Museums
- Sammeln heute
- Kindliches Sammeln
- Die Vielfalt der Dinge
- Bedeutungen der Dinge
- Aneignung der Welt
- Sammeln als ästhetisches Verhalten
- Tätigkeiten des Sammelns
- Auswählen
- (Auf-) Bewahren und Ordnen
- Basteln
- Ausstellen
- Aneignung von Wissen
- Ausbildung des Gedächtnisses
- Die soziale und identitätsstiftende Funktion des Sammelns
- Geschlechtsspezifische Aspekte des Sammelns
- Das Sammeln der Erwachsenen
- Geschlechtsspezifische Aspekte
- Die Dinge und ihre Bedeutungen
- Die Sammlerinnen
- Sammlerin A
- Sammlerin B
- Sammlerin C
- Negative Aspekte des Sammelns
- Sammeln als Form der Angstvermeidung
- Sammelzwang
- Kommerzialisierung des Sammelns
- Entwicklung der Kommerzialisierung
- Kinder und Konsum
- Kitsch
- Exklusives
- Das Sammeln in der Kunst
- Die Dinge der Künstler und Künstlerinnen
- Künstlerischer Umgang mit den Dingen
- Christian Boltanski
- Stefan Hoderlein
- Empirische Studie zum Sammelverhalten von Kindern
- Zur Befragung
- Themen der Sammlungen
- Anlässe und Motive
- Tätigkeiten
- Auswählen und Zusammentragen
- Aufbewahren, Ordnen und Ausstellen
- Tauschen
- Wissen aneignen
- Weitere Beschäftigungen
- Der soziale Aspekt
- Der identitätsstiftende Aspekt
- Der geschlechtsspezifische Aspekt
- Sammelthemen
- Beeinflussung durch die Medien
- Der altersspezifische Aspekt
- Zusammenfassung
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Sammeln als ästhetischem Verhalten. Ziel ist es, das Phänomen des Sammelns aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten und seine Bedeutung im Kontext individueller und sozialer Entwicklung zu untersuchen.
- Definition und Entwicklung des Sammelns
- Sammeln als ästhetisches Verhalten im Kindes- und Erwachsenenalter
- Soziale und identitätsstiftende Aspekte des Sammelns
- Kommerzialisierung und negative Aspekte des Sammelns
- Sammeln in der Kunst
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Sammeln ein und beleuchtet die historische Entwicklung des Sammelns. Kapitel 2 definiert die Begriffe „Sammeln“ und „Ästhetisches Verhalten“. Kapitel 3 widmet sich der Geschichte des Sammelns von der Jungsteinzeit bis zur Gegenwart und beschreibt die Entwicklung des Museums als Institution. Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem Sammeln im Kindesalter, insbesondere mit den Bedeutungen der gesammelten Dinge und den unterschiedlichen Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Sammeln. Kapitel 5 analysiert das Sammeln der Erwachsenen unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Aspekte. Kapitel 6 beleuchtet die negativen Aspekte des Sammelns, wie beispielsweise Sammelzwang und Kommerzialisierung. Kapitel 7 untersucht das Sammeln in der Kunst anhand der Beispiele von Christian Boltanski und Stefan Hoderlein. Kapitel 9 präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Studie zum Sammelverhalten von Kindern. Abschließend fasst das Fazit die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf weitere Forschungsfelder.
Schlüsselwörter
Sammeln, Ästhetisches Verhalten, Kindliches Sammeln, Erwachsenen-Sammeln, Kommerzialisierung, Sammelzwang, Kunst, Empirische Studie.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Sammeln als ästhetisches Verhalten"?
Es beschreibt das Sammeln als einen bewussten Umgang mit Objekten, der eine differenzierte Wahrnehmung, Auswahl und Ordnung erfordert und Erkenntnisse über die Welt vermittelt.
Warum sammeln Kinder?
Für Kinder dient das Sammeln der Aneignung der Welt, der Wissensbildung und hat eine starke soziale sowie identitätsstiftende Funktion.
Welche negativen Aspekte kann das Sammeln haben?
Negativformen sind der Sammelzwang (Messie-Syndrom) oder das Sammeln als Strategie zur Angstvermeidung sowie die starke Kommerzialisierung durch die Konsumindustrie.
Wie hat sich das Sammeln historisch entwickelt?
Die Geschichte reicht von rituellen Sammlungen der Antike über kirchliche Schätze im Mittelalter und Wunderkammern der Renaissance bis hin zum modernen Museumswesen.
Gibt es Unterschiede im Sammelverhalten zwischen den Geschlechtern?
Die Arbeit untersucht geschlechtsspezifische Aspekte sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen, die sich oft in der Wahl der Sammelthemen und Motive zeigen.
Welche Rolle spielt das Sammeln in der Kunst?
Künstler wie Christian Boltanski nutzen das Sammeln und Archivieren von Alltagsgegenständen als künstlerische Ausdrucksform und Methode der Welterkenntnis.
- Citar trabajo
- Eva Helmers (Autor), 2005, Sammeln als ästhetisches Verhalten. Eine empirische Studie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48033