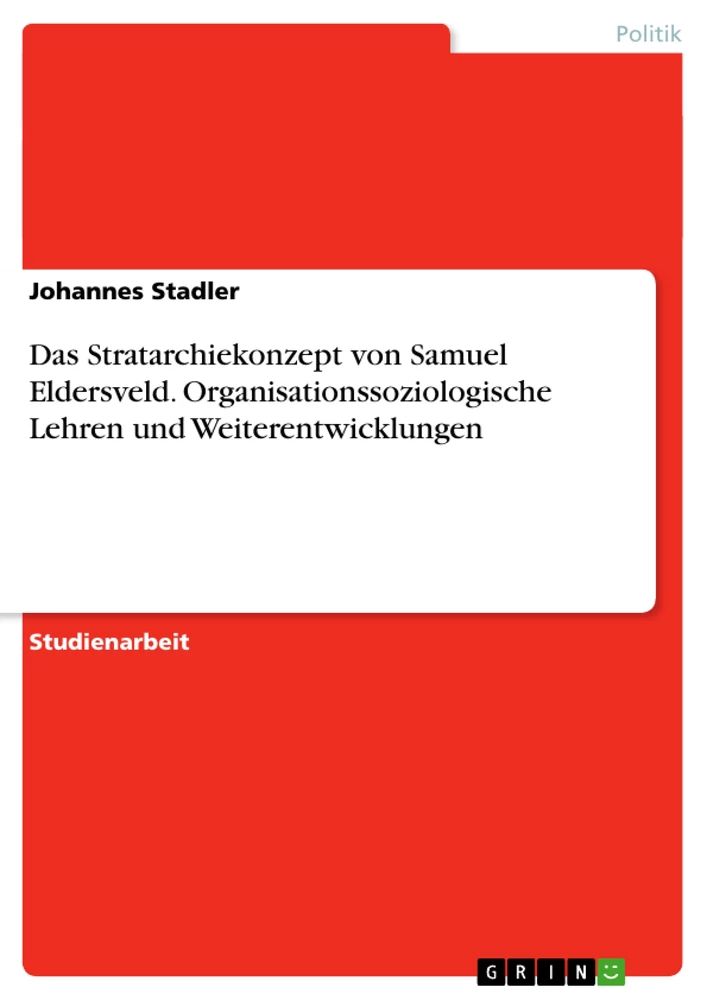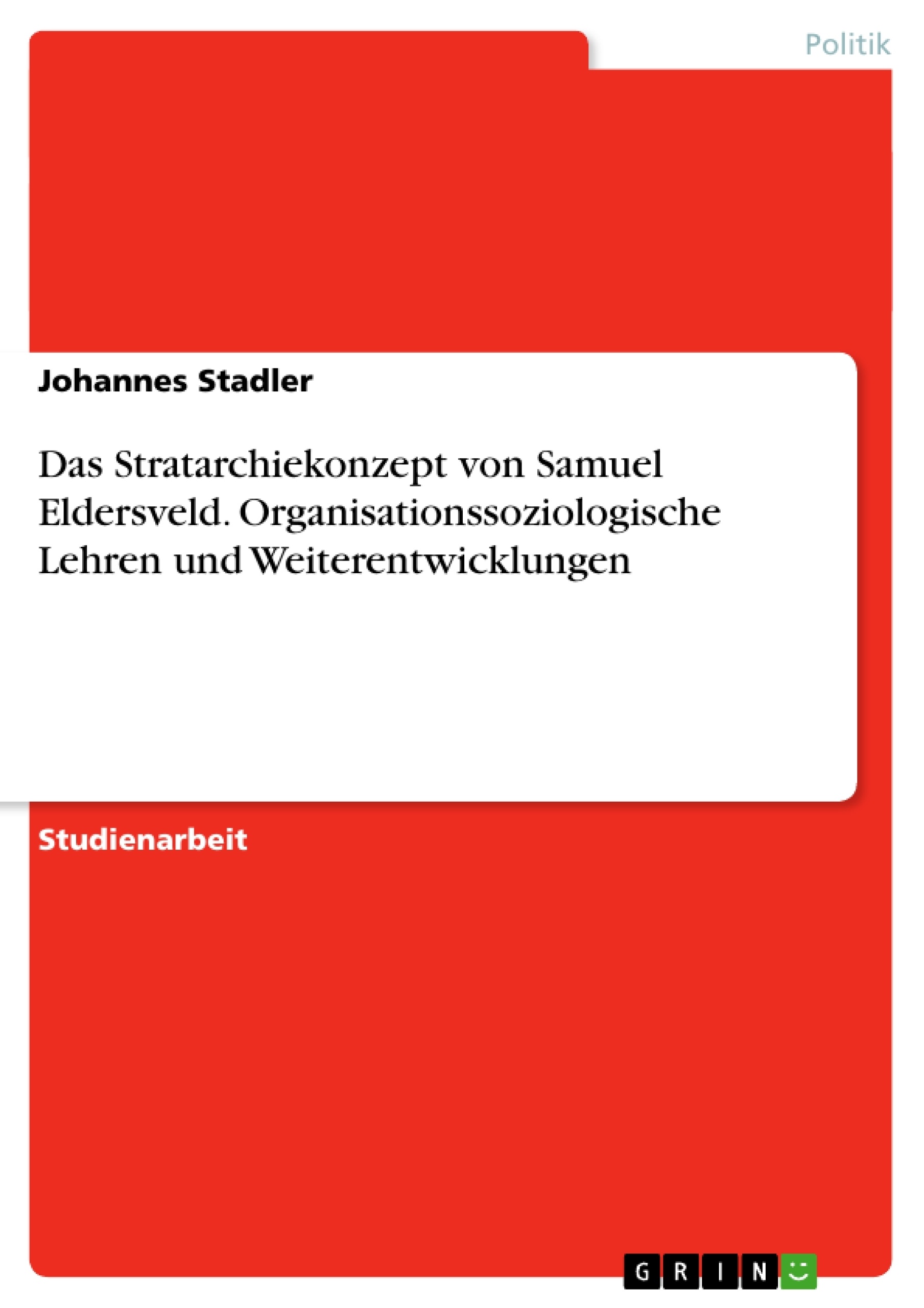„Basisdemokratie“, bzw. „Demokratie bis nach unten“!
Diese Schlagwörter begegnen uns fast täglich in den verschiedensten politischen Auseinandersetzungen. Natürlich wird je nach politischer Anschauung diesen Forderungen mehr oder weniger Gewicht beigemessen, dennoch richtet sich das Augenmerk der Öffentlichkeit immer wieder darauf, z.B. wenn des öfteren Forderungen nach einer Volksabstimmung auf Bundesebene artikuliert werden.
Dass aber die großen gesellschaftlichen Interessengruppen wie politische Parteien oder Verbände selbst auf „basisdemokratischen Füssen“ ruhen, wird dabei weniger in Frage gestellt. Betrachtet man jedoch den Aufbau solcher Interessengruppen näher, stellen sich berechtigte Zweifel ein, ob deren Organisationswirklichkeit tatsächlich demokratisch genannt werden kann.
Vor allem das Konzept der "Stratarchie" des amerikanischen Wissenschaftlers Samuel Eldersveld ist in diesem Zusammenhang von Interesse. Er untersuchte die Organisationswirklichkeit, bzw. den Grad der innerorganisatorischen Demokratie US-amerikanischer Parteien und erlangte dadurch viele, zum Teil sehr überraschende Erkenntnisse.
Samuel Eldersvelds Werk vorzustellen, die wesentlichen Vordenker, aber auch Weiterentwicklungen seines Modells herauszuarbeiten, sowie zu versuchen, die wichtigsten Erkenntnisse auf die deutsche Parteien- und Verbändelandschaft zu übertragen (exemplarisch an der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands), ist Ziel dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Organigramm vs. Organisationswirklichkeit 1, „die Anfänge“
- Grundlegendes
- Vorläufer und Vordenker Eldersvelds: Robert Michels und sein „ehernes Gesetz der Oligarchie“
- Organigramm vs. Organisationswirklichkeit 2, „Parteien als diffuse Stratarchien“ – Samuel Eldersveld
- Überblick über die Arbeit Eldersvelds
- Das Stratarchie-Modell
- Grundlegendes
- Die Partei als bürokratisches System
- Die Basis als „kritischer Handlungsort“
- Die empirische Arbeit Eldersvelds
- Grad der Hierarchie bis nach unten
- Der „Index of Organizational Awareness“
- Rollenerwartungen vs. Realität
- Die Partei als lose verkoppelte Anarchie: E. Wiesendahl
- Grundlegendes
- Strukturbesonderheiten der Organisationswirklichkeit politischer Parteien
- Unbestimmtheit
- Fragmentierung
- Lose Kopplung
- Hypokrisie
- Parteien als fragmentierte, lose verkoppelte Anarchien
- Fallbeispiel: die Sozialdemokratische Partei Deutschlands
- Die SPD vor 1914 eine „eherne Oligarchie“?
- Die SPD nach dem 2. Weltkrieg: Zentralisierungstendenzen
- Die moderne SPD als „lose verkoppelte Anarchie“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie die Organisationswirklichkeit von Interessengruppen, insbesondere politischen Parteien, im Lichte des Stratarchie-Konzepts von Samuel Eldersveld betrachtet werden kann. Dabei werden die theoretischen Grundlagen des Konzepts untersucht, die empirischen Ergebnisse Eldersvelds beleuchtet und die Weiterentwicklung des Modells durch Elmar Wiesendahl vorgestellt. Ziel ist es, die organisationssoziologischen Lehren Eldersvelds und seiner Nachfolger im Hinblick auf die Organisation von Parteien zu beleuchten.
- Das Stratarchie-Modell von Samuel Eldersveld
- Die empirische Forschung zu Partei- und Organisationsstrukturen
- Die Weiterentwicklung des Stratarchie-Modells durch Elmar Wiesendahl
- Die Analyse der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands als Fallbeispiel
- Die Frage der Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf andere Interessengruppen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer kurzen Einführung in die Thematik der innerorganisatorischen Demokratie und beleuchtet die Bedeutung des Stratarchie-Konzepts für die Erforschung der Organisationswirklichkeit von Interessengruppen. Im zweiten Kapitel wird das Organigramm von Interessengruppen dem Konzept der „legalen“ oder „bürokratischen Herrschaft“ gegenübergestellt. Der Fokus liegt dabei auf der Arbeit Robert Michels und seinem „ehernen Gesetz der Oligarchie“. Im dritten Kapitel wird das Stratarchie-Modell von Samuel Eldersveld vorgestellt, wobei sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die empirischen Ergebnisse der Untersuchung des amerikanischen Parteiwesens beleuchtet werden. Das vierte Kapitel widmet sich der Weiterentwicklung des Stratarchie-Modells durch Elmar Wiesendahl und dem Konzept der „losen verkoppelten Anarchie“. Im fünften Kapitel wird die SPD als Fallbeispiel herangezogen, um die organisationssoziologischen Lehren Eldersvelds und seiner Nachfolger in einem konkreten Fall zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Stratarchie-Konzept, der Organisationswirklichkeit von Interessengruppen, insbesondere politischen Parteien, innerparteilicher Demokratie, empirischer Forschung, dem „ehernen Gesetz der Oligarchie“ von Robert Michels, der „losen verkoppelten Anarchie“ nach Elmar Wiesendahl und dem Fallbeispiel der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands.
- Quote paper
- Johannes Stadler (Author), 2005, Das Stratarchiekonzept von Samuel Eldersveld. Organisationssoziologische Lehren und Weiterentwicklungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48036