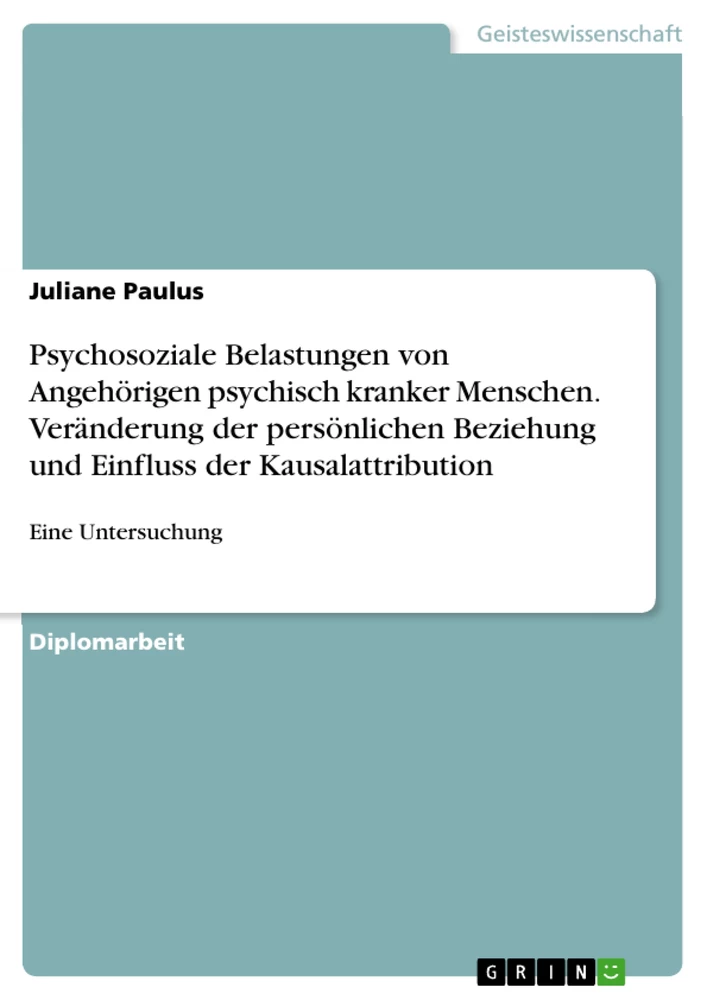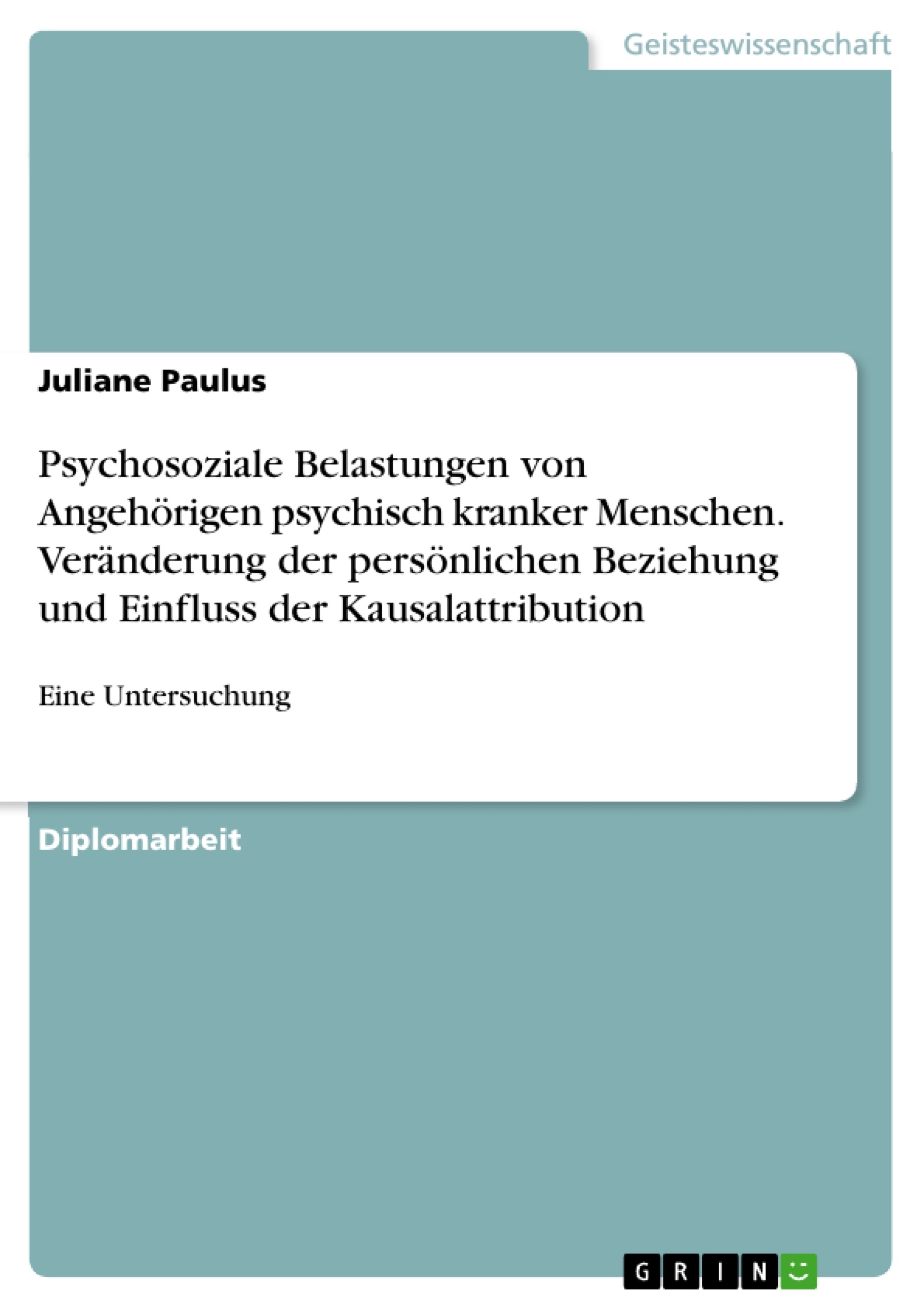Die psychische Erkrankung eines Menschen ist ein kritisches Erlebnis im menschlichen Leben, das schwerwiegende Auswirkungen, sowohl für den Erkrankten selbst als auch für dessen Angehörigen hat. Oftmals wird der Angehörige mit der Diagnose von Seiten der Ärzte oder des Betroffenen konfrontiert und dann mit sich selbst und seinen Gefühlen allein gelassen. Deshalb stellen sich bezüglich der Angehörigen von psychisch kranken Menschen verschiedene Fragen: Was bewegt die Angehörigen, wenn ihr Partner oder ihr Kind psychisch krank wird? Wie gehen sie mit der Krankheit um und, was viel wichtiger ist, wie gehen sie mit dem Erkrankten um? Was beeinflusst das Belastungsempfinden der Angehörigen?
Ohne Zweifel sind Angehörige von psychisch Erkrankten psychosozialen Belastungen ausgesetzt. Zahlreiche quantitative Studien zum Belastungserleben der Angehörigen wurden mit unterschiedlichen Schwerpunkten durchgeführt und bestätigen diese Aussage.
Was bis jetzt jedoch wenig Achtung fand, ist die subjektive Sichtweise von psychosozialen Belastungen von Seiten der Angehörigen, ihre persönliche Situation und die Frage, welchen Einfluss ihrer Meinung nach verschiedene Faktoren auf ihre psychosoziale Belastung haben.
Deshalb liegt in der hier vorliegenden Arbeit der Schwerpunkt auf den psychosozialen Belastungen von Angehörigen psychisch kranker Menschen. Ziel ist es, mit Hilfe einer qualitativen inhaltlichen Strukturierung herauszufinden, ob sich die persönliche Beziehung von Eltern und Partnern aufgrund der psychischen Erkrankung eines Teils verändert. Dabei wird darauf geachtet, ob sich Partner und Eltern in den Aussagen zur Veränderung der Beziehung unterscheiden.
Des Weiteren soll untersucht werden, welche Ursachenerklärungen die beiden Subgruppen bezüglich der psychischen Erkrankung angeben und ob es auch hier Unterschiede zwischen den beiden Gruppen gibt.
Mit Hilfe der Durchführung einer quantitativen Analyse soll der Zusammenhang zwischen den beiden Schwerpunkten und deren Einfluss auf das Belastungsempfinden der Angehörigen hergestellt werden, wobei wieder Eltern von Partnern getrennt betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- A Theoretischer Teil
- 1. Psychosoziale Belastungen von Angehörigen psychisch kranker Menschen
- 1.1 Psychosoziale Belastung
- 1.2 Überblick zum Forschungsstand der Angehörigenforschung
- 1.3 Belastungsmodell: Transaktionales Stressmodell von Richard Lazarus
- 1.3.1 Stressoren
- 1.3.2 Primäre Bewertung
- 1.3.3 Sekundäre Bewertung
- 1.3.4 Neubewertung
- 1.3.5 „Coping“
- 1.3.6 Psychosoziale Belastungen („Outcome“)
- 2. Persönliche Beziehungen und psychosoziale Belastungen von Angehörigen
- 2.1 Definitionen
- 2.2 Eltern-Kind-Beziehung
- 2.2.1 Bindungstheorie nach John Bowlby und Mary Ainsworth
- 2.2.2 Bindungsmuster in der Kindheit
- 2.2.3 Bindungsmuster im Erwachsenalter
- 2.2.4 Überblick zum Forschungsstand bezüglich Eltern-Kind-Beziehung und psychosozialen Belastungen
- 2.3 Partnerschaft
- 2.3.1 Modelle der Partnerwahl
- 2.3.2 Beziehungsmuster von psychisch Erkrankten
- 2.3.3 Stress und Belastung in der Partnerschaft
- 2.3.4 Überblick zum Forschungsstand bezüglich Partnerbeziehung und psychosozialen Belastungen
- 3. Kausalattribution und psychosoziale Belastungen von Angehörigen
- 3.1 Theorien zur Kausalattribution
- 3.1.1 Definitionen
- 3.1.2 Attributionstheorie nach Fritz Heider (1958)
- 3.1.3 Attributionstheorie nach E. E. Jones und U. E. Davis (1965)
- 3.1.4 Attributionstheorie nach Harold H. Kelley (1972)
- 3.1.5 Attributionsfehler im Attributionsprozess
- 3.1.6 Dimensionen der Kausalattribution
- 3.2 Der Attributionsprozess bei Anghörigen psychisch Kranker
- 3.2.1 Allgemeine Erklärungstheorien zu psychischer Krankheit
- 3.2.2 Überblick zum Forschungsstand bezüglich Kausalattribution und psychosozialen Belastungen
- B Empirischer Teil
- 4. Qualitative Inhaltsanalyse
- 4.1 Vorstellung des Projektes der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus
- 4.1.1 Allgemeine Vorbemerkungen
- 4.1.2 Phase I des Projektes
- 4.1.3 Phase II des Projektes
- 4.1.4 Phase III des Projektes
- 4.1.5 Definitionen der Krankheitsbilder
- 4.2 Darstellung der Methodik der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2003)
- 4.2.1 Allgemeine Vorbemerkungen
- 4.2.2 Strukturierende Inhaltsanalyse
- 4.2.3 Ablaufmodell der inhaltlichen Strukturierung
- 4.3 Durchführung der inhaltlichen Strukturierung
- 4.3.1 Bestimmung des Ausgangsmaterials
- 4.3.1.1 Festlegung des Materials
- 4.3.1.2 Entstehungssituation
- 4.3.1.3 Formale Charakteristika
- 4.3.2 Fragestellung der Analyse
- 4.3.2.1 Richtung der Analyse
- 4.3.2.2 Differenzierung hinsichtlich der Theorie
- 4.3.2.3 Fragestellungen
- 4.3.2.4 Hypothesen
- 4.3.3 Festlegung der Analyseeinheiten
- 4.3.3.1 Kodiereinheit
- 4.3.3.2 Kontexteinheit und Auswertungseinheit
- 4.3.4 Kategorienbildung
- 4.3.4.1 Kategoriensystem zur Beziehungsveränderung
- 4.3.4.2 Kategoriensystem zu Kausalattribution bezüglich der Erkrankung
- 4.3.5 Ergebnisse
- 4.3.5.1 Ergebnisse zu Beziehungsveränderung nach dem ersten Materialdurchlauf
- 4.3.5.2 Ergebnisse zu Beziehungsveränderung nach dem zweiten Materialdurchlauf
- 4.3.5.3 Ergebnisse zu Kausalattribution nach dem ersten Materialdurchlauf
- 4.3.5.4. Ergebnisse zu Kausalattribution nach dem zweiten Materialdurchlauf
- 5. Quantitative Analyse
- 5.1 Darstellung von Design und Methodik der quantitativen Datenanalyse
- 5.2 Beziehungsveränderung
- 5.2.1 Fragestellungen zu Beziehungsveränderung
- 5.2.2 Hypothesen zu Beziehungsveränderung
- 5.2.3 Ergebnisse zu Beziehungsveränderung
- 5.3 Kausalattribution
- 5.3.1 Fragestellungen zu Kausalattribution
- 5.3.2 Hypothesen zu Kausalattribution
- 5.3.3 Ergebnisse zu Kausalattribution
- 6. Diskussion
- 6.1 Ergebniskritik
- 6.1.1 Ergebniskritik der qualitativen Inhaltsanalyse
- 6.1.2 Ergebniskritik der quantitativen Analyse
- 6.2 Methodenkritik
- Zusammenfassung
- Psychosoziale Belastungen von Angehörigen psychisch kranker Menschen
- Veränderungen in der Beziehung zwischen Angehörigen und psychisch kranken Personen
- Einfluss der erkrankungsbezogenen Kausalattribution auf die Belastung der Angehörigen
- Transaktionales Stressmodell von Richard Lazarus
- Theorien zur Kausalattribution
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den psychosozialen Belastungen von Angehörigen psychisch kranker Menschen. Ziel der Untersuchung ist es, die Veränderung der persönlichen Beziehung zwischen Angehörigen und psychisch kranken Personen sowie den Einfluss der erkrankungsbezogenen Kausalattribution auf die Belastungen der Angehörigen zu analysieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der psychosozialen Belastungen von Angehörigen psychisch kranker Menschen ein. Sie erläutert die Relevanz des Themas und beschreibt den Aufbau der Arbeit.
Der theoretische Teil beleuchtet zunächst die psychosoziale Belastung und den Forschungsstand in der Angehörigenforschung. Er greift das transaktionale Stressmodell von Richard Lazarus auf und analysiert die Stressoren, Bewertungsprozesse und Copingmechanismen, die Angehörigen psychisch kranker Menschen erleben.
Anschließend werden persönliche Beziehungen und psychosoziale Belastungen von Angehörigen im Detail betrachtet. Es werden Definitionen und theoretische Modelle zur Eltern-Kind-Beziehung sowie zur Partnerschaft vorgestellt. Die Kapitel beleuchten die Relevanz von Bindungstheorien, Beziehungsmustern und dem Einfluss von Stress und Belastung auf die Beziehung zwischen Angehörigen und psychisch kranken Menschen.
Der dritte Teil der Arbeit behandelt die Kausalattribution und deren Einfluss auf die psychosozialen Belastungen von Angehörigen. Es werden verschiedene Theorien zur Kausalattribution vorgestellt, einschließlich des Attributionsprozesses und der Attributionsfehler.
Der empirische Teil der Arbeit beinhaltet eine qualitative Inhaltsanalyse und eine quantitative Analyse, die auf Daten aus einem Projekt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus basieren. Die qualitative Inhaltsanalyse beschäftigt sich mit der Veränderung der Beziehung zwischen Angehörigen und psychisch kranken Personen sowie der Kausalattribution bezüglich der Erkrankung. Die quantitative Analyse untersucht die Beziehung zwischen erkrankungsbezogenen Kausalattributionen und den psychosozialen Belastungen der Angehörigen.
Schlüsselwörter
Psychosoziale Belastung, Angehörige, psychische Krankheit, Beziehung, Kausalattribution, Stress, Coping, Bindungstheorie, Partnerschaft, qualitative Inhaltsanalyse, quantitative Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Welchen psychosozialen Belastungen sind Angehörige psychisch Kranker ausgesetzt?
Angehörige erleben oft starke emotionale Belastungen, Einsamkeit und Stress. Die Erkrankung eines Familienmitglieds verändert den Alltag und die Beziehungsdynamik grundlegend, was zu einer hohen subjektiven Belastung führt.
Wie verändert eine psychische Erkrankung die Partnerschaft oder Eltern-Kind-Beziehung?
Die Studie untersucht, ob sich Beziehungen durch die Diagnose verändern. Oft kommt es zu Rollenverschiebungen, Kommunikationsproblemen oder einer emotionalen Distanzierung, wobei sich die Auswirkungen zwischen Partnern und Eltern unterscheiden können.
Was versteht man unter Kausalattribution im Kontext von Krankheiten?
Kausalattribution bezeichnet die Ursachenerklärungen, die Angehörige für die psychische Erkrankung finden. Diese Erklärungen (z. B. Genetik, Erziehung oder Stress) beeinflussen maßgeblich, wie die Angehörigen mit der Situation umgehen und wie hoch ihr Belastungsempfinden ist.
Was besagt das Stressmodell von Lazarus für Angehörige?
Das transaktionale Stressmodell erklärt Belastung als Ergebnis eines Bewertungsprozesses: Angehörige bewerten die Situation (Stressoren) und ihre eigenen Ressourcen (Coping), was über das Ausmaß der empfundenen Belastung entscheidet.
Gibt es Unterschiede im Belastungserleben zwischen Eltern und Partnern?
Ja, die Arbeit untersucht spezifisch, ob Eltern (aufgrund der Bindungstheorie) anders auf die Erkrankung reagieren als Partner und wie sich ihre jeweiligen Ursachenerklärungen auf ihre psychische Gesundheit auswirken.
- Quote paper
- Juliane Paulus (Author), 2005, Psychosoziale Belastungen von Angehörigen psychisch kranker Menschen. Veränderung der persönlichen Beziehung und Einfluss der Kausalattribution, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48038