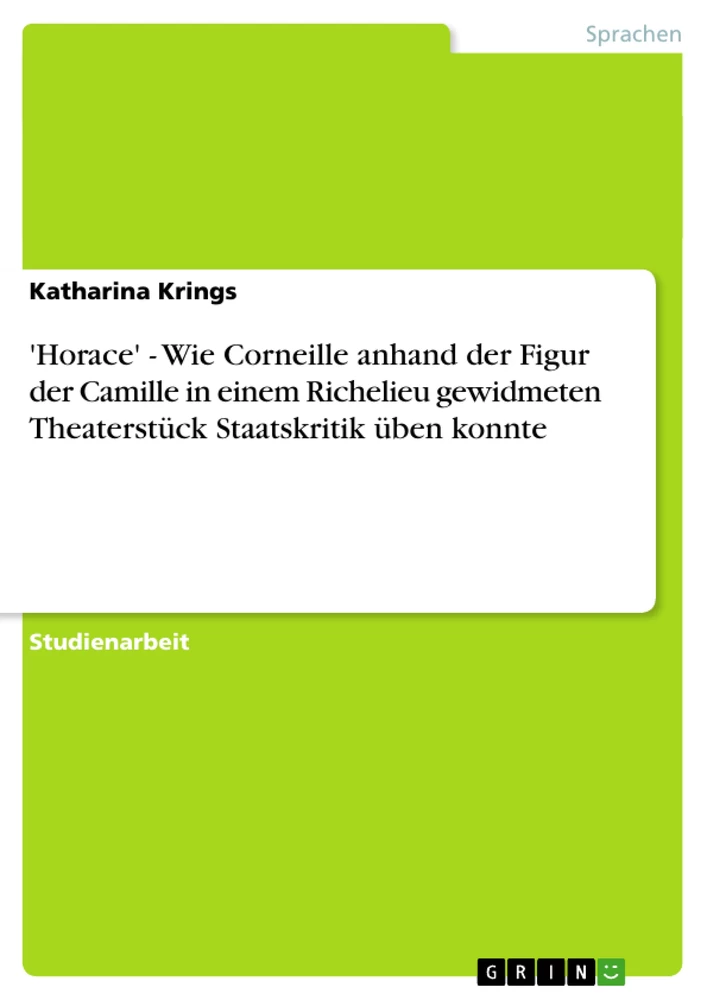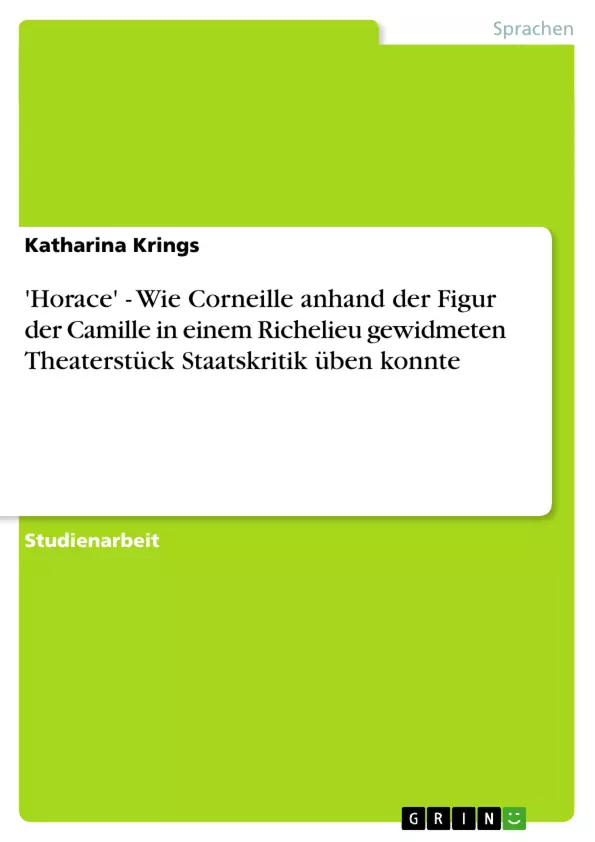Ab 1635 bezog Corneille die Politik in seine Stücke mit ein. Während er im „Cid“ noch den nur an seinem Glück interessierten und aufsässigen Rodrique das vom König - und wie auch im wahren Leben von Richelieu - nicht erwünschte Duell abhalten ließ, schien „Horace“ vier Jahre später die Allmacht des Staates und die damit einhergehende absolute Sich-Unterwerfung dieser Macht zu zelebrieren.
Es ist aus heutiger Sicht erstaunlich, dass „Horace“, mit der darin von Camille nicht gerade sparsam geäußerten Staatskritik, Richelieu nicht nur gewidmet, sondern von diesem die Aufführung auch genehmigt wurde. Die für den Leser unserer Zeit logische Denk- und Handlungsweise der Camille wird nämlich kaum vom Freispruch für Horace am Ende des Stückes anders gewertet als zu Beginn. Versetzt man sich allerdings in die Entstehungszeit des Stückes und betrachtet man die politischen sowie gesellschaftlichen Tugenden und Richtlinien vor dem geschichtlichen Hintergrund, so ist es gut möglich, dass eine abschreckende Schlussszene Camilles Wortgewalt zunichte macht. Nach eingehender Beschäftigung mit „Horace“ wird aber deutlich, dass sich Corneille anhand der Figur der Camille durchaus ein kritisches Sprachrohr geschaffen hat, das auch auf entsprechendes Gehör stoßen konnte. Dazu ist es besonders wichtig, nicht nur die historischen und politischen Hintergründe zu erforschen, sondern auch die Zuschauerperspektive zu definieren.
Ein Blick in die Forschungsliteratur zeigt, dass die Meinungen über die Aussage des Stückes gespalten sind. So sieht Jaques Maurens in Corneille einen getreuen Ideologen Richelieus und dessen Staatsidee. Dementgegen stufen Werner Krauss und Bernard Dort Corneille als einen Vertreter des Bürgertums ein, da er deren politische Wünsche und Vorstellungen in seinen Stücken thematisiert. Nach Serge Doubrovsky schreibt Corneille ein théâtre réactionnaire. Zwar lassen sich für jeden der genannten Interpretationsansätze geeignete Textstellen finden, jedoch soll auf denen von Wolfgang Iser aufgebaut werden, wo festgehalten wird, dass in Corneilles Stücken von einem Zusammenhang zwischen Fiktion und Wirklichkeit auszugehen sei.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Le XVIIème siècle - Zeitliche Situierung
- Das politische Geschehen um 1640
- Die Auswirkungen der Politik auf die französische Literatur
- Die doctrine classique
- Das politische Geschehen in „Horace“ in einem vergleichenden Bezug zur Realität
- Der Begriff der Staatsräson im Vergleich zu „Horace“
- Zum Begriff des Stoizismus
- Im Allgemeinen
- Der Stoizismus zu Corneilles Zeit
- „Horace“ - Ein Resumée
- Ist diese Tragödie wirklich tragisch?
- Die Position der Camille
- Ein Überblick
- Camilles Taktik
- Die Fortschrittlichkeit von Camilles Denkweise
- Zur Rezeptionsperspektive
- Schlussfolgerungen
- Wie konnte die Staatskritik verschleiert werden?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Theaterstück „Horace“ von Pierre Corneille aus dem Jahr 1640 und analysiert, wie der Autor anhand der Figur der Camille Staatskritik in einem Richelieu gewidmeten Stück üben konnte. Die Untersuchung konzentriert sich auf die historische und politische Situation in Frankreich im 17. Jahrhundert, die Rolle des Stoizismus in Corneilles Werk und die Rezeptionsperspektive des Stückes.
- Corneilles Staatskritik in „Horace“
- Die Rolle der Figur der Camille als Sprachrohr der Kritik
- Die politische und gesellschaftliche Situation in Frankreich um 1640
- Der Einfluss des Stoizismus auf Corneilles Werk
- Die Rezeption von „Horace“ in der Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Frage nach Corneilles Staatskritik in „Horace“ und die Relevanz der Figur der Camille. Das zweite Kapitel beleuchtet den historischen Kontext des Stückes, indem es das politische Geschehen um 1640, die Auswirkungen der Politik auf die französische Literatur, die Doctrine classique und das politische Geschehen in „Horace“ im Vergleich zur Realität beleuchtet. Das dritte Kapitel behandelt den Begriff der Staatsräson und seine Bedeutung in Corneilles Werk, während Kapitel 4 den Stoizismus im Allgemeinen und zu Corneilles Zeit betrachtet. In Kapitel 5 wird ein Resumée des Stückes „Horace“ gegeben, gefolgt von einer Diskussion über die Tragik des Stückes in Kapitel 6. Kapitel 7 analysiert die Position der Camille im Stück, einschließlich ihrer Taktik und der Fortschrittlichkeit ihrer Denkweise. Das achte Kapitel beschäftigt sich mit der Rezeptionsperspektive des Stückes, und die Schlussfolgerungen in Kapitel 9 untersuchen, wie Corneille die Staatskritik in „Horace“ verschleiern konnte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Staatskritik, Tragödie, Stoizismus, Staatsräson, politische Macht, französische Literatur des 17. Jahrhunderts, Pierre Corneille, „Horace“, Camille, Richelieu, historische und politische Hintergründe, Rezeptionsperspektive.
- Quote paper
- Katharina Krings (Author), 2004, 'Horace' - Wie Corneille anhand der Figur der Camille in einem Richelieu gewidmeten Theaterstück Staatskritik üben konnte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48122