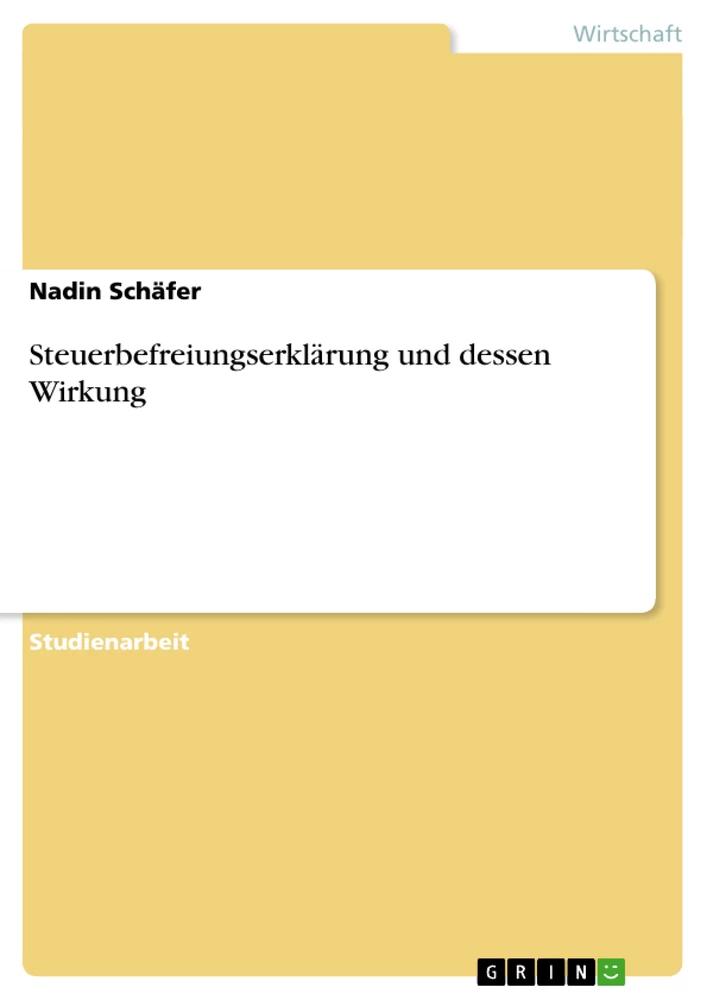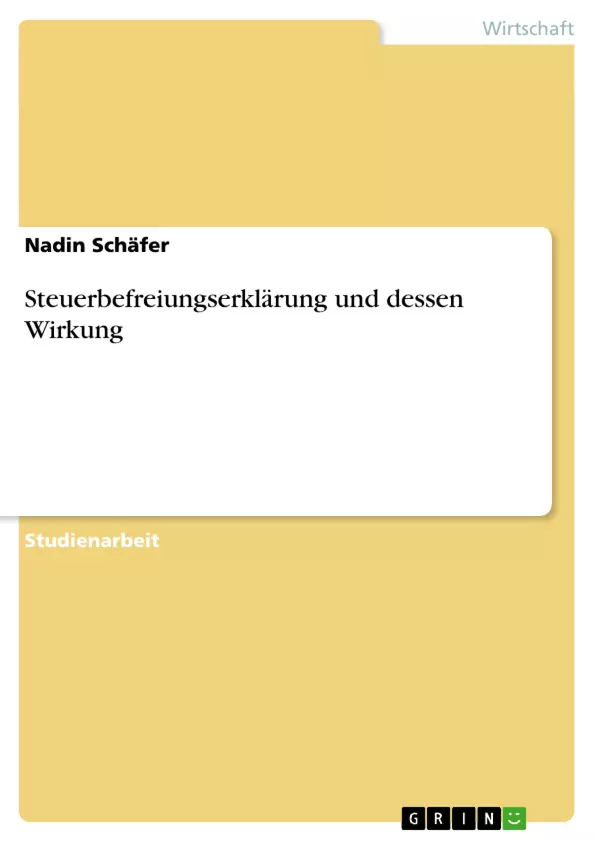Wer in einem begrenzten Zeitraum nicht versteuerte Einnahmen freiwillig meldet und darauf eine Ablass-Steuer zahlt, bleibt von Strafe, Bußgeld und Hinterziehungszinsen verschont. Dies ermöglicht das neue Strafbefreiungserklärungsgesetz (StraBEG), das am 1.1.2004 in Kraft trat und bis zum 31.3.2005 gilt. Die Bundesregierung hat mit dem Strafbefreiungserklärungsgesetz (StraBEG) ein Angebot geschaffen, dass als "Brücke zur Steuerehrlichkeit“ zu verstehen ist: Diese Brücke können Bürger beschreiten, die in der Vergangenheit steuerpflichtige Erträge erzielt bislang nicht versteuert haben oder Schwarzgeld verheimlicht haben. Gedacht ist vor allem an Kapitalvermögen, das im Ausland angelegt wurde und nun legal heim nach Deutschland geholt werden kann. Natürlich gilt das Angebot auch für Kapitalvermögen, das in Deutschland angelegt wurde und die Zinsen daraus nicht versteuert wurden.
4. Schritte zur Steuerehrlichkeit:
1. Abgabe einer strafbefreienden Erklärung innerhalb einer bestimmten Frist
2. Zahlung einer pauschale Abgabe, die sog. Ablass-Steuer
3. Erlangen der Straf- oder Bußgeldfreiheit
4. Zum Erreichen zukünftiger Steuerehrlichkeit, erhält der Fiskus weit reichende Kontrollmöglichkeiten
5. Alternative zum Strafbefreiungserklärungsgesetz (StraBEG)
Inhaltsverzeichnis
- A. Inhalt des Strafbefreiungserklärungsgesetz (StraBEG)
- 1. Die strafbefreiende Erklärung
- .1 Welche Einnahmen sind in der strafbefreienden Erklärung anzusetzen?
- 1.2 In welcher Höhe sind die Einnahmen in der strafbefreienden Erklärung anzusetzen?
- 1.2.1. Einkommensteuer
- 1.2.2. Erbschaft- und Schenkungsteuer
- 1.2.3. Vermögensteuer
- 1.2.4. Betriebliche Einnahmen ("Schwarzgeschäfte")
- 2. Die pauschale Abgabe (Ablass-Steuer)
- 2.1. Fristsetzung für die Zahlung der pauschalen Abgabe
- 3. Erlangen der Straf- und Bußgeldbefreiung
- 3.1 Verwertungsverbot
- 3.2 Für welchen Personenkreis gilt die Straf- oder Bußgeldbefreiung?
- 4. Die Kontrollmöglichkeiten des Fiskus
- 4.1 Abruf von Konteninformationen durch die Finanzämter
- 5. Alternative:. Selbstanzeige §§ 371/ 378 Abs.3 AO
- B Ursachenforschung für den geringen Erfolg des Strafbefreiungserklärungsgesetz (StraBEG). Vergleichende Beispielrechnung:
- 1. Rechnerischer Vorteil des Strafbefreiungserklärungsgesetz
- 2. Praktische Nachteile in der Umsetzung des Strafbefreiungserklärungsgesetz (StraBEG)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Strafbefreiungserklärungsgesetz (StraBEG), das im Jahr 2004 in Kraft trat und bis zum 31. März 2005 galt. Das Gesetz ermöglichte es Bürgern, sich von Strafen, Bußgeldern und Hinterziehungszinsen freizukaufen, indem sie nicht versteuerte Einnahmen freiwillig meldeten und eine pauschale Abgabe zahlten. Ziel der Arbeit ist es, die Funktionsweise des StraBEG zu analysieren, seine Vor- und Nachteile zu beleuchten sowie die Ursachen für seinen geringen Erfolg zu untersuchen.
- Die Funktionsweise des StraBEG
- Die strafbefreiende Erklärung und die Ablass-Steuer
- Die Erlangung der Straf- und Bußgeldbefreiung
- Die Kontrollmöglichkeiten des Fiskus
- Der Vergleich des StraBEG mit der Selbstanzeige
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den Inhalt des Strafbefreiungserklärungsgesetz (StraBEG) und beschreibt die strafbefreiende Erklärung, die pauschale Abgabe, die erlangte Straf- und Bußgeldbefreiung und die Kontrollmöglichkeiten des Fiskus. Des Weiteren werden die Voraussetzungen für eine Selbstanzeige als Alternative zum StraBEG erläutert.
Kapitel B analysiert die Ursachen für den geringen Erfolg des StraBEG. Der Fokus liegt auf den rechnerischen Vorteilen und den praktischen Nachteilen des Gesetzes im Vergleich zur Selbstanzeige.
Schlüsselwörter
Strafbefreiungserklärungsgesetz (StraBEG), Steuerverkürzung, Selbstanzeige, pauschale Abgabe, Ablass-Steuer, Kontrollmöglichkeiten, Finanzamt, Steuerehrlichkeit, Schwarzgeld, Kapitalvermögen, Steueranmeldung.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel des Strafbefreiungserklärungsgesetzes (StraBEG)?
Das StraBEG diente als „Brücke zur Steuerehrlichkeit“. Es ermöglichte Bürgern, bisher nicht versteuerte Einnahmen (Schwarzgeld) straffrei nachzumelden, sofern sie eine pauschale Abgabe zahlten.
Was versteht man unter der sogenannten „Ablass-Steuer“?
Dies ist die pauschale Abgabe, die im Rahmen des StraBEG auf die nachgemeldeten Einnahmen gezahlt werden musste, um Straf- oder Bußgeldfreiheit zu erlangen.
Für welche Steuerarten galt die strafbefreiende Erklärung?
Die Erklärung konnte unter anderem für Einkommensteuer, Erbschaft- und Schenkungsteuer, Vermögensteuer sowie für betriebliche Einnahmen aus „Schwarzgeschäften“ abgegeben werden.
Warum gilt das StraBEG als wenig erfolgreich?
Die Arbeit untersucht Ursachen wie praktische Nachteile in der Umsetzung und vergleicht das Gesetz mit der Alternative der regulären Selbstanzeige nach der Abgabenordnung (AO).
Welche Kontrollmöglichkeiten erhielt der Fiskus durch das Gesetz?
Um zukünftige Steuerehrlichkeit zu sichern, wurden dem Fiskus weitreichende Kontrollmöglichkeiten eingeräumt, wie zum Beispiel der automatisierte Abruf von Konteninformationen.
- Quote paper
- Nadin Schäfer (Author), 2005, Steuerbefreiungserklärung und dessen Wirkung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48137