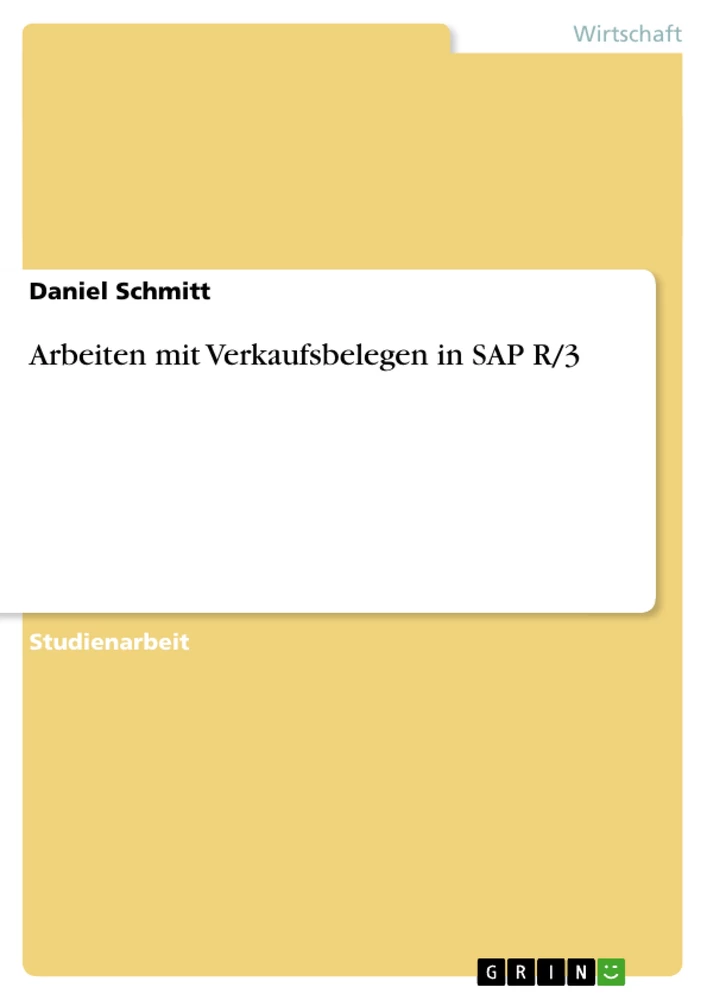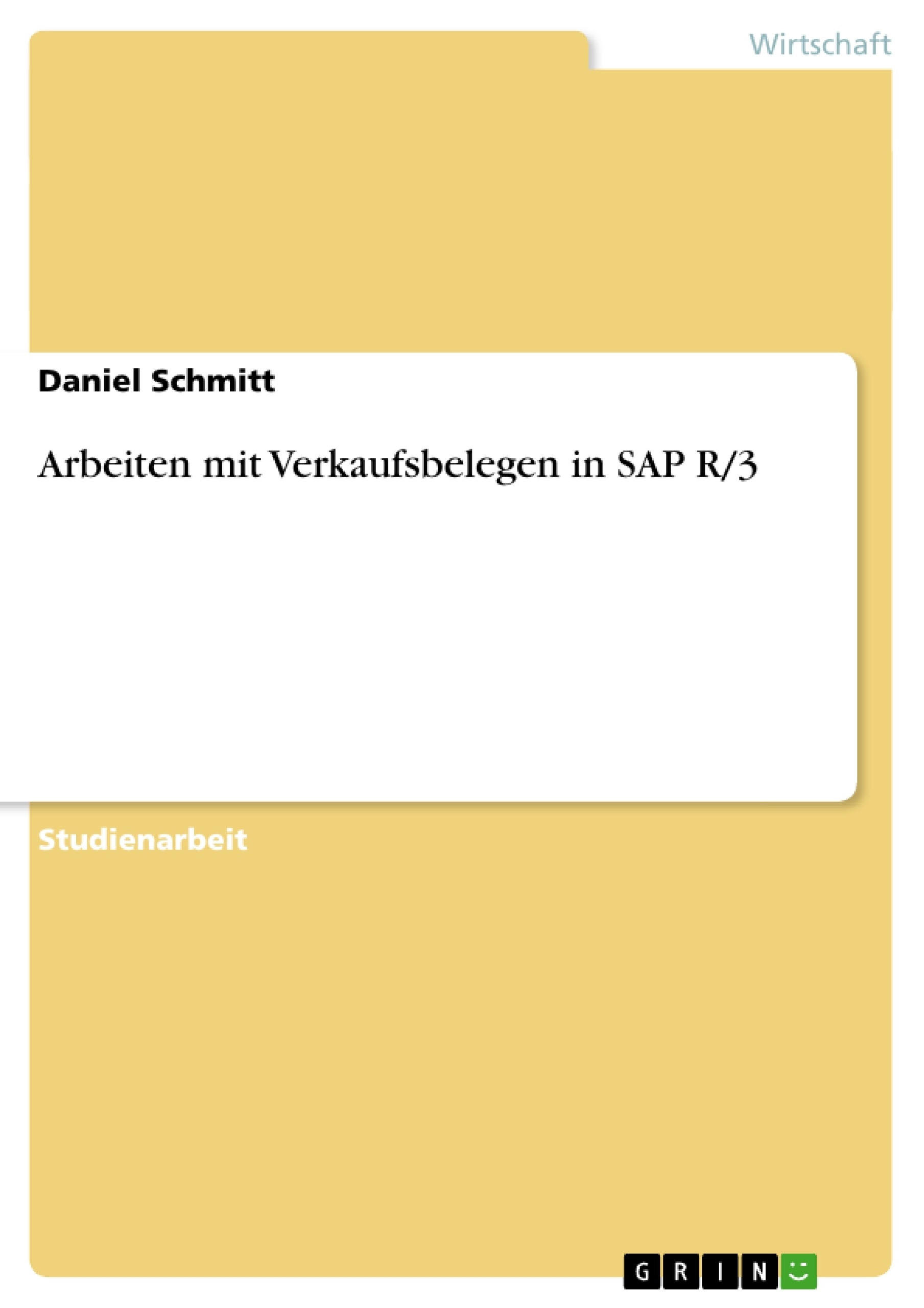Die SAP AG (Software,AnwendungenundProduktein der Datenverarbeitung) hat ihre Unternehmensziele und -strategien darauf ausgerichtet eine einzige
betriebswirtschaftliche Standardsoftware zu entwickeln.
Durch die Abdeckung sämtlicher betriebswirtschaftlicher Bereiche, dem Schaffen von einheitlichen Strukturen mit einer benutzerfreundlichen Bedieneroberfläche wird die Software sowohl für die Industrie, den Dienstleistungssektor als auch den öffentlichen Dienst interessant.
Branchenneutralität und die Berücksichtigung länderspezifischer Anpassungen (unterschiedliche Währungen, Steuern und Bilanzierungsvorschriften) sorgen dafür, dass die Software national und international eingesetzt werden kann. Mit der Umsetzung der vorher genannten Ziele und Anforderungen in die Software SAP R/3 als ein integriertes betriebswirtschaftliches Anwendungssystem startete 1992 der Siegeszug zum weltweit führenden Client/Server-Produkt.1
Das SAP R/3-System kann in unterschiedliche Module untergliedert werden. Die verschiedenen Aufgabenbereic he werden dabei jeweils durch ein eigenes Modul dargestellt:
§Logistikmodule: SD (Vertrieb), MM (Materialwirtschaft), PP
(Produktionsplanung), PM/CS (Instandhaltung und Wartung), QM (Qualitätsmanagement)
§Modul HR: Personalmanagement
§Kaufmännische Module: FI (Finanzbuchhaltung), CO (Controlling), AA (Anlagenbuchhaltung), PS (Projektmanagement)
Zur Optimierung der Prozesse können alle Module miteinander integriert werden. Die Integration der Module führt zur Bildung eines ganzheitlichen Systems. Dadurch können die verschiedenen Aufgabenbereiche optimal erfüllt werden. Durch den Einsatz der betrieblichen Standardsoftware in offenen Systemumgebungen (dies ermöglicht die Vernetzung mit anderen Systemen) können die Geschäftsprozesse der Kunden abgebildet und sichergestellt werden. Da sich die SAP-Kundenunternehmen und die benötigten Module voneinander unterscheiden, können mit Hilfe des Customizing und von Erweiterungen die Prozesse und die dazugehörigen Funktionen den Unternehmensanforderungen angepasst werden.
Nach dieser kurzen Einleitung zur Darstellung des Systems SAP R/3 folgt nun die Beschreibung des Vertriebs über das Modul SD mit dem Schwerpunkt Arbeiten mit Verkaufsbelegen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vertrieb und Modul SD
- Verkaufsbelege
- Struktur von Verkaufsbelegen
- Aufbau und Daten des Verkaufsbelegs
- Herkunft der Daten in Verkaufsbelegen
- Steuerung der Verkaufsbelege
- Gemeinsamkeiten bei der Bearbeitung der Verkaufsbelege
- Kopieren von Belegen
- Vorschlagen von Positionen im Verkaufsbeleg
- Unvollständigkeitsprotokoll
- Materialfindung
- Materiallistung und -ausschluss
- Dynamischer Produktvorschlag
- Cross-Selling
- Statusverwaltung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Einsatz von Verkaufsbelegen im SAP R/3-System und widmet sich insbesondere der Funktionsweise und Bedeutung von Verkaufsbelegen innerhalb des Vertriebsmoduls SD.
- Beschreibung der Struktur und des Aufbaus von Verkaufsbelegen
- Analyse der Datenherkunft und -verwendung in Verkaufsbelegen
- Untersuchung der Steuerung und Bearbeitung von Verkaufsbelegen
- Darstellung der Funktionsweise von Materialfindung und -listung im Kontext von Verkaufsbelegen
- Erörterung der Rolle von Verkaufsbelegen in der Statusverwaltung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das SAP R/3-System als eine integrierte betriebswirtschaftliche Anwendungssoftware vor und beleuchtet die verschiedenen Module, die zur Optimierung von Geschäftsprozessen eingesetzt werden können.
- Vertrieb und Modul SD: Dieses Kapitel definiert den Vertrieb als einen zentralen Bestandteil der betrieblichen Aktivitäten und stellt die im SAP R/3-System dafür genutzte Komponente SD (Sales and Distribution) vor.
- Verkaufsbelege: Dieses Kapitel beschreibt die Bedeutung von Verkaufsbelegen als Dokumentationsmittel für Geschäftsvorfälle im Bereich des Vertriebs. Es beleuchtet die Standardisierung der Geschäftsvorgänge und die Möglichkeiten der automatisierten Bearbeitung von Lieferungen und Fakturen.
- Struktur von Verkaufsbelegen: Dieser Abschnitt analysiert die standardisierte Struktur von Verkaufsbelegen, die die Übertragung relevanter Informationen zwischen den verschiedenen Geschäftsvorgängen (Angebote, Aufträge, Fakturen) ermöglicht.
- Aufbau und Daten des Verkaufsbelegs: Dieses Unterkapitel beschreibt die wichtigsten Datenfelder und Elemente, die in einem Verkaufsbeleg enthalten sind.
- Herkunft der Daten in Verkaufsbelegen: Dieser Teil erläutert die Quellen, aus denen die Daten in Verkaufsbelegen stammen, z.B. Kundendaten, Materialstammdaten und Preislisten.
- Steuerung der Verkaufsbelege: Dieses Unterkapitel beleuchtet die verschiedenen Möglichkeiten der Steuerung von Verkaufsbelegen, wie z.B. die Definition von Freigaben, die Kontrolle von Kreditlimits und die Überwachung der Verfügbarkeit von Materialien.
- Gemeinsamkeiten bei der Bearbeitung der Verkaufsbelege: Dieser Abschnitt befasst sich mit den allgemeinen Vorgehensweisen und Funktionen, die bei der Bearbeitung von Verkaufsbelegen relevant sind.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die folgenden Schlüsselbegriffe und Themengebiete: SAP R/3, Vertriebsmodul SD, Verkaufsbelege, Standardisierung von Geschäftsvorgängen, Datenherkunft, Datenverarbeitung, Materialfindung, Statusverwaltung, Cross-Selling.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das SAP-Modul SD?
SD steht für „Sales and Distribution“ (Vertrieb) und deckt alle Prozesse von der Kundenanfrage über den Auftrag bis hin zur Lieferung und Fakturierung ab.
Wie ist ein Verkaufsbeleg in SAP R/3 aufgebaut?
Ein Verkaufsbeleg besteht aus einem Belegkopf (allgemeine Daten für den gesamten Beleg) und mehreren Positionen (Daten zu den einzelnen Materialien oder Dienstleistungen).
Woher stammen die Daten in einem Verkaufsbeleg?
Die Daten werden automatisch aus Stammdaten (Kundenstamm, Materialstamm) und Konditionssätzen (Preise, Rabatte) in den Beleg übernommen.
Was ist ein Unvollständigkeitsprotokoll?
Es ist eine Funktion, die prüft, ob alle für die Weiterbearbeitung (z. B. Lieferung) notwendigen Daten im Beleg eingetragen wurden.
Was versteht man unter Cross-Selling in SAP SD?
Diese Funktion schlägt dem Sachbearbeiter während der Auftragserfassung automatisch weitere Produkte vor, die zum bestellten Material passen könnten.
- Quote paper
- Daniel Schmitt (Author), 2005, Arbeiten mit Verkaufsbelegen in SAP R/3, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48180