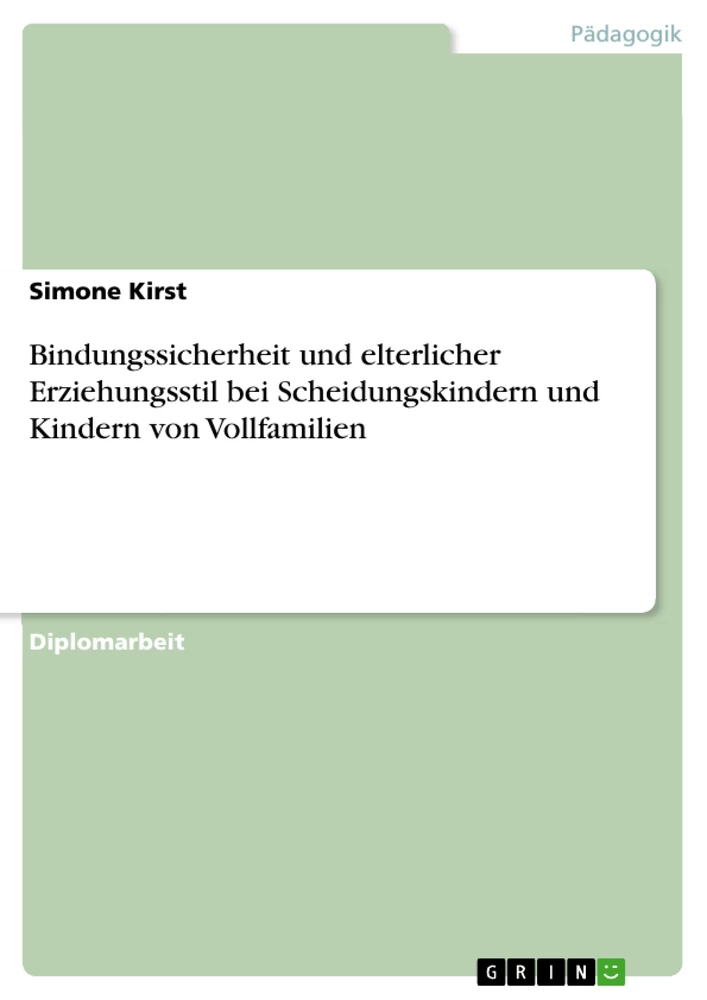Die Scheidungshäufigkeit hat in Deutschland besonders seit Mitte der 60er Jahre erheblich zugenommen. Bleibt die Scheidungsziffer konstant werden ca. 37% der heute geschlossenen Ehen in Scheidung enden. Ca. 50% der geschiedenen Ehepaare haben noch minderjährige Kinder. Aus deren Perspektive ist damit zu rechnen, dass ca. 20% der in den 90er Jahren geborenen Kinder von Ehepaaren vor Erreichen der Volljährigkeit mit der Scheidung ihrer Eltern konfrontiert werden. Damit steigt zugleich die Zahl der Alleinerziehenden in Deutschland an.
"Was bedeutet dies für die Kinder?" Das ist die Frage, die im Rahmen dieser Arbeit an erster Stelle steht. Die Scheidung ist der formalrechtliche, an bestimmte öffentliche Vorschriften gebundene Akt der Eheauflösung. Im Gegensatz zu dieser juristischen Sicht stellt sie sich für die betroffenen Kinder und Familien jedoch nicht als singuläres Ereignis dar, sondern als langwährender komplexer Veränderungs- und Entwicklungsprozess, der eine Vielfalt von Anpassungsleistungen auf verschiedenen Ebenen erfordert.
Da die empirische Scheidungsforschung sich in erster Linie auf den angloamerikanischen Raum konzentriert, hat sich eine Forschungsgruppe um an der Universität Koblenz das Ziel gesetzt in einer Längsschnittstudie das Erleben, Bewerten und Verarbeiten des Trennungs- und Scheidungsgeschehens der Eltern durch die Kinder zu erheben. Dazu werden 6-8 jährige Kinder und ihre Mütter nach der Trennung, sowie weitere zweimal im Abstand von jeweils einem Jahr, zu unterschiedlichen Erlebens- und Verhaltensbereichen befragt. Ein Vergleich der Ergebnisse wird durch die parallele Befragung einer Kontrollgruppe gleichaltriger Kinder aus Familien ohne Scheidungserlebnis ermöglicht. Die hier vorliegende Arbeit entstand im Rahmen der ersten Erhebungswelle dieser Studie. Sie konzentriert sich dabei auf zwei Teilgebiete der umfangreichen Untersuchung. Betrachtet werden die Bindungssicherheit als auch der Erziehungsstil in beiden Familienformen. Die Frage nach möglichen Zusammenhängen zwischen den Aspekten Scheidung, Bindung und Erziehungsstil steht dabei im Vordergrund. Um die Fragestellung in ihren theoretischen Zusammenhang einzubetten, wird sich der erste Teil der Arbeit mit den bisherigen theoretischen Erkenntnissen und empirischen Ergebnissen der drei Themenkomplexe befassen. Nach einer Betrachtung der möglichen Zusammenhänge zwischen diesen Aspekten, schließt sich im empirischen Teil die Auswertung der erhobenen Daten an.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Theoretische Grundlagen
- 1. Trennung und Scheidung und ihre Folgen für die Kinder
- 1.1 Ansätze der Scheidungsforschung
- 1.2 Scheidungsgründe
- 1.3 Der Scheidungsprozess
- 1.4 Die Folgen der Trennung und Scheidung für die betroffenen Kinder
- 1.5 Scheidung als Chance
- 2. Bindungstheorie und -forschung
- 2.1 John Bowlby und die Wurzeln der Bindungstheorie
- 2.2 Die Bindungstheorie
- 2.3 Mary Ainsworth und die Klassifikation der Bindungsqualität
- 2.4 Die Untersuchung der mentalen Bindungs-repräsentation
- 2.5 Phasen der Bindungsentwicklung
- 2.6 Stabilität der Bindungsmodelle
- 2.7 Langfristige Konsequenzen der Bindungs-unterschiede
- 2.8 Bindung und Trennung
- 2.9 Kritische Betrachtung der Bindungstheorie
- 3. Erziehungsstile
- 3.1 Begriffsklärung
- 3.2 Der Einfluss elterlicher Erziehung
- 3.3 Erziehungsstilforschung
- 3.4 Zentrale Erziehungsstildimensionen und das Erziehungsstilmodell nach Diana Baumrind
- 3.5 Wirkung der Erziehungsstile
- 3.6 Determinanten elterlicher Erziehung
- 3.7 Kritische Betrachtung der Erziehungsstilforschung
- 4. Zusammenhänge zwischen den Theorie-bereichen Scheidung, Bindung und Erziehungsstil
- 4.1 Die Auswirkungen einer Scheidung auf die Bindung des Kindes
- 4.2 Die Bedeutung des Erziehungsstils
- 4.3 Das Risiko-Schutz-Modell
- 1. Trennung und Scheidung und ihre Folgen für die Kinder
- III. Empirischer Teil
- 5. Fragestellung
- 6. Methode
- 6.1 Auswahl und Merkmale der Stichprobe
- 6.2 Erhebungsmethoden und ihre Durchführung
- 6.3 Auswertung der Daten
- 7. Ergebnisse
- 7.1 Scheidung der Eltern und Bindung der Kinder
- 7.2 Scheidung der Eltern und kindperzipierter Erziehungsstil
- 7.3 Erziehungsstil und Bindungssicherheit
- 8. Interpretation der Ergebnisse
- 9. Zusammenfassung und Ausblick
- IV. Tabellen- und Abbildungs-verzeichnis
- V. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema der Bindungssicherheit und des elterlichen Erziehungsstils bei Scheidungskindern im Vergleich zu Kindern aus Vollfamilien. Ziel der Arbeit ist es, die Auswirkungen einer Scheidung auf die Bindungsentwicklung von Kindern und den Einfluss des Erziehungsstils auf diese Entwicklung zu untersuchen.
- Einfluss von Scheidung auf die Bindungsentwicklung von Kindern
- Unterschiede im Erziehungsstil in Scheidungsfamilien und Vollfamilien
- Zusammenhang zwischen Erziehungsstil und Bindungssicherheit bei Kindern
- Risiko- und Schutzfaktoren für die Bindungssicherheit von Kindern in Scheidungsfamilien
- Bedeutung der Bindungstheorie für das Verständnis von Scheidungsfolgen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema Scheidung und ihre Auswirkungen auf Kinder. Es wird auf die Zunahme der Scheidungsraten in Deutschland sowie auf die Folgen für die Kinder eingegangen. Anschließend werden die theoretischen Grundlagen der Bindungstheorie und der Erziehungsstilforschung vorgestellt. Die Kapitel beleuchten die Entstehung der Bindungstheorie, die verschiedenen Bindungstypen, die Bedeutung von Erziehungsstilen für die kindliche Entwicklung und den Einfluss des Erziehungsstils auf die Bindungssicherheit von Kindern.
Der empirische Teil der Arbeit beinhaltet die Beschreibung der Forschungsmethode, die Auswahl der Stichprobe und die Auswertung der erhobenen Daten. Die Ergebnisse der Studie werden in Bezug auf den Zusammenhang zwischen Scheidung, Bindungssicherheit und dem Erziehungsstil dargestellt. Die Arbeit schließt mit einer Interpretation der Ergebnisse, einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und einem Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Bindungssicherheit, Scheidung, Erziehungsstil, kindliche Entwicklung, Risiko- und Schutzfaktoren, Bindungstheorie, Scheidungsforschung, Erziehungsstilforschung und empirische Forschung.
- Citar trabajo
- Simone Kirst (Autor), 2004, Bindungssicherheit und elterlicher Erziehungsstil bei Scheidungskindern und Kindern von Vollfamilien, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48239