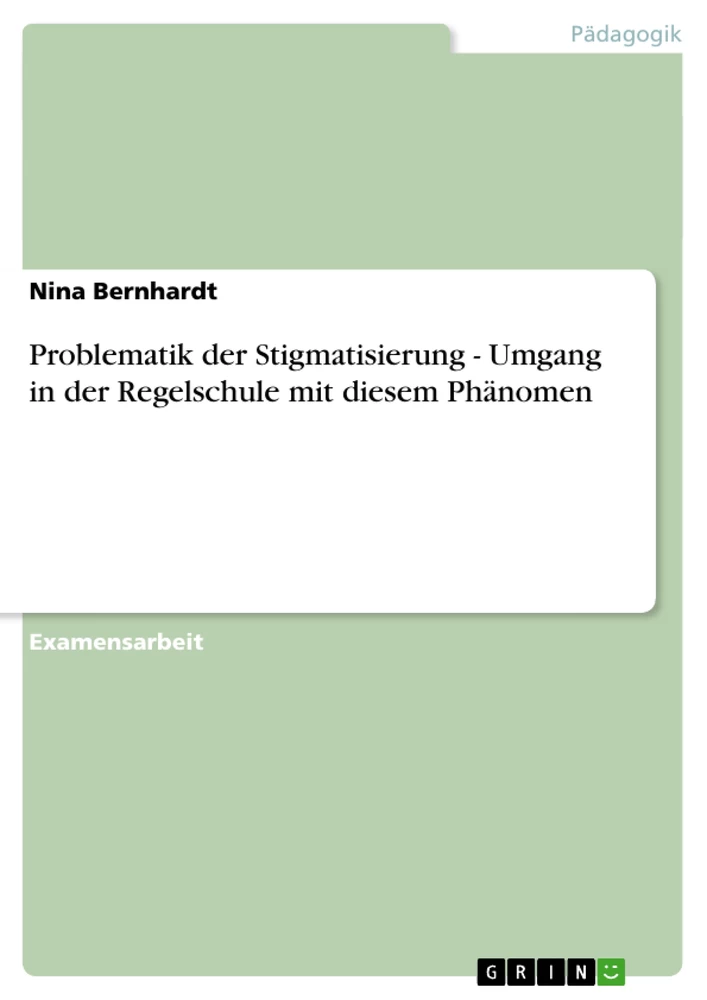Schwerpunktmäßig wird die Stigmatisierung chronisch erkrankter Kinder und Jugendlicher in Schulen untersucht. Dazu wird das Phänomen der Stigmatisierung unter Bezugnahme auf Goffmann analysiert und dessen Funktionen und Auswirkungen auf die Interaktion und Identität erklärt. Dabei wird nicht nur auf den soziologischen Identitätsbegriff von Goffman, sondern auch auf den psychologischen Identitätsbegriff, dessen Entwicklung an Krappmann, Thimm und Frey nachempfunden wird, eingegangen.
Da Schule als Sozialisationsinstanz gesellschaftsspezifische Werte und Normen und damit auch Vorurteile (als Basis für Stigmatisierung) vermittelt, wird die Schule als Lebens- und Lernraum näher betrachtet. Hier lernen Kinder und Jugendliche u.a. den Umgang mit dem Rollenhaushalt und können ihn in der Interaktion mit Gleichaltrigen experimentierend erweitern (Kap. 4.2). Der Rollenhaushalt wird durch Stigmatisierung gefährdet. Wird ein Schüler durch andere stigmatisiert, so ist er prädestiniert dafür, auch viktimisier zu werden. In diesem Zusammenhang wird kurz auf das Zusammenspiel von Gruppengefühl und Außenseiter- bzw. Opferrolle eingegangen (Kap. 5.2.3). Nachdem an ausgewählten Beispielen Stigmatisierungsprozesse in der Schule behandelt wurden, beschäftigt sich der folgende Teil mit der Fragestellung, inwieweit es zu einer Stigmatisierung chronisch erkrankter Kinder in der Schule kommt. Nach einer einleitenden Darstellung chronischer Erkrankungen (Kap. 6), wird zunächst die Überlegung angestellt, welche Auswirkungen chronische Erkrankungen auf die Lebensgestaltung und die Erfüllung von Entwicklungsaufgaben von Kindern und Jugendlichen haben können.
In Kapitel 8 wird untersucht, inwieweit chronisch kranke Kinder Stigmatisierung erleben und das Problem der Selbststigmatisierung thematisiert. Darauf folgt eine Eingrenzung des Themas auf die Stigmatisierung von Krankheiten allgemein und im Schulalltag (Kap. 9). Das Ausmaß der Stigmatisierung chronisch erkrankter Kinder und Jugendlicher wird mit Hilfe einer umfangreichen Befragung (mehrseitige Fragebögen) von Lehrern verschiedener Schulformen (GHRS) recherchiert und analysiert. Von 210 ausgeteilten Fragebogenkomplexen (im Anhang) konnten 78 ausführlich ausgewertet werden. Abschließend werden Handlungsmöglichkeiten zur Integration chronisch erkrankter Schüler aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problemstellung, Zielsetzung und Gang der Untersuchung
- 2. Stigma - Begriffsabgrenzung
- 2.1 Stigma – Doppeldeutigkeit des Begriffs
- 2.2 Unterteilung von Stigmata (nach Goffman)
- 2.3 Stigma – ein relationaler Begriff
- 2.4 Stigma - ein soziales Vorurteil
- 2.5 Merkmale eines Stigmas - zusammengefasst
- 3. Stigmatisierung
- 3.1 Stigmatisierung - ein gesellschaftliches Phänomen
- 3.2 Zur Entstehung von Stigmata – Stigmatisierungsmechanismus
- 3.3 Mögliche Ursachen und Funktionen von Stigmatisierung
- 3.4 Stufen der Stigmatisierung nach Hensle
- 3.4.1 Stigma-Management
- 3.4.2 Störungen der Interaktion nach Goffman
- 3.4.3 Stigma-Durchsetzung: Der Stigma-Ansatz und der Labeling Approach
- 3.5 Auswirkungen der Stigmatisierung auf die sozialen Rollen und die Identität
- 3.6 Darstellung verschiedener Identitätskonzepte in Teilaspekten
- 3.6.1 Das Identitätskonzept von Goffman
- 3.6.2 Weiterführende Identitätskonzepte
- 3.6.3 Das Identitätsmodell von Frey
- 3.6.4 Selbstkonzept, Selbstwertgefühl und Identität
- 3.6.4.1 Die Selbstwahrnehmung
- 3.6.4.2 Die Selbstbewertung
- 3.7 Die beschädigte Identität
- 4. Institutionalisierte Stigmatisierung
- 4.1 Gegenstandsbereiche der Stigmatisierung
- 4.2 Die Schule als Sozialisationsinstanz
- 5. Typisierung und Stigmatisierung in und durch die Schule
- 5.1 Stigmatisierung durch die Zuweisung zu verschiedenen Schultypen
- 5.2 Stigmatisierungsprozesse in der Schule
- 5.2.1 Lehrererwartungen an die Schülerrolle
- 5.2.2 Stereotypbildung - gute und schlechte Schüler
- 5.2.3 Stigmatisierung und Rollenzuschreibung durch die Mitschüler
- 6. Chronische Erkrankungen
- 6.1 Veränderung von Krankheitsbildern in der Gesellschaft
- 6.2 Definition
- 6.3 Epidemiologie
- 7. Bedeutung chronischen Erkrankungen für die Lebensgestaltung und Entwicklung von betroffenen Kindern und Jugendlichen
- 7.1 Mögliche Veränderungen im Leben eines chronisch erkrankten Kindes und seiner Familie
- 7.2 Entwicklungsaufgaben und Krankheitsbewältigung
- 7.3 Bedeutung der Peers im Jugendalter
- 7.4 Psychische Auswirkungen chronischer Erkrankungen
- 8. Stigmatisierung und Stigmatisierungserleben chronisch kranker Jugendlicher
- 8.1 Zusammenhang von chronischen Krankheiten und Stigmata
- 8.2 Stigmatisierungserleben
- 8.3 Selbststigmatisierung
- 8.4 Krankheit als Stigma: Ausgrenzung und Schutz
- 9. Sonderkonditionen und ihre Bedeutung am Beispiel Schule
- 9.1 Vorurteile in der Gesellschaft als Ursache für Stigmatisierungsprozesse
- 9.1.1 Adipositas
- 9.1.2 Hauterkrankungen
- 9.1.3 Epilepsie
- 9.1.4 Psychische Störungen
- 9.2 Bedeutung von Sichtbarkeit bzw. Entstellungsstärke
- 9.3 Grad und Relevanz der Funktionsbeeinträchtigungen
- 9.4 Stigmatisierungsmomente im Schulalltag
- 9.1 Vorurteile in der Gesellschaft als Ursache für Stigmatisierungsprozesse
- 10. Entwicklung des Fragebogens zum Thema Einschätzung von Lehrern zum Integrationsstatus von Krankheit betroffener Schüler
- 10.1 Gliederung und Zielsetzung des Fragebogens
- 10.2 Möglichkeiten und Grenzen der Befragung
- 10.3 Verteilung und Rücklauf
- 11. Auswertung - Einschätzung der Situation chronisch kranker Kinder und Jugendlicher in der Schule
- 11.1 Auswertung der bisherigen Erfahrungen der Lehrer
- 11.1.1 Durch Lehrer wahrgenommene chronischen Beeinträchtigungen während ihrer Schultätigkeit
- 11.1.2 Chronische Beeinträchtigungen die zu besonderer Unterstützung im Klassenverband führen
- 11.1.3 Erkrankungsbedingte Diskriminierung
- 11.2 Auswertung der Einzelfallbeschreibungen der Lehrer
- 11.2.1 Umgang der Mitschüler mit einem physisch oder psychisch erkrankten oder beeinträchtigten Kind
- 11.2.2 Ursachen für das Verhalten der Mitschüler
- 11.2.2.1 Aussehen oder Entstellungsgrad
- 11.2.2.2 Persönlichkeit und Verhalten
- 11.2.2.3 Sichtbarkeit
- 11.3 Reflexionen zu einzelnen Fragebögen
- 11.4 Inwieweit hilft Vertrautheit und persönlicher Kontakt über ein Stigma hinweg bzw. ist Schule anonym genug, damit Stereotype gebildet werden und erhalten bleiben?
- 11.1 Auswertung der bisherigen Erfahrungen der Lehrer
- 12. Integrationsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen mit krankheitsbedingter Andersartigkeit
- 12.1 Abbau von Vorurteilen bei Lehrern
- 12.2 Abbau von Vorurteilen der Mitschüler
- 12.2.1 Aufklärung und Thematisierung im Klassenverband
- 12.2.2 Soziales Lernen im Rollenspiel
- 12.2.3 Klassenübergreifende Projekte
- 12.3 Differenzierung des schulischen Krankheitsbegriffs
- 12.4 Unterstützung der Wiedereingliederung bei längeren Fehlzeiten durch Krankenhaus- oder Psychiatrieaufenthalte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Problematik der Stigmatisierung von chronisch kranken Schülern im Schulkontext. Ziel ist es, die Auswirkungen von Stigmatisierung auf die betroffenen Schüler und deren Integration in die Schulklasse zu analysieren und mögliche Interventionsstrategien zu entwickeln.
- Stigmatisierungsprozesse in der Schule
- Auswirkungen chronischer Erkrankungen auf die soziale Integration
- Rollen von Lehrern und Mitschülern bei der Stigmatisierung
- Strategien zur Reduktion von Stigmatisierung
- Identitätsentwicklung chronisch kranker Schüler
Zusammenfassung der Kapitel
1. Problemstellung, Zielsetzung und Gang der Untersuchung: Diese Einleitung beschreibt den Forschungsgegenstand, die Zielsetzung der Arbeit und die methodischen Vorgehensweisen. Es wird die Relevanz der Thematik hervorgehoben und der methodische Aufbau der Arbeit skizziert, der auf einer Literaturanalyse, der Entwicklung eines Fragebogens und der Auswertung der Ergebnisse basiert.
2. Stigma - Begriffsabgrenzung: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Definition des Begriffs "Stigma" unter Berücksichtigung verschiedener theoretischer Ansätze, insbesondere der Arbeiten von Goffman. Es werden verschiedene Arten von Stigmata unterschieden und die relationalen und sozialen Aspekte des Konstrukts beleuchtet. Die zentralen Merkmale eines Stigmas werden herausgearbeitet und für das weitere Verständnis der Arbeit fundiert.
3. Stigmatisierung: Dieses Kapitel analysiert den Prozess der Stigmatisierung als gesellschaftliches Phänomen. Es werden die Entstehung von Stigmata, mögliche Ursachen und Funktionen sowie die Stufen der Stigmatisierung nach Hensle erörtert. Die Auswirkungen auf soziale Rollen und Identität werden eingehend untersucht, mit besonderem Fokus auf die Identitätskonzepte von Goffman und Frey. Der Einfluss der Stigmatisierung auf das Selbstkonzept und Selbstwertgefühl der Betroffenen wird ebenfalls thematisiert.
4. Institutionalisierte Stigmatisierung: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle von Institutionen, insbesondere der Schule, bei der Stigmatisierung. Es wird die Schule als Sozialisationsinstanz betrachtet und der Beitrag der Institution zur Reproduktion und Verstärkung von Stigmata untersucht. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Schule als Ort, an dem Stigmatisierungsprozesse besonders sichtbar und wirksam werden können.
5. Typisierung und Stigmatisierung in und durch die Schule: Dieses Kapitel analysiert detailliert die Mechanismen der Stigmatisierung innerhalb des Schulkontexts. Es wird der Einfluss von Schultypen, Lehrererwartungen, Stereotypenbildung und der Interaktion mit Mitschülern auf die Stigmatisierung von Schülern untersucht. Die Rolle von Vorurteilen und Rollenzuschreibungen in der Entstehung und Aufrechterhaltung von Stigmata wird kritisch beleuchtet.
6. Chronische Erkrankungen: Dieses Kapitel behandelt die Definition und Epidemiologie von chronischen Erkrankungen und betrachtet deren Veränderungen im gesellschaftlichen Kontext. Es legt die Grundlagen für die spätere Betrachtung des Zusammenhangs zwischen chronischer Erkrankung und Stigmatisierung.
7. Bedeutung chronischer Erkrankungen für die Lebensgestaltung und Entwicklung von betroffenen Kindern und Jugendlichen: Dieses Kapitel analysiert die weitreichenden Auswirkungen chronischer Erkrankungen auf das Leben von Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien. Es untersucht die Herausforderungen bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und Krankheit, die Bedeutung von Peer-Gruppen, sowie mögliche psychische Folgen. Es wird die Komplexität des Zusammenlebens von Krankheit und sozialer Integration erörtert.
8. Stigmatisierung und Stigmatisierungserleben chronisch kranker Jugendlicher: In diesem Kapitel wird der enge Zusammenhang zwischen chronischen Erkrankungen und Stigmatisierungserleben bei Jugendlichen untersucht. Es werden verschiedene Facetten des Stigmatisierungserlebens beleuchtet, darunter auch die Selbststigmatisierung. Die Aspekte von Ausgrenzung und Schutzmechanismen werden analysiert.
9. Sonderkonditionen und ihre Bedeutung am Beispiel Schule: Dieses Kapitel untersucht die konkreten Stigmatisierungsmomente im Schulalltag im Kontext von chronischen Erkrankungen. Es werden verschiedene Krankheitsbilder wie Adipositas, Hauterkrankungen, Epilepsie und psychische Störungen exemplarisch betrachtet und die Bedeutung von Sichtbarkeit und Funktionsbeeinträchtigungen für die Stigmatisierung analysiert.
Schlüsselwörter
Stigmatisierung, chronische Erkrankungen, Schule, Integration, Inklusion, Identität, Selbstwertgefühl, Lehrererwartungen, Mitschüler, Vorurteile, Sozialisation, Identitätskonzept, Goffman, Labeling Approach.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Stigmatisierung chronisch kranker Schüler im Schulkontext
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Stigmatisierung chronisch kranker Schüler im Schulkontext. Sie analysiert die Auswirkungen dieser Stigmatisierung auf die betroffenen Schüler und deren Integration in die Schulklasse und entwickelt mögliche Interventionsstrategien.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Stigmatisierungsprozesse in der Schule, Auswirkungen chronischer Erkrankungen auf die soziale Integration, die Rollen von Lehrern und Mitschülern bei der Stigmatisierung, Strategien zur Reduktion von Stigmatisierung und die Identitätsentwicklung chronisch kranker Schüler.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel. Zunächst wird der Begriff "Stigma" umfassend definiert und der Stigmatisierungsprozess analysiert. Es folgen Kapitel zur institutionalisierten Stigmatisierung in der Schule, zur Typisierung und Stigmatisierung von Schülern im Schulkontext, sowie zur Bedeutung chronischer Erkrankungen für die Lebensgestaltung betroffener Kinder und Jugendlicher. Ein eigenes Kapitel befasst sich mit der konkreten Stigmatisierungserfahrung chronisch kranker Jugendlicher. Die Arbeit beinhaltet außerdem die Entwicklung und Auswertung eines Fragebogens zur Einschätzung der Situation durch Lehrer und schließlich die Vorstellung von Integrationsmöglichkeiten.
Was ist der Fokus des Kapitels "Stigma - Begriffsabgrenzung"?
Dieses Kapitel liefert eine umfassende Definition des Begriffs "Stigma" basierend auf verschiedenen theoretischen Ansätzen, insbesondere den Arbeiten von Goffman. Es differenziert verschiedene Arten von Stigmata und beleuchtet die relationalen und sozialen Aspekte des Konstrukts. Die zentralen Merkmale eines Stigmas werden für das Verständnis der weiteren Arbeit fundiert.
Wie wird Stigmatisierung im Schulkontext analysiert?
Die Arbeit analysiert die Mechanismen der Stigmatisierung innerhalb des Schulkontexts detailliert. Sie untersucht den Einfluss von Schultypen, Lehrererwartungen, Stereotypenbildung und der Interaktion mit Mitschülern auf die Stigmatisierung von Schülern. Die Rolle von Vorurteilen und Rollenzuschreibungen in der Entstehung und Aufrechterhaltung von Stigmata wird kritisch beleuchtet.
Welche Rolle spielen chronische Erkrankungen?
Die Arbeit analysiert die weitreichenden Auswirkungen chronischer Erkrankungen auf das Leben von Kindern und Jugendlichen und deren Familien. Sie untersucht die Herausforderungen bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und Krankheit, die Bedeutung von Peer-Gruppen und mögliche psychische Folgen. Der enge Zusammenhang zwischen chronischen Erkrankungen und Stigmatisierungserleben bei Jugendlichen wird untersucht, inklusive Selbststigmatisierung und Aspekten der Ausgrenzung und Schutzmechanismen.
Wie wird der Fragebogen eingesetzt?
Die Arbeit beinhaltet die Entwicklung eines Fragebogens zur Einschätzung der Situation chronisch kranker Kinder und Jugendlicher in der Schule aus der Sicht der Lehrer. Die Auswertung dieses Fragebogens liefert wichtige Erkenntnisse über die wahrgenommenen chronischen Beeinträchtigungen, den Umgang mit diesen und mögliche Diskriminierungserfahrungen.
Welche Integrationsmöglichkeiten werden vorgestellt?
Die Arbeit schlägt verschiedene Integrationsmöglichkeiten vor, um die Stigmatisierung chronisch kranker Schüler zu reduzieren. Dies umfasst Strategien zum Abbau von Vorurteilen bei Lehrern und Mitschülern (z.B. Aufklärung, soziales Lernen, Projekte), die Differenzierung des schulischen Krankheitsbegriffs und die Unterstützung der Wiedereingliederung nach längeren Fehlzeiten.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Stigmatisierung, chronische Erkrankungen, Schule, Integration, Inklusion, Identität, Selbstwertgefühl, Lehrererwartungen, Mitschüler, Vorurteile, Sozialisation, Identitätskonzept, Goffman, Labeling Approach.
- Citation du texte
- Nina Bernhardt (Auteur), 2003, Problematik der Stigmatisierung - Umgang in der Regelschule mit diesem Phänomen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48240