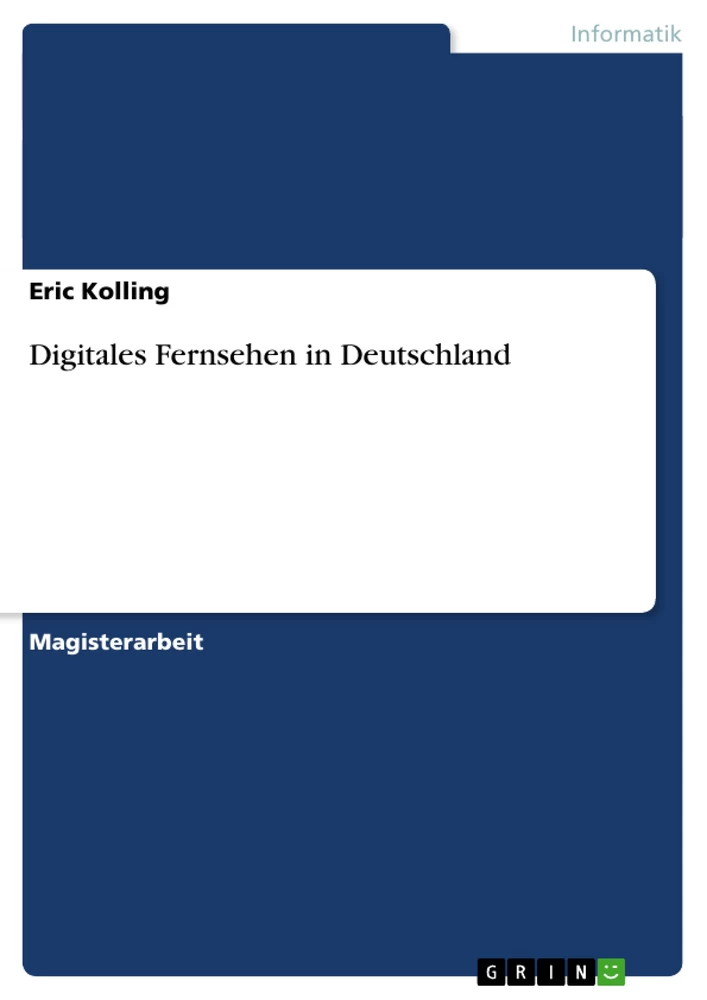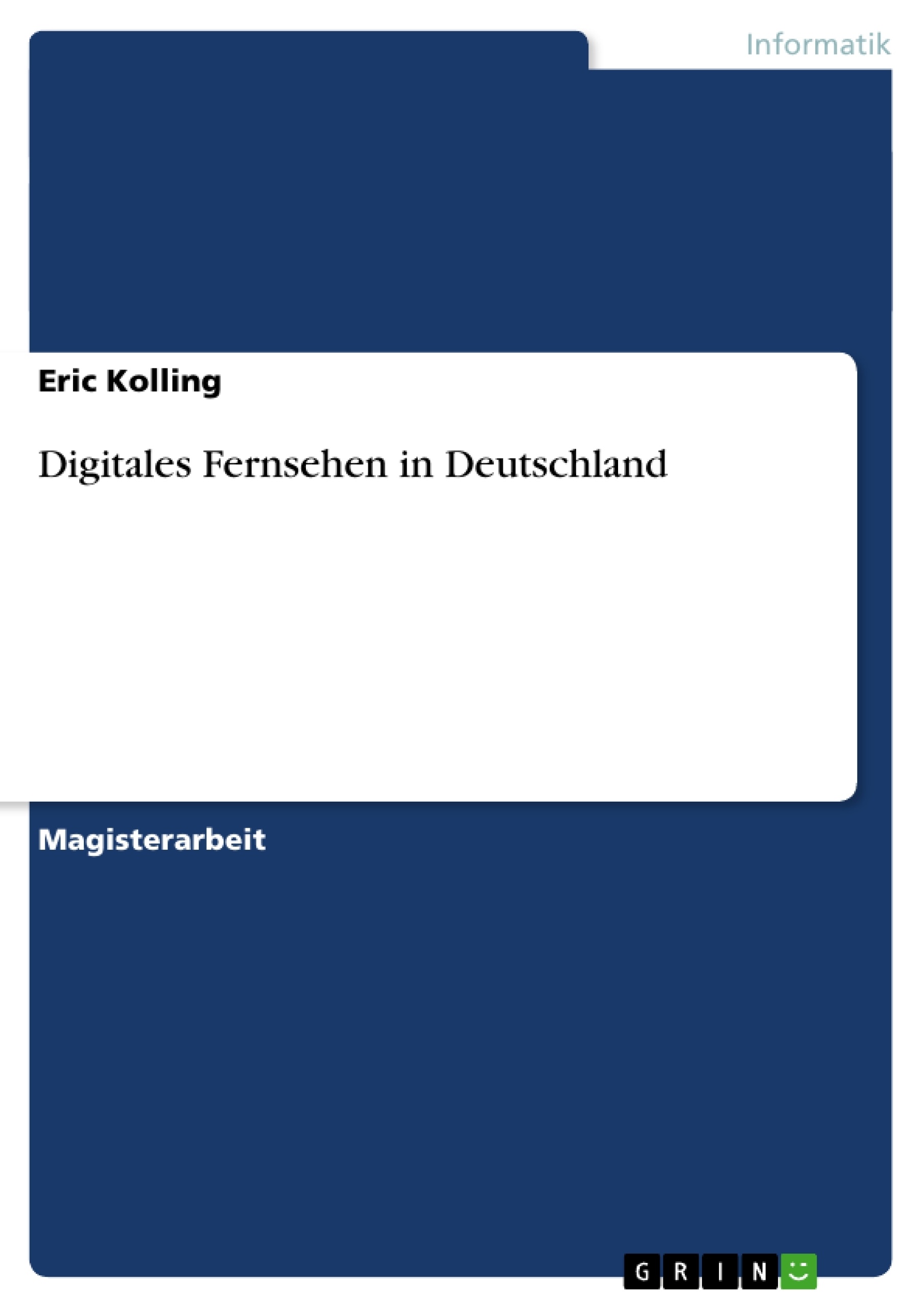Seit Mitte der neunziger Jahre hat sich die Medienlandschaft infolge des großen Fortschritts der Informations- und Kommunikationstechnologien gewandelt. Eine wichtige Änderung war hierbei die Digitalisierung von Fernsehsignalen. Für die Wissenschaft eröffnete die Digitalisierung des Fernsehens vielfältige Forschungsfelder. Anfang bis Mitte der 90er Jahre stand die theoretische Perspektive im Mittelpunkt – vor allem kommunikationswissenschaftliche Aspekte waren dabei von Interesse. Im Zentrum der Diskussion ging es schwerpunktmäßig um Fragen, die sich mit der Änderung des Mediennutzungsverhaltens sowie der Änderung des Fernsehens im Allgemeinen beschäftigten. Vor allem ging es um die Frage, ob eine „interaktivere“ Form des Fernsehens den Zuschauer zu mehr Eigenbeteiligung würde bewegen können.
Auch acht Jahre nach seiner Einführung bleibt das digitale Fernsehen immer noch ein intensives Forschungsfeld. Allerdings sind medientheoretische Fragen mittlerweile gegenüber konkreten rechtlichen, politischen und ökonomischen Aspekten in den Hintergrund getreten. Denn die Digitalisierung hat sich in Deutschland bereits auf mehrere Bereiche ausgewirkt: auf die Medienpolitik, die Rechtsprechung oder – bei den Programmveranstaltern - auf wirtschaftliche Strategien und redaktionelle Entscheidungen. Der Nutzer ist bisher in vergleichsweise geringen Kontakt mit digitalem Fernsehen gekommen: Nach Angaben der Société Européenne des Satellites (SES, deutsch: Europäische Satellitengesellschaft) ASTRA1 betrug der Anteil deutscher Haushalte mit einer Empfangsmöglichkeit für digitales Fernsehens Ende 2004 19,62 Prozent. Kein Wunder also, dass CORSA bereits 2004 als eines der Ergebnisse ihrer Habilitation zur Programmstruktur des digitalen Fernsehens formulierte: “Digitale Fernsehnutzung war in seinen Anfangsjahren 1996 bis 2002 in Deutschland eine Ausnahme.“ (CORSA, 2004, S. 436). Andere Länder in Europa waren nach HAAS (2004, S.524) diesbezüglich Ende 2004 schon wesentlich weiter, wie England mit 54 % digitaltauglichen Fernsehhaushalten, Irland (35 %) oder Schweden (28 %)2.
Der Statistik-Experte und Journalist des Westdeutschen Rundfunks (WDR) SCHÖNENBORN skizzierte die Situation 2004 für Zuschauer und Programmanbieter – zumindest für die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (ARD) – mit folgenden Sätzen: „Die Digitalisierung unserer Programmverbreitung ist kein Thema, das in den Redaktionen unserer Häuser unter den Nägeln brennt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Hinführung zum Thema
- 1.2. Zielsetzung
- 1.3. Einschränkungen
- 1.4. Aufbau der Arbeit
- 2. Grundlagen zum Betrachtungsgegenstand
- 2.1. Verwendung des Begriffes „digitales Fernsehen“
- 2.2. Historische Einordnung des digitalen Fernsehens in die Fernsehentwicklung Deutschlands
- 2.3. Veränderungen im Ausstrahlungsprozess
- 2.4. Empfangsgeräte für digitale Fernsehsignale
- 2.5. Angebotspalette des digitalen Fernsehens
- 2.5.1. Bezahlfernsehen
- 2.5.2. Bouquets
- 2.5.3. Ein- und Mehrkanalprogramme
- 2.5.4. Einwegdienste
- 2.5.5. Abruf-, Dialog- und interaktive Dienste
- 2.5.6. Internet auf dem Fernsehschirm
- 2.6. Übertragungswege
- 2.6.1. Fernsehkabel
- 2.6.2. Satellit
- 2.6.3. Terrestrik
- 2.6.4. Sonstige
- 2.7. Künftige Potentiale der Übertragungswege
- 2.8. Verbreitung digitaler Empfangsgeräte
- 2.9. Zusammenfassung
- 3. Gesetzliche Regelungen und Umstiegsszenarien
- 3.1. Rechtlicher Rahmen für Fernsehen in Deutschland
- 3.1.1. Rundfunkrechtliche Aspekte
- 3.1.2. Regulierung
- 3.2. Umstiegszenarien
- 3.3. Entwicklung im Kabelmarkt
- 3.3.1. Schleppender Verkauf der Telekom-Netze
- 3.3.2. Monopolisierungsstrategie der Kabel Deutschland GmbH
- 3.3.3. Finanzierungsaspekte beim Kabelnetz
- 3.4. Nutzerrelevante Betrachtungen
- 3.4.1. Allgemeine Überlegungen
- 3.4.2. Wechsel in Berlin/Brandenburg
- 3.4.3. Bisherige Resonanz auf Zusatzdienste
- 3.5. Zusammenfassung
- 3.1. Rechtlicher Rahmen für Fernsehen in Deutschland
- 4. Ökonomische Gesichtspunkte zum digitalen Fernsehen
- 4.1. Zum Fernsehmarkt
- 4.2. Entwicklung auf dem Fernsehmarkt im Kontext der Digitalisierung
- 4.3. Bezahlfernsehen und Digitalisierung
- 4.4. Kostenaspekte der Digitalisierung aus Sicht der Programmanbieter
- 4.4.1. Auswirkungen auf die Finanzierung der Programmanbieter
- 4.4.2. Erweiterung der Wertschöpfungskette
- 4.4.3. Konzentrationsprozesse im Fernsehsektor
- 4.4.4. Kooperationsmodelle der Programmanbieter mit den Kabelnetzbetreibern
- 4.4.5. Gestaltung von Navigationssystemen
- 4.5. Auswirkungen der Digitalisierung auf das inhaltliche Angebot
- 4.5.1. ARD
- 4.5.2. ZDF
- 4.5.3. RTL World und ProSiebenSat.1 Media AG
- 4.5.4. Premiere
- 4.5.5. Kabelnetzbetreiber
- 4.6. Problemfeld Set-Top-Box
- 4.6.1. Conditional Access
- 4.6.2. Middleware
- 4.7. Zusammenfassung
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des digitalen Fernsehens in Deutschland. Sie beleuchtet die technologischen, rechtlichen, ökonomischen und gesellschaftlichen Aspekte des digitalen Fernsehens. Die Arbeit soll einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen und Trends im digitalen Fernsehmarkt geben.
- Die technologischen Grundlagen des digitalen Fernsehens
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen für das digitale Fernsehen
- Die ökonomischen Herausforderungen der Digitalisierung im Fernsehsektor
- Die Auswirkungen des digitalen Fernsehens auf das Programm- und Inhaltsangebot
- Die Rolle der Nutzer und deren Akzeptanz des digitalen Fernsehens
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung führt in das Thema digitales Fernsehen ein und erläutert die Zielsetzung, Einschränkungen und den Aufbau der Arbeit.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel beleuchtet die grundlegenden Technologien, die dem digitalen Fernsehen zugrunde liegen, sowie die historische Einordnung des digitalen Fernsehens in die deutsche Fernsehentwicklung. Es werden die verschiedenen Übertragungswege, die Angebotspalette und die Empfangsgeräte für digitale Fernsehsignale dargestellt.
- Kapitel 3: Das Kapitel befasst sich mit den rechtlichen Regelungen und den Umstiegsszenarien zum digitalen Fernsehen in Deutschland. Hier werden die rundfunkrechtlichen Aspekte, die Regulierung des Fernsehmarktes und die Entwicklungen im Kabelmarkt behandelt.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel analysiert die ökonomischen Gesichtspunkte des digitalen Fernsehens. Es untersucht die Entwicklungen auf dem Fernsehmarkt im Kontext der Digitalisierung und die Kostenaspekte der Digitalisierung aus Sicht der Programmanbieter.
Schlüsselwörter
Digitales Fernsehen, Digitalisierung, Fernsehmarkt, Rechtliche Rahmenbedingungen, Ökonomische Aspekte, Angebotspalette, Übertragungswege, Empfangsgeräte, Nutzerakzeptanz, Programmanbieter, Kabelnetzbetreiber, Set-Top-Box, Conditional Access, Middleware.
Häufig gestellte Fragen
Wann begann die Digitalisierung des Fernsehens in Deutschland?
Die Einführung des digitalen Fernsehens startete Mitte der 90er Jahre, wobei die Nutzung bis etwa 2002 noch eine Ausnahme darstellte.
Welche Übertragungswege für digitales Fernsehen gibt es?
Die wichtigsten Wege sind Satellit, Fernsehkabel und terrestrische Übertragung (DVB-T).
Was sind die Vorteile von digitalem Fernsehen gegenüber analogem?
Vorteile sind eine höhere Programmvielfalt (Bouquets), Zusatzdienste wie interaktives Fernsehen und Internet auf dem Schirm.
Was versteht man unter „Conditional Access“?
Es handelt sich um Verschlüsselungssysteme für Bezahlfernsehen (Pay-TV), die den Zugang zu bestimmten Programmen regeln.
Warum war die Verbreitung in Deutschland anfangs langsamer als in England?
Während 2004 in England bereits 54 % der Haushalte digital ausgestattet waren, betrug die Quote in Deutschland nur knapp 20 %.
- Quote paper
- Eric Kolling (Author), 2005, Digitales Fernsehen in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48285