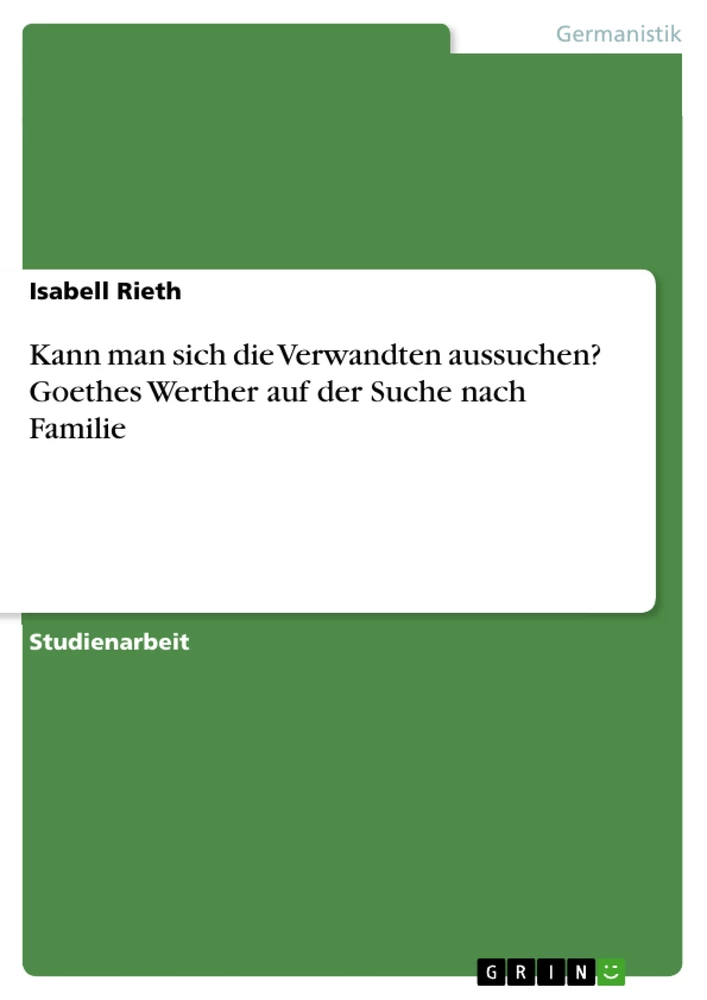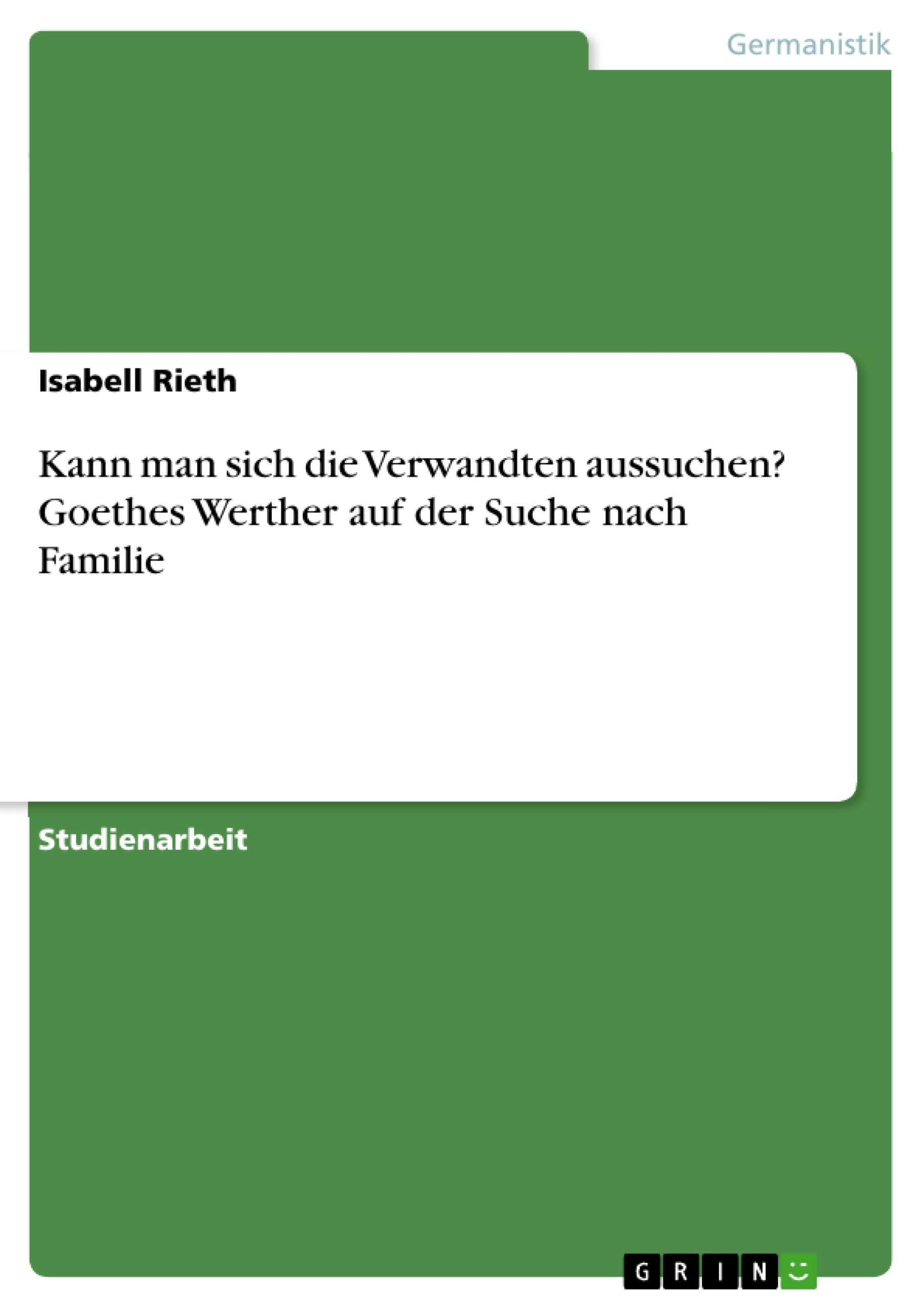Die Literaturlandschaft der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erfuhr einen starken Einfluss durch die Auffassung der Familie als natürlichen Ursprung menschlicher Zusammengehörigkeit und als Gegenpart zum gesellschaftlich-öffentlichen Leben. Die Familie wurde verherrlicht als innige und emotionalisierte Vereinigung. Sobald die Auffassung der Familie als patriarchalische Institution und Teil des profitorientierten gesellschaftlichen Lebens auftritt, erfährt das Konzept der Familie jedoch eine negative Konnotation und gilt als Verkörperung einer bürgerlich-kapitalistischen Ökonomie, die freiheitliche Triebe zu unterdrücken versucht. In dieser Arbeit wird das Konzept der Familie in Goethes Werk "Die Leiden des jungen Werthers" aus dem Jahr 1774 untersucht.
Goethes Werther gilt als Paradebeispiel für die literarische Auseinandersetzung mit der Zugehörigkeit zu und Integration in verschieden ausgelegte familiäre Verbände, deren Definition sich zwischen patrilinearem, gesellschaftlichen Zwang und natürlicher, emotionalisierter Verbindung bewegt. Werthers Versuch, sich nach der Trennung von der eignen mangelhaften, genetischen Familie in eine von gesellschaftlichen Normen losgelöste, vorzugsweise weiblich orientierte Familie einzugliedern geht einher mit seinem Drang, einer reinen Gefühlsgemeinschaft anzugehören und selbst eine befreite Kindheit nachzuempfinden. Im Nachfolgenden soll daher Werthers imaginärer Verwandtschaftsgrad in Lottes Familie erläutert werden, wobei zunächst Lottes Rolle als Mutter dargelegt wird. Nachfolgend soll Werthers Bezug zur Kindheit einerseits als Vaterfigur, andererseits als in die Kindheit zurückversetzter Sohn Lottes beleuchtet werden. Eine Verbindung erotischer Natur wird daraufhin durch das Erörtern des Phantasmas um Lotte, sowie mögliche erotische Spannungen zwischen Lotte und Werther aufgezeigt. Schlussendlich wird analysiert, inwiefern Werthers Verlangen nach einer Eingliederung in eine potenzielle Idealfamilie befriedigt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lotte: Eine Mutter für die Mutterlosen
- Werther in der Vaterrolle
- Werther als Kind...
- Werther als Liebesanwärter: Die Beziehung zwischen Lotte und Werther
- Lotte als Phantasma...
- Erotische Spannungen zwischen Lotte und Werther.
- Der Untergang der phantasierten Familie
- Schluss.....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzeption von Familie in Goethes „Die Leiden des jungen Werther" im Kontext der literarischen und gesellschaftlichen Debatten des 18. Jahrhunderts. Insbesondere wird Werthers Suche nach einer idealen, emotionalisierten Familienstruktur im Gegensatz zu seiner eigenen dysfunktionalen Familie analysiert.
- Die Rolle der Familie als natürliche und gesellschaftliche Institution
- Die Idealisierung der Familie als Ort der Liebe und Geborgenheit
- Die Kritik an der patriarchalischen Struktur der Familie
- Die Bedeutung der Kindheit und Jugend in der literarischen Darstellung der Familie
- Werthers Suche nach einer neuen Familie in Lottes Umfeld
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen Überblick über die Bedeutung der Familie in der Literatur des 18. Jahrhunderts und die unterschiedlichen Interpretationen des Konzepts.
Kapitel 2 analysiert Lottes Rolle als Mutterfigur für ihre Geschwister und Werther. Es wird argumentiert, dass Lotte eine wichtige Rolle in Werthers Bemühen spielt, eine neue Familie zu finden, die die Defizite seiner eigenen Familie ausgleicht.
Kapitel 3 untersucht Werthers Beziehung zu Lotte. Es wird untersucht, wie Werther Lotte als Objekt seiner Sehnsüchte und als Phantasma idealisierter Liebe betrachtet. Die Rolle der Erotik in ihrer Beziehung wird ebenfalls diskutiert.
Kapitel 4 beleuchtet die Schwierigkeiten und letztendlichen Fehlschläge von Werthers Versuch, in Lottes Familie integriert zu werden. Das Kapitel zeigt auf, wie die idealisierte Vorstellung von einer Familie letztendlich den Anforderungen der realen Welt zum Opfer fällt.
Schlüsselwörter
Familie, Werther, Lotte, Kindheit, Roman, 18. Jahrhundert, Literatur, Gesellschaft, Patriarchat, Liebe, Sehnsucht, Ideal, Realität, Emotion, Gefühl.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Familie in Goethes „Werther“ dargestellt?
Familie wird einerseits als Ort emotionaler Geborgenheit idealisiert, andererseits als patriarchalische Institution kritisiert, die individuelle Freiheit unterdrückt.
Warum sucht Werther Anschluss an Lottes Familie?
Werther empfindet seine eigene genetische Familie als mangelhaft und sucht in Lottes Umfeld nach einer reinen Gefühlsgemeinschaft und einer idealisierten Kindheit.
Welche Rolle nimmt Lotte für Werther ein?
Lotte fungiert für Werther sowohl als mütterliche Figur als auch als Objekt seiner erotischen Sehnsucht und als Phantasma einer idealen Partnerin.
Nimmt Werther in Lottes Familie eine Vaterrolle ein?
Die Arbeit beleuchtet Werthers Bezug zu Lottes Geschwistern, in dem er zeitweise eine väterliche Rolle einnimmt, während er sich gleichzeitig selbst als Sohn Lottes fantasiert.
Warum scheitert Werthers Versuch, sich in die Idealfamilie einzugliedern?
Das Scheitern liegt an der Unvereinbarkeit seiner idealisierten Vorstellungen mit den realen gesellschaftlichen Normen und der bestehenden Ehe zwischen Lotte und Albert.
- Arbeit zitieren
- Isabell Rieth (Autor:in), 2017, Kann man sich die Verwandten aussuchen? Goethes Werther auf der Suche nach Familie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/484306