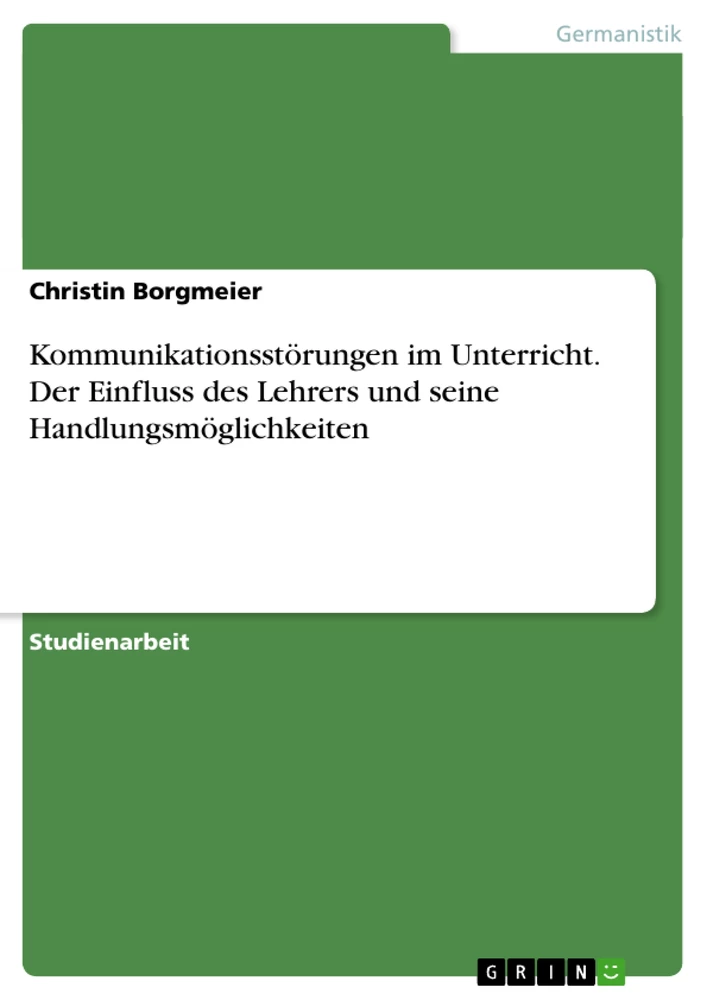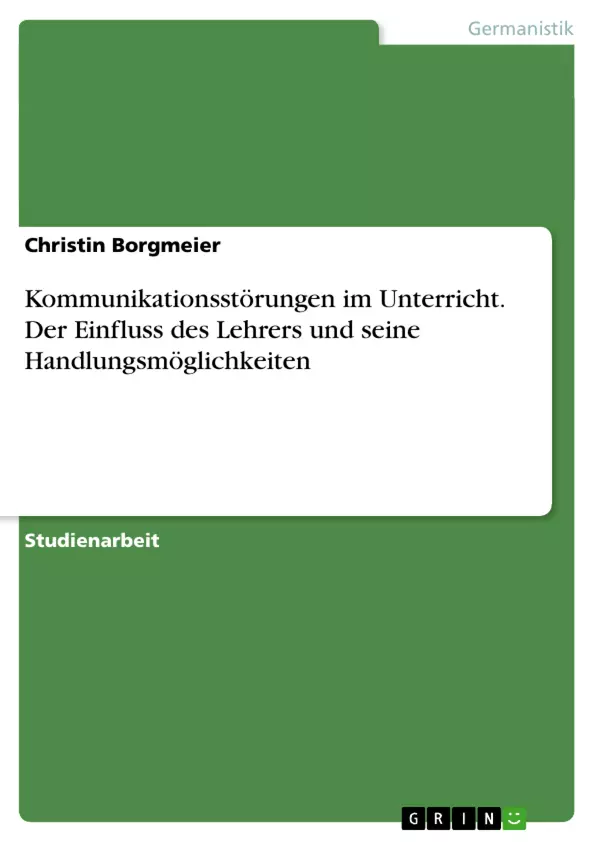Störungen der Unterrichtskommunikation beeinträchtigen die Lerneffizienz, die Arbeitsatmosphäre und sind einfach ungemein belastend. Tagtäglich werden Lehrer wie Schüler davon in negativer Weise beeinflusst; neben der Behinderung des Lehr-Lern- Prozesses können vor allem auch psychische Beschwerden auftreten. Welche Faktoren aber spielen dabei eventuell eine Rolle? Welche Voraussetzungen müssten grundsätzlich gegeben sein, um eine angemessene Atmosphäre für die Kommunikation im Unterricht bereitzustellen? Gibt es eigentlich sinnvolle Möglichkeiten, um Kommunikationsstörungen zu vermindern oder gar zu vermeiden? Wo wären Ansätze zur Verbesserung möglich?
Im Folgenden soll zunächst einmal der Bereich der Störungen analysiert werden, wobei ein deutlicher Schwerpunkt auf der Funktion des Lehrers liegen wird, dessen Verhaltensweisen und Einstellungen zu Schülern, Unterricht und Schule genauer betrachtet werden sollen. Wo liegen gravierende Fehlerquellen des Lehrers vor allem im Umgang mit seinen Schülern? Welches sind die Gründe und Ursachen für ein Misslingen der Kommunikation im Unterricht? Bei dieser Untersuchung werden weiter - jedoch nur peripher - das Einwirken institutioneller Bedingungen wie auch der Einfluss der Schüler auf Beeinträchtigungen der unterrichtlichen Kommunikation Berücksichtigung finden, vornehmlich jedoch auch hier in Bezug auf die Rolle des Lehrers.
Im Anschluss daran sollen Ideen und Ansätze zur Verbesserung thematisiert werden, wobei auch hier vor allem das Auftreten und Verhalten des Lehrers zu seinen Schülern im Mittelpunkt stehen wird. Welche Auswirkungen kann eine Veränderung des Umgangs miteinander auf die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern und letztendlich auch auf das Gesprächsverhalten haben?
Erneut wird der Fokus vorrangig auf der Person des Lehrers liegen, da es für ihn am wahrscheinlichsten ist, dass er Neuerungen durchsetzen könnte, sofern er nicht vollkommen wirklichkeitsferne Umwälzungen anstrebt. Zumindest im kleineren Rahmen wird es ihm am ehesten gelingen, Veränderungen durchzusetzen, wobei er sicherlich zunächst bei der eigenen Person, der eigenen Wahrnehmung und Haltung ansetzen muss. Aber auch hinsichtlich der Unterrichtsführung und der Methoden ist ein Umdenken erforderlich, weshalb auch diesbezüglich Überlegungen angestellt werden sollen. Auch die Frage, ob und inwiefern ein Lehrer institutionelle und organisatorische Gegebenheiten ändern und idealere Voraussetzungen für die Kommunikationsförderung schaffen kann, wird untersucht werden.
Abschließend soll - allerdings nur knapp - ein Konzept Klipperts Beachtung finden, der eine Verstärkung des "Kommunikationstrainings" ["Kommunikationstraining" lautet auch der Titel von Klipperts Buch] für die Schüler fordert, das mit aufeinander aufbauenden Trainingsbausteinen arbeitet. Klippert bietet dabei vielfältige Anregungen und Vorschläge für die Praxis, die hier leider nur angedeutet werden können. Verständlicherweise kann es sich im Rahmen dieser Arbeit lediglich um einen unvollständigen Überblick an Überlegungen handeln - zumal er auf die Lehrerseite reduziert werden soll, obwohl unzählige Ursachen und Faktoren die Kommunikation im Unterricht, sei diese gelungen oder gestört, maßgeblich mitbestimmen, weil sie allesamt für unterschiedlichste Wechselwirkungen mitverantwortlich sind.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Der Einfluss des Lehrers auf die Unterrichtskommunikation
- 1. Der institutionelle Rahmen
- 2. Die Rolle des Lehrers in der Klasse
- 2.1. Die Unterrichtsrealität
- 2.2. Die Autorität des Lehrers
- 2.3. Die Lehrer-Schüler-Beziehung
- 2.3.1. Der Mangel an Vertrauen
- 2.3.2. Die „Sprache der Nicht-Annahme“
- 2.3.3. Indirekte und nonverbale Botschaften
- III. Verbesserungen der Unterrichtskommunikation
- 1. Wünschenswerte Verhaltensweisen und Einstellungen des Lehrers
- 1.1. Das menschliche Miteinander
- 1.2. Die „Sprache der Annahme“
- 1.3. Die Vorzüge symmetrischer Kommunikation
- 2. Veränderungen der Unterrichtsgestaltung
- 2.1. Die Relevanz des schülerzentrierten Lernens
- 2.2. Kommunikation als Lernziel
- 2.3. Der Lehrer als Moderator und Organisator
- 2.4. Kooperation und organisatorische Veränderungen
- 3. Kommunikationstraining mit den Schülern
- 1. Wünschenswerte Verhaltensweisen und Einstellungen des Lehrers
- IV. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Kommunikationsstörungen im Unterricht und konzentriert sich dabei auf den Einfluss des Lehrers und dessen Handlungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Kommunikationssituation. Ziel ist es, Fehlerquellen im Lehrer-Schüler-Verhältnis aufzuzeigen und Ansätze zur Optimierung der Unterrichtskommunikation zu entwickeln.
- Analyse von Kommunikationsstörungen im Unterricht
- Der Einfluss des Lehrers auf die Unterrichtskommunikation
- Verbesserungsmöglichkeiten durch veränderte Verhaltensweisen und Einstellungen des Lehrers
- Optimierung der Unterrichtsgestaltung
- Kommunikationstraining mit Schülern
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Kommunikationsstörungen im Unterricht ein und erläutert die Bedeutung der Thematik für Lerneffizienz und Arbeitsatmosphäre. Sie benennt die Forschungsfrage nach den Einflussfaktoren und Möglichkeiten zur Verbesserung der Kommunikation und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt dabei auf der Rolle des Lehrers und seinen Handlungsmöglichkeiten. Die Arbeit beschränkt sich, trotz der Komplexität des Themas und des Einflusses vieler Faktoren, auf die Perspektive des Lehrers, da dieser am ehesten in der Lage ist, Veränderungen herbeizuführen.
II. Der Einfluss des Lehrers auf die Unterrichtskommunikation: Dieses Kapitel untersucht detailliert, wie das Verhalten und die Einstellungen des Lehrers die Unterrichtskommunikation beeinflussen. Es werden institutionelle Rahmenbedingungen beleuchtet, die die Handlungsfreiheit von Lehrern einschränken. Die Rolle des Lehrers in der Klasse, seine Autorität und die Lehrer-Schüler-Beziehung werden kritisch analysiert. Dabei werden Aspekte wie Mangel an Vertrauen, die „Sprache der Nicht-Annahme“ und indirekte sowie nonverbale Botschaften als Störfaktoren hervorgehoben. Der Text zeigt, wie institutionelle Vorgaben, organisatorische Bedingungen und das Schulklima die Kommunikation im Klassenzimmer beeinflussen und die Handlungsmöglichkeiten des Lehrers einschränken können.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Analyse von Kommunikationsstörungen im Unterricht
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text analysiert Kommunikationsstörungen im Unterricht, konzentriert sich dabei auf den Einfluss des Lehrers und dessen Möglichkeiten zur Verbesserung der Kommunikationssituation. Das Ziel ist es, Fehlerquellen im Lehrer-Schüler-Verhältnis aufzuzeigen und Ansätze zur Optimierung der Unterrichtskommunikation zu entwickeln.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Analyse von Kommunikationsstörungen im Unterricht; den Einfluss des Lehrers auf die Unterrichtskommunikation; Verbesserungsmöglichkeiten durch veränderte Verhaltensweisen und Einstellungen des Lehrers; Optimierung der Unterrichtsgestaltung; und Kommunikationstraining mit Schülern.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text ist in vier Kapitel gegliedert: Einleitung, Der Einfluss des Lehrers auf die Unterrichtskommunikation, Verbesserungen der Unterrichtskommunikation und Resümee. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgelistet und im Kapitel "Zusammenfassung der Kapitel" inhaltlich zusammengefasst.
Welchen Einfluss hat der Lehrer auf die Unterrichtskommunikation laut dem Text?
Der Text argumentiert, dass das Verhalten und die Einstellungen des Lehrers die Unterrichtskommunikation maßgeblich beeinflussen. Institutionelle Rahmenbedingungen, die Rolle des Lehrers in der Klasse, seine Autorität und die Lehrer-Schüler-Beziehung werden als entscheidende Faktoren genannt. Aspekte wie Mangel an Vertrauen, die „Sprache der Nicht-Annahme“ und indirekte sowie nonverbale Botschaften werden als Störfaktoren hervorgehoben.
Welche Möglichkeiten zur Verbesserung der Unterrichtskommunikation werden vorgeschlagen?
Der Text schlägt verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung vor: Wünschenswerte Verhaltensweisen und Einstellungen des Lehrers (z.B. „Sprache der Annahme“, symmetrische Kommunikation); Veränderungen der Unterrichtsgestaltung (schülerzentriertes Lernen, Kommunikation als Lernziel, Lehrer als Moderator); und Kommunikationstraining mit den Schülern. Es wird betont, dass institutionelle Vorgaben, organisatorische Bedingungen und das Schulklima die Kommunikation beeinflussen und die Handlungsmöglichkeiten des Lehrers einschränken können.
Welche Rolle spielt die Lehrer-Schüler-Beziehung?
Die Lehrer-Schüler-Beziehung ist ein zentraler Aspekt des Textes. Mangelndes Vertrauen, die „Sprache der Nicht-Annahme“ und indirekte oder nonverbale Botschaften werden als negative Einflussfaktoren auf die Kommunikation beschrieben. Der Text betont die Wichtigkeit einer positiven und vertrauensvollen Beziehung für eine effektive Unterrichtskommunikation.
Was ist das Fazit des Textes?
Das Resümee fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und verdeutlicht die Bedeutung einer verbesserten Lehrer-Schüler-Kommunikation für den Lernerfolg und das Klassenklima. Es betont die Notwendigkeit von Veränderungen sowohl im Verhalten des Lehrers als auch in der Unterrichtsgestaltung.
- Citar trabajo
- Christin Borgmeier (Autor), 2005, Kommunikationsstörungen im Unterricht. Der Einfluss des Lehrers und seine Handlungsmöglichkeiten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48594