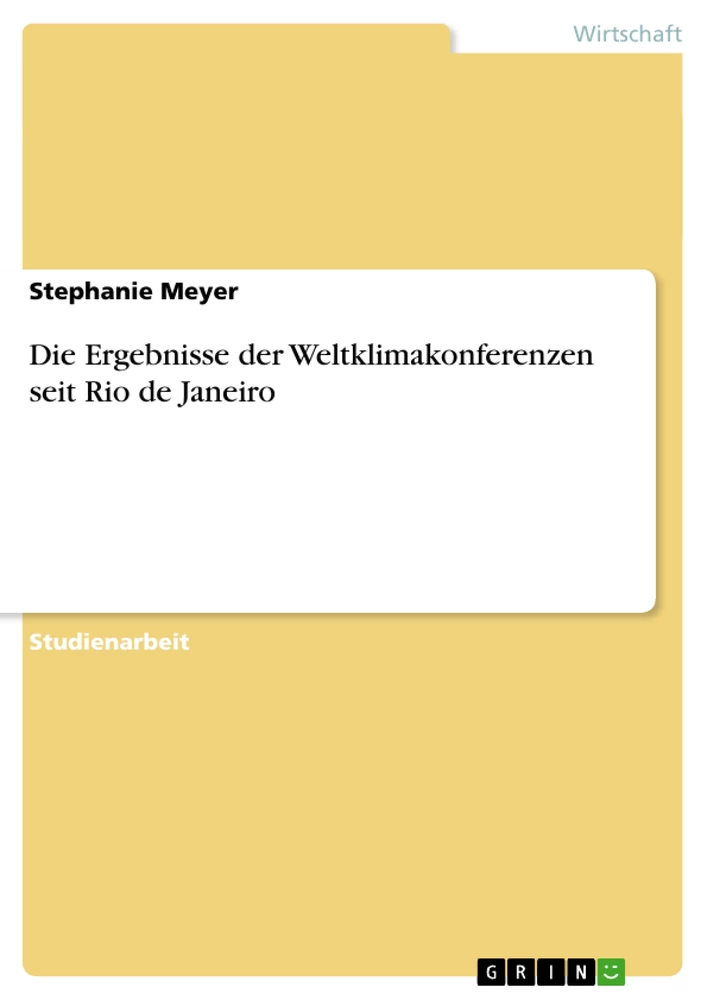Seit Beginn der Industrialisierung haben menschliche Aktivitäten die Umwelt stark verändert. Hauptsächlich durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Öl, Kohle und Gas, bei der unvermeidbar Kohlendioxid freigesetzt wird, stieg die Treibhauskonzentration in der Atmosphäre an. Ein weiterer Grund für die hohe atmosphärische Kohlendioxidkonzentration ist die immer stärkere Entwaldung des Planeten, so dass die verbleibenden Pflanzen das Treibhausgas nur noch unzureichend absorbieren. Als Konsequenz ist die CO²-Konzentration seit 1750 bis heute um ca. 31 % gestiegen, so dass die globale Mitteltemperatur im vergangenen Jahrhundert um 0,6 Grad Celsius zugenommen hat. Diese Erwärmung begründet sich im Treibhauseffekt. Dieser Effekt bedeutet nach Utsch (1994, S. 6 f.), dass einige der Gase, die sich in der Atmosphäre befinden, einen Teil der Wärmeabstrahlung der Erde wieder reflektieren, also zur Erde zurücksenden und somit für eine Erwärmung der erdnahen Luftschicht sorgen. Nach Stand der Klimaforschung ist davon auszugehen, dass ohne Klimaschutzmaßnahmen die natürliche und menschliche Lebenswelt ganz erheblich beeinträchtigt wird. Anstieg des Meeresspiegels, Abschmelzen der Polarkappen, Änderungen der Standortbedingungen für Pflanzen, Störung der allgemeinen atmosphärischen Zirkulation und Desertifikation sind einige mögliche Szenarien des Klimawandels.
In der vorliegenden Arbeit werde ich zum Verständnis der Entwicklung auch kurz auf die Geschehnisse vor der Weltklimakonferenz in Rio de Janeiro eingehen. Im Anschluss stelle ich dann die einzelnen Vertragsstaatenkonferenzen mit ihren jeweiligen Ergebnissen vor und bewerte die Resultate der wichtigsten Beschlüsse kritisch. Verdeutlichen möchte ich weiterhin die verschiedenen Akteure und Interessen in der internationalen Klimapolitik und auch die ökonomische Betrachtungsweise nicht außer Acht lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konferenzen und Beschlüsse vor Rio de Janeiro 1992
- Die Weltklimakonferenz in Rio de Janeiro 1992
- Die Rio-Deklaration
- Die Agenda 21
- Die Klimarahmenkonventionen
- Die Vertragsstaatenkonferenzen als Weiterentwicklung der Klimarahmenkonvention
- Berlin und Genf
- Kyoto
- Zentrale Elemente des Kyoto-Protokolls
- Die verschiedenen Interessengruppen bei der Entwicklung des Kyoto-Protokolls
- Die Konferenzen seit Kyoto bis heute
- Die Schwächen des Kyoto-Protokolls
- Kosten des Klimaschutzes und Kosten des Nichthandelns
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Ergebnissen der Weltklimakonferenzen seit Rio de Janeiro 1992 und deren Einfluss auf die internationale Klimaschutzpolitik. Ziel ist es, einen Überblick über die wichtigsten Beschlüsse und deren kritische Bewertung zu liefern.
- Die Entwicklung der internationalen Klimaschutzpolitik seit 1972
- Die wichtigsten Ergebnisse der Weltklimakonferenzen
- Die Rolle verschiedener Akteure und Interessen in der internationalen Klimapolitik
- Die ökonomischen Aspekte des Klimaschutzes
- Die Herausforderungen und Chancen für die Zukunft des Klimaschutzes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Bedeutung des Klimaschutzes im 21. Jahrhundert und die Folgen des Klimawandels. Kapitel 2 beleuchtet Konferenzen und Beschlüsse vor der Weltklimakonferenz in Rio de Janeiro 1992. Kapitel 3 fasst die Ergebnisse der UNCED, insbesondere die Rio-Deklaration, die Agenda 21 und die Klimarahmenkonvention, zusammen.
Schlüsselwörter
Klimawandel, Treibhausgase, Klimaschutz, Weltklimakonferenz, Rio de Janeiro, Kyoto-Protokoll, Internationale Umweltpolitik, Nachhaltige Entwicklung, Ökonomische Aspekte.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel der Weltklimakonferenz in Rio 1992?
Die Konferenz (UNCED) zielte auf nachhaltige Entwicklung und verabschiedete wichtige Dokumente wie die Agenda 21 und die Klimarahmenkonvention.
Was sind die zentralen Elemente des Kyoto-Protokolls?
Es legte erstmals rechtsverbindliche Reduktionsziele für Treibhausgase fest und führte flexible Mechanismen für den Klimaschutz ein.
Warum ist der Treibhauseffekt problematisch?
Durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe steigt die CO2-Konzentration, was zur globalen Erwärmung und extremen Klimaszenarien wie dem Meeresspiegelanstieg führt.
Welche ökonomischen Aspekte werden beim Klimaschutz betrachtet?
Die Arbeit vergleicht die Kosten für Klimaschutzmaßnahmen mit den wesentlich höheren Kosten, die durch Nichthandeln entstehen würden.
Welche Schwächen hat das Kyoto-Protokoll?
Kritisiert werden oft die unzureichenden Verpflichtungen für Schwellenländer und die Schwierigkeiten bei der globalen Durchsetzung der Ziele.
- Citar trabajo
- Stephanie Meyer (Autor), 2005, Die Ergebnisse der Weltklimakonferenzen seit Rio de Janeiro, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48716