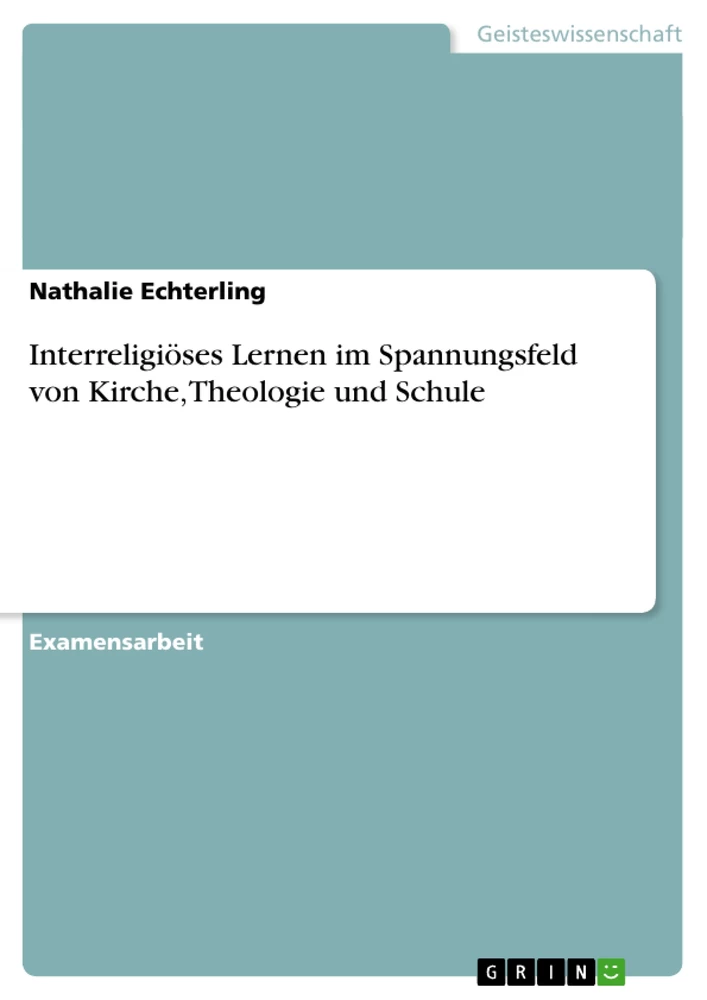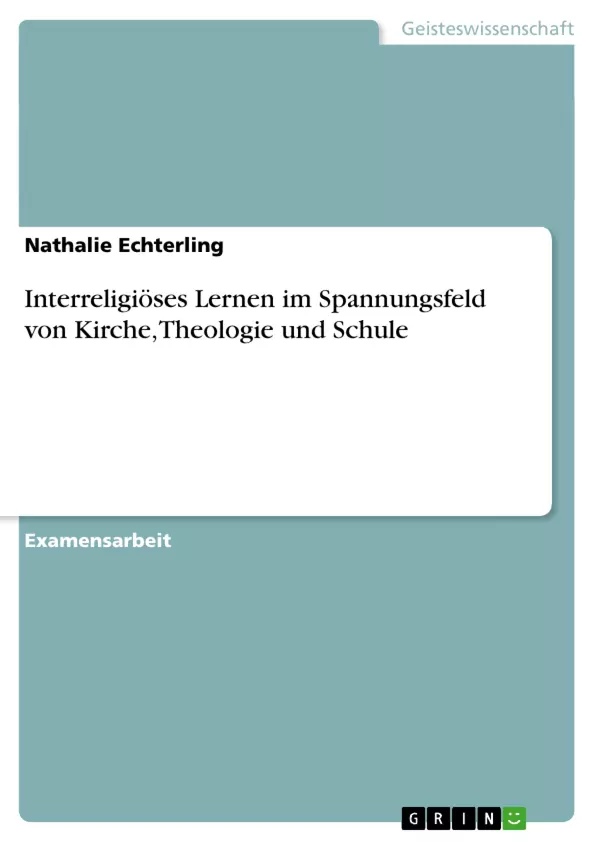Diese schriftliche Arbeit im Rahmen der ersten Staatsprüfung beschäftigt sich mit dem Thema interreligiöses Lernen sowie dessen Bezugshorizonte.
Dass das interreligiöse Lernen eine wichtige Voraussetzung für ein vorurteilfreies und tolerantes Miteinander der Religionen ist, haben nicht erst die Terroranschläge des 11. Septembers 2001 gezeigt. Dieses Ereignis sowie auch die schweren Anschläge in den Niederlanden gegen Moscheen und andere religiöse Einrichtungen im Winter des letzten Jahres, haben jedoch die Bedeutung dieses Lernen noch einmal deutlich vor Augen geführt. Die Unwissenheit über die fremden Religionen unserer Mitmenschen kann leicht zu Verunsicherungen im Verhalten diesen gegenüber, bis hin zur vollständigen Intoleranz, die in Gewaltakten enden kann, führen. Daher stellt sich
die Frage nach der Bedeutung des interreligiösen Lernens nicht nur im Ausland.
Denn seit den 1960er Jahren hat sich das gesellschaftliche Bild in Deutschland durch die Migration stark verändert. Durch die Einwanderer kamen nicht nur neue Nationalitäten in das Land, sondern auch unterschiedliche Glaubensgemeinschaften. Diese Entwicklung soll neben weiteren Aspekten in einer Gegenwartsanalyse nachgezeichnet werden, die zugleich die veränderten Bedingungen unserer Gegenwart berücksichtigt und deren Bedeutung für das interreligiöse Lernen herausstellt.
Desweiteren soll thematisiert werden, welche Beziehung die Theologie in ihrer Geschichte zum interreligiösen Lernen aufweist, in dem die drei Beziehungsmodelle des Exklusivismus, Inklusivismus und Pluralismus unter diesem Aspekt bearbeitet werden.
Die christlichen Kirchen als traditionelle sinndeutende Institutionen finden sich in der heutigen Zeit in einer pluralisierten Gesellschaft wieder, in der sie sich entgegen ihrer Tradition behaupten, aber auch mitgestaltend einbringen müssen. Aufgrund der veränderten Situation sollen anhand von kirchlichen Lehrschreiben und Schreiben kirchlicher Einrichtungen, sowohl der katholischen als auch der evangelischen Kirche, deren Aussagen über das Verhältnis zu nichtchristlichen Religionen untersucht und deren Bedeutung für das interreligiöse Lernen herausgestellt werden. Neben diesen Dokumenten sollen aber auch die Aussagen der katholischen und der evangelischen Kirche bezüglich des Religionsunterrichts und dessen Form in Bezug auf das interreligiöse Lernen in den Blick genommen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklungen unserer Zeit
- Der gesellschaftliche Wandel: Von der konfessionsgeprägten zur pluralistischen Gesellschaft
- Individualisierung und Säkularisierung
- Religiosität von Jugendlichen in der Gegenwart
- Clash of Civilizations
- Verständigung über den Begriff des interreligiösen Lernens
- Interkulturelles Lernen
- Der interreligiöse Dialog
- Fragen des interreligiösen Lernens im Horizont von Theologie
- Das Modell des Exklusivismus
- Das Modell des Inklusivismus
- Die pluralistische Religionstheorie
- Fragen des interreligiösen Lernens im Horizont der Kirchen
- Aussagen der katholischen Kirche
- Schriften des Zweiten Vaticanums- Nostra Aetate, Ad Gentes, Lumen Gentium und Dignitatis Humanae
- Die Verlautbarungen Evangelii Nuntiandi, Redemptoris Missio und Dominus Iesus
- Der Beschluss der Würzburger Synode zum Religionsunterricht
- Aussagen der evangelischen Kirche
- Der Ökumenische Rat der Kirchen
- Denkschrift Identität und Verständigung
- Aussagen der katholischen Kirche
- Interreligiöses Lernen im Horizont von Schule
- Die Entwicklung des interreligiösen Lernens in der Schulpraxis
- Fremdreligionen im Unterricht
- Didaktik der Weltreligionen
- Interreligiöses Lernen
- Religionspädagogische Reaktionen auf die multireligiöse Schülerschaft
- Das Modell des „,zu Gast Seins“
- Das Projekt Weltethos
- Weltethos und Erziehung
- Der Hamburger Religionsunterricht,,für alle“
- Die religiöse und gesellschaftliche Situation in Hamburg
- Das Hamburger Modell
- Das alternative Unterrichtsfach Lebensgestaltung, Ethik und Religionskunde
- Vorgeschichte des Faches
- Der Lernbereich LER
- Das Modell des „,zu Gast Seins“
- Die Entwicklung des interreligiösen Lernens in der Schulpraxis
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das interreligiöse Lernen im Spannungsfeld von Kirche, Theologie und Schule. Sie zeichnet den gesellschaftlichen Wandel von der konfessionsgeprägten zur pluralistischen Gesellschaft nach und beleuchtet die Relevanz des interreligiösen Lernens in einer zunehmend diversifizierten Gesellschaft. Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen theologischen Perspektiven auf das interreligiöse Lernen, insbesondere die Modelle des Exklusivismus, Inklusivismus und Pluralismus. Weiterhin untersucht sie die Positionen der katholischen und evangelischen Kirche zum interreligiösen Lernen und analysiert deren Aussagen zu den Themen Religionsunterricht und interreligiösem Dialog.
- Entwicklungen unserer Zeit und ihre Relevanz für das interreligiöse Lernen
- Theologische Perspektiven auf das interreligiöse Lernen
- Positionen der Kirchen zum interreligiösen Lernen
- Didaktische Reaktionen auf die multireligiöse Schülerschaft im Schulkontext
- Herausforderungen und Chancen des interreligiösen Lernens in der heutigen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit stellt die Relevanz des interreligiösen Lernens im Kontext der gesellschaftlichen und religiösen Veränderungen heraus und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit.
Entwicklungen unserer Zeit: Dieses Kapitel behandelt den Wandel von der konfessionsgeprägten zur pluralistischen Gesellschaft, die Individualisierung und Säkularisierung, die Religiosität von Jugendlichen in der Gegenwart sowie das Konzept des "Clash of Civilizations". Es untersucht die Bedeutung des interreligiösen Dialogs in einer multireligiösen Gesellschaft.
Fragen des interreligiösen Lernens im Horizont von Theologie: Dieses Kapitel analysiert die drei theologischen Modelle des Exklusivismus, Inklusivismus und Pluralismus und deren Bedeutung für das interreligiöse Lernen.
Fragen des interreligiösen Lernens im Horizont der Kirchen: Dieses Kapitel untersucht die Aussagen der katholischen und evangelischen Kirche zum Verhältnis zu anderen Religionen und zum interreligiösen Lernen. Es beleuchtet die Positionen beider Kirchen zum Religionsunterricht und deren Rolle im interreligiösen Kontext.
Interreligiöses Lernen im Horizont von Schule: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des interreligiösen Lernens in der Schulpraxis, betrachtet die Didaktik der Weltreligionen und analysiert verschiedene didaktische Ansätze für den Umgang mit multireligiösen Schülerschaften. Es stellt die Herausforderungen und Chancen des interreligiösen Lernens in der Schule dar.
Schlüsselwörter
Interreligiöses Lernen, Pluralismus, gesellschaftlicher Wandel, Individualisierung, Säkularisierung, Religiosität, Theologie, Exklusivismus, Inklusivismus, Kirche, Katholische Kirche, Evangelische Kirche, Religionsunterricht, Schule, Didaktik, Weltreligionen, multireligiöse Schülerschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des interreligiösen Lernens?
Es dient als wichtige Voraussetzung für ein vorurteilsfreies und tolerantes Miteinander der Religionen in einer pluralistischen Gesellschaft und soll Unwissenheit sowie daraus resultierende Intoleranz abbauen.
Welche theologischen Modelle werden unterschieden?
Die Arbeit analysiert die drei Beziehungsmodelle der Theologie zu anderen Religionen: Exklusivismus, Inklusivismus und die pluralistische Religionstheorie.
Wie reagieren Schulen auf multireligiöse Schülerschaften?
Es werden verschiedene didaktische Ansätze untersucht, wie das Hamburger Modell des „Religionsunterrichts für alle“ oder das Fach LER (Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde) in Brandenburg.
Welche Rolle spielen kirchliche Lehrschreiben?
Untersucht werden Dokumente wie „Nostra Aetate“ der katholischen Kirche oder evangelische Denkschriften, die das Verhältnis zu nichtchristlichen Religionen und den Dialog definieren.
Was ist das Projekt „Weltethos“?
Das Projekt Weltethos wird als Modell des „zu Gast Seins“ im schulischen Kontext vorgestellt, um gemeinsame ethische Werte der Weltreligionen im Unterricht zu vermitteln.
- Citar trabajo
- Nathalie Echterling (Autor), 2005, Interreligiöses Lernen im Spannungsfeld von Kirche, Theologie und Schule, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48742