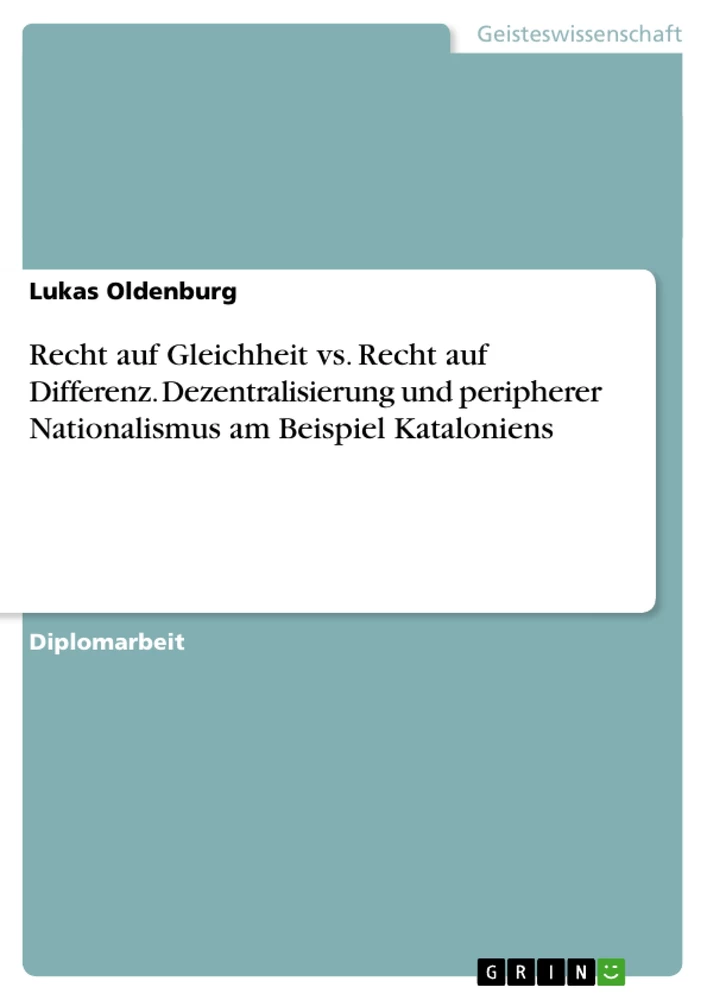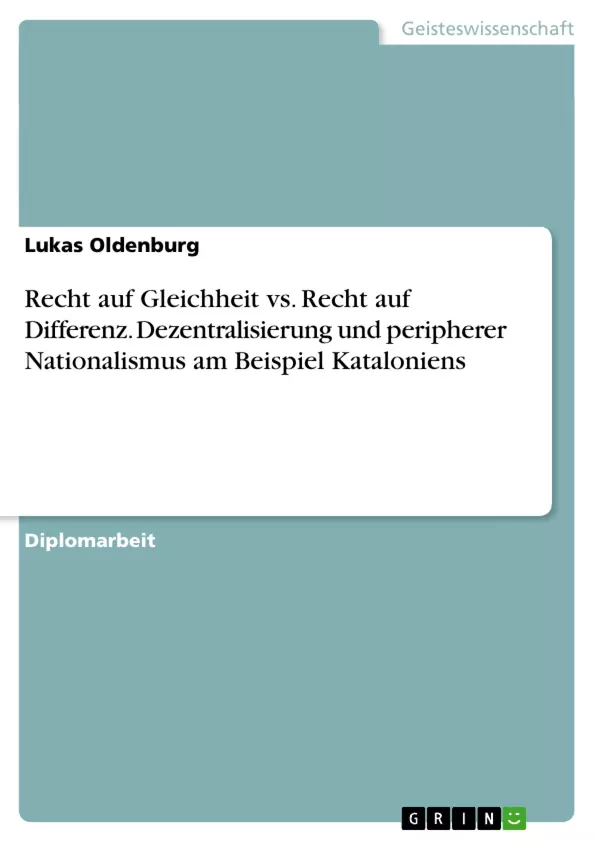This work deals with the problem of how to accommodate national minorities in multinational societies. In making such accommodations, devolution is one of the most frequently adopted strategies. National minorities in Spain, such as the Catalans, suffered through decades of repression under Francoism. As a result, the declining legitimacy of the Spanish state in Catalonia, the Basque Land and, to a lesser degree, in Galicia, required immediate devolution if Spain was to continue as a state on the same territory. The 1978 Constitution provided for asymmetrical as well as symmetrical solutions regarding the territorial distribution of autonomy: It did not outline a complete model of a decentralized state but rather defined the process by which autonomy could be attained – a process that clearly gave preferential treatment to the aforementioned three ‘historic nationalities’. Initially, the prevailing constitutional interpretation was in favor of a higher degree of self-government for the ‘historical nationalities’ only. Yet, several political agreements between the two major Spanish parties brought about the generalization of autonomy levels, that is, an equal status of territories with and without nationalist traditions. According to some Constitutional Law theorists, however, the equal status of territories with and without nationalist traditions undermined the very purpose of autonomy: to recognize the different national identities in certain territories via the differentiation in status of these territories in comparison to the others. Following this theory, one should expect a growing dissatisfaction with the status of Catalonia in the Spanish state with the equalization of autonomy levels. Therefore, this work analyzes the decentralization process since 1979. After presenting the historical, political and constitutional framework, quantitative indicators are used to compare the levels of autonomy in various regions. While electoral behavior and public opinion in Catalonia present some tendencies towards growing dissatisfaction with the status of Catalonia in the Spanish state, the increase in the level of dissatisfaction is not linear to the equalization of autonomy levels. Thus, the final chapter discusses other potential intervening variables in explaining electoral behavior and public opinion regarding questions of autonomy and takes an outlook into the future of Spain’s State of the Autonomies.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG: KURZER ABRISS DER PROBLEMATIK
- GRUNDLEGENDES
- Erkenntnisinteresse, Forschungsfragen und Hypothesen
- Wissenschaftstheoretische Herangehensweise und Einordnung in bestehende kulturwissenschaftliche Forschungsfelder
- Rechtfertigung der Fragestellung
- Klärung grundlegender Begriffe: Staat, Nation, Nationalismus, Katalanismus und Dezentralisierung
- HISTORISCH-POLITISCHE EINFÜHRUNG
- Die Entstehung des Zentrum-Peripherie-Cleavages in Spanien
- 'Mancomunitat', 'Estatut de Núria', ERC und Franquismus
- DIE TRANSITION ZUR DEMOKRATIE ALS STATENESS-PROBLEM UND DIE VERFASSUNG VON 1978
- Der Pakt-Charakter der Transition, die ‘Ley de Reforma Política' und die vorläufige Lösung des Stateness-Problems durch gesamtspanische Wahlen
- Die Rückkehr des katalanischen Exilpräsidenten und der erste ‘café para todos': pre-autonomías für alle
- Dezentralisierung ja, aber wie? Der Verfassungskonsens als Formelkompromiss
- Konstitutionelle Symmetrie oder Asymmetrie?
- Die 'fets diferencials': Garant dauerhafter Asymmetrie?
- Der Autonomiestaat: Bis hierher und immer weiter?
- DER AUTONOMIEPROZESS: VON DER „DIFFERENTIATING“ ZUR „HOMOGENEOUS INTERPRETATION“
- Phase 1 (1979-1981): Das kurze Leben der „nationalistischen Interpretation“ der Verfassung
- Zweite Phase (1981-1992): Putschversuch, Konsenssuche, Autonomie-Abkommen und 'Zwei-Klassen-Gesellschaft'
- Dritte Phase (1992-2004): die zweiten Autonomie-Abkommen und deren Folgen
- Die Autonomienivellierung anhand von quantitativen Indikatoren
- Weitere kompetenzielle Differenzierungsmöglichkeiten von symbolischem Wert
- Sprache und Medien
- Eigenes Zivilrecht
- Eigene Territorialgliederung
- Eigene Polizeieinheiten
- Zusammenfassung und Herstellung des Bezugs zu den Hypothesen
- RADIKALISIERUNG DES NATIONALISMUS AUF DER INDIVIDUALEBENE?
- Wahlverhalten
- Entwicklung der Einstellungen der Bevölkerung zu autonomiepolitischen Themen
- Nationale Identität
- Autonomieniveauvorstellungen
- Zustimmung zum Konzept des Nationalismus
- Bewertung der Politik der Zentralregierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie nationale Minderheiten in multinationalen Gesellschaften integriert werden können. Dezentralisierung wird als eine der am häufigsten angewandten Strategien in diesem Kontext betrachtet. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Dezentralisierung in Spanien, insbesondere im Hinblick auf die Situation Kataloniens. Die Analyse fokussiert sich auf die Entwicklung von Autonomieniveaus seit 1979 und untersucht die Frage, ob die Nivellierung der Autonomieniveaus zu einer wachsenden Unzufriedenheit mit dem Status Kataloniens im spanischen Staat führt.
- Entwicklung der Dezentralisierung in Spanien nach der Franco-Diktatur
- Untersuchung des Autonomiestaates und dessen Folgen für die Integration nationaler Minderheiten
- Analyse der Autonomienivellierung in Spanien und deren Auswirkungen auf die politische Stimmung in Katalonien
- Bedeutung der politischen und kulturellen Identität in Katalonien
- Die Rolle des Nationalismus im Prozess der Dezentralisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Erkenntnisinteresse, die Forschungsfragen und Hypothesen der Arbeit erläutert. Sie setzt sich dann mit den theoretischen Grundlagen und der wissenschaftlichen Einordnung der Arbeit auseinander, bevor sie grundlegende Begriffe wie Staat, Nation, Nationalismus, Katalanismus und Dezentralisierung definiert. Im Anschluss daran werden in Kapitel 3 die historischen und politischen Wurzeln des Zentrum-Peripherie-Konflikts in Spanien beleuchtet, bevor Kapitel 4 die Transition zur Demokratie und die Verabschiedung der spanischen Verfassung von 1978 behandelt. Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Verfassung bei der Lösung des "Stateness-Problems" und die damit einhergehende Dezentralisierung. Kapitel 5 befasst sich mit dem Autonomieprozess in Spanien, angefangen bei der ersten Phase (1979-1981) mit der "nationalistischen Interpretation" der Verfassung. Die weiteren Abschnitte dieses Kapitels analysieren die zweite und dritte Phase des Autonomieprozesses und betrachten die Autonomienivellierung anhand von quantitativen Indikatoren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Dezentralisierung, Nationalismus, Autonomie, Minderheitenrechte, Staatsintegration, Katalonien, Spanien, Autonomiestatus, politische Kultur, politische Identität, Wahlverhalten, öffentliche Meinung.
Häufig gestellte Fragen
Wie geht Spanien mit nationalen Minderheiten wie den Katalanen um?
Spanien nutzt Dezentralisierung als Strategie. Die Verfassung von 1978 ermöglichte einen Prozess zur Erlangung von Autonomie, der anfangs historische Nationalitäten bevorzugte.
Was bedeutet der Begriff „café para todos“?
Er beschreibt die Generalisierung der Autonomieniveaus in Spanien, also die Angleichung des Status von Regionen mit und ohne nationalistische Traditionen.
Welche Auswirkungen hat die Nivellierung der Autonomie auf Katalonien?
Theoretiker vermuten, dass die Gleichstellung mit anderen Regionen zu Unzufriedenheit führt, da die Anerkennung der spezifischen nationalen Identität Kataloniens dadurch untergraben wird.
Welche Faktoren neben der Autonomie prägen die katalanische Identität?
Dazu gehören die Sprache, eigene Medien, ein spezifisches Zivilrecht, eine eigene Territorialgliederung und eigene Polizeieinheiten.
Was zeigt die Analyse des Wahlverhaltens in Katalonien?
Es gibt Tendenzen zu wachsender Unzufriedenheit, diese verläuft jedoch nicht linear zur Angleichung der Autonomieniveaus, was auf weitere Einflussvariablen hindeutet.
- Citar trabajo
- Dipl. Kult. Lukas Oldenburg (Autor), 2005, Recht auf Gleichheit vs. Recht auf Differenz. Dezentralisierung und peripherer Nationalismus am Beispiel Kataloniens, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48744