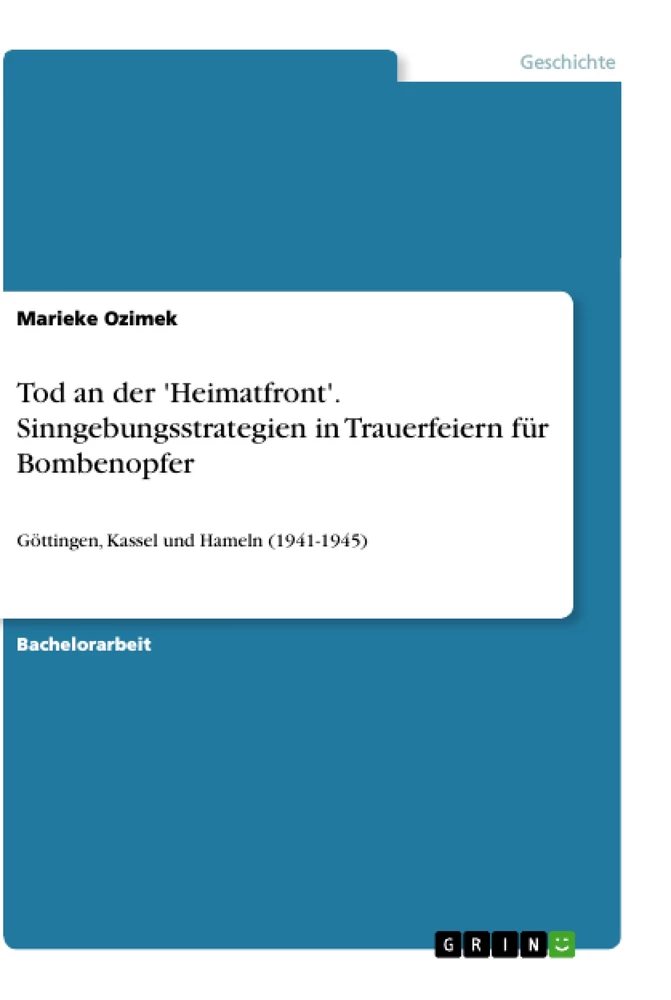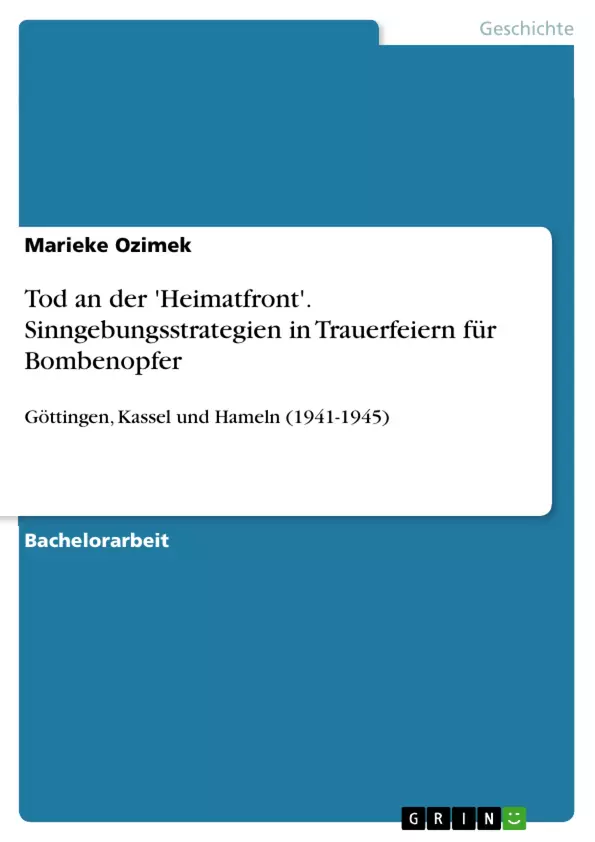Die vorliegende Arbeit soll folgender Frage nachgehen: Welche Sinngebungsstrategien lassen sich anhand der vier exemplarischen Trauerfeiern für Bombenopfer feststellen, mit Hilfe derer das NS-Regime das Ziel verfolgte, dem Tod an der "Heimatfront" einen Sinn zu verleihen, die Akzeptanz der eigenen Politik somit aufrechtzuerhalten und den Durchhaltewillen des Volkes zu stärken beziehungsweise Resignation zu vermeiden?
Die Folgen von Bombardierungen waren für jeden Einzelnen sichtbar, das ,"[...] Ordnungsgefüge der >>Volksgemeinschaft<< [...]" drohte, instabil zu werden. Entscheidend war also, die kollektive Ordnung trotz Angst und Unruhe zu stabilisieren und insbesondere das Vertrauen der "Volksgemeinschaft" in den Staat aufrechtzuerhalten. Vor allem Kriegsfolgen, wie das tägliche Sterben von Menschen, mussten mit einem Sinn behaftet werden, um zu verhindern, dass die Legitimation der Herrschaft des Staates vom Kollektiv in Frage gestellt wurde und somit die gesellschaftliche Solidarität verloren ging. "Die Unmittelbarkeit des Todes […]" erforderte regelmäßige Ideologisierung, als auch Mythisierung, um Resignation aufgrund von Trauer möglichst zu vermeiden. An dieser Stelle kommt den sogenannten "Sinngebungsstrategien" eine entscheidende Bedeutung zu, die in der vorliegenden Arbeit anhand von vier unterschiedlichen Zeitungsartikeln herausgearbeitet werden sollen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sinngebungsstrategien in Trauerfeiern für Bombenopfer
- Sprachliche Ebene
- Diskreditierung des Gegners
- Das Konstrukt der "Volksgemeinschaft"
- Verpflichtung durch Opfer
- Das gemeinsame Schicksal
- Was wird nicht gesagt?
- Praktische Ebene
- Ort der Trauerfeiern
- Die anwesende "Prominenz"
- Liedgut
- Verlesung der Namen
- Sprachliche Ebene
- Die Verbindung von Sprache und Praxis
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Sinngebungsstrategien in Trauerfeiern für Bombenopfer im Zweiten Weltkrieg in Göttingen, Kassel und Hameln. Die Arbeit untersucht, wie das NS-Regime versuchte, dem Tod an der „Heimatfront“ einen Sinn zu verleihen, die Akzeptanz der eigenen Politik zu erhalten und den Durchhaltewillen des Volkes zu stärken.
- Der "Totale Krieg" und seine Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung
- Sinngebungsstrategien in Trauerfeiern für Bombenopfer
- Die Rolle von Sprache und Praxis in der NS-Propaganda
- Die Bedeutung der "Volksgemeinschaft" im Kontext des Luftkriegs
- Die Herausforderungen des Lebens und Sterbens an der „Heimatfront“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des "Totalen Krieges" und seine Auswirkungen auf die „Heimatfront“ ein. Sie stellt den Forschungsstand dar und definiert den Begriff der „Sinngebungsstrategien“ im Kontext der Arbeit.
Kapitel 2 untersucht die sprachlichen und praktischen Ebenen der Sinngebungsstrategien in Trauerfeiern für Bombenopfer. Hierbei werden die Strategien der Diskreditierung des Gegners, des Konstrukts der "Volksgemeinschaft", der Verpflichtung durch Opfer, des gemeinsamen Schicksals und der Unterdrückung kritischer Aspekte analysiert.
Kapitel 3 beleuchtet die enge Verbindung von Sprache und Praxis in den Sinngebungsstrategien. Es zeigt, wie Sprache und rituelle Handlungen zusammenwirkten, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen "Totaler Krieg", "Heimatfront", "Sinngebungsstrategien", "Trauerfeiern", "Bombenopfer", "NS-Propaganda", "Volksgemeinschaft", "Sprache" und "Praxis". Die Forschung basiert auf Zeitungsartikeln aus der Zeit von 1941 bis 1945.
Häufig gestellte Fragen
Was waren "Sinngebungsstrategien" im Nationalsozialismus?
Es waren propagandistische Methoden, um dem Sterben der Zivilbevölkerung durch Bombenangriffe einen ideologischen Sinn zu geben und den Durchhaltewillen zu stärken.
Wie wurden Trauerfeiern für Bombenopfer inszeniert?
Die Feiern fanden an repräsentativen Orten statt, oft unter Anwesenheit von NS-Prominenz. Rituale wie die Verlesung der Namen und das Singen von nationalsozialistischem Liedgut dienten der Mythisierung.
Welche Rolle spielte die Sprache in der NS-Berichterstattung?
Sprachliche Mittel wie die Diskreditierung des Gegners als "Terrorflieger" und das Konstrukt der "Volksgemeinschaft" sollten die Wut kanalisieren und die Solidarität festigen.
Was bedeutet "Verpflichtung durch Opfer"?
Die Strategie besagte, dass die Überlebenden es den Toten schuldig seien, bis zum Äußersten weiterzukämpfen, damit deren Tod nicht umsonst gewesen sei.
Wie wurde Resignation in der Bevölkerung vermieden?
Durch die ständige Ideologisierung des Todes und die Unterdrückung kritischer Stimmen wurde versucht, die Angst in einen kollektiven Hass und Kampfgeist umzuwandeln.
- Citation du texte
- Marieke Ozimek (Auteur), 2018, Tod an der 'Heimatfront'. Sinngebungsstrategien in Trauerfeiern für Bombenopfer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/488983