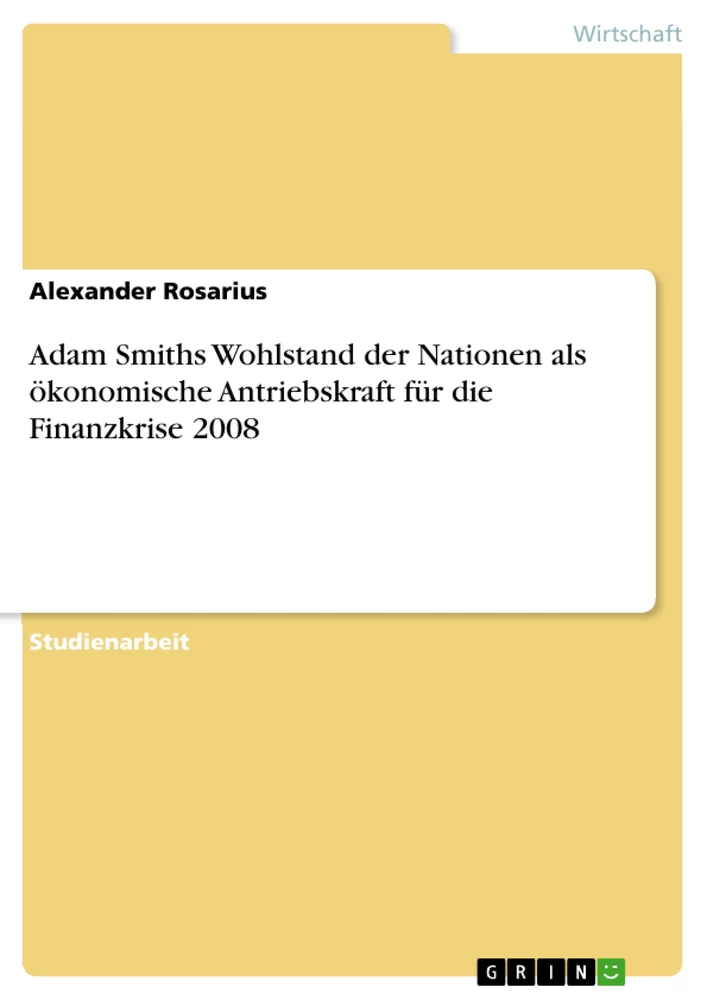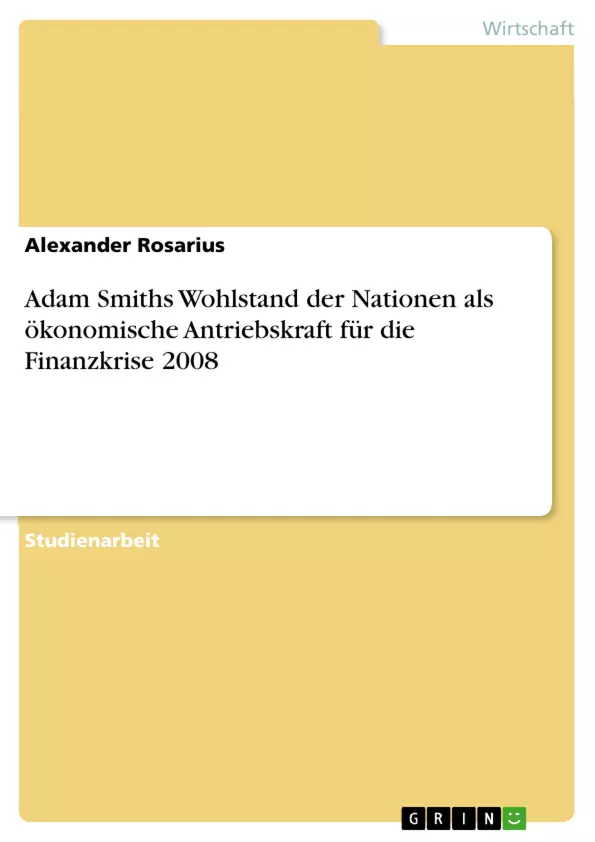Adam Smith gehört zu den bekanntesten und einflussreichsten Ökonomen und Moralphilosophen des achtzehnten Jahrhunderts und gilt als ein Verfechter der wissenschaftlichen Revolution. Sein fundamentaler Glauben an eine fortschrittsfähige Ökonomie bildete nicht nur den konzeptionellen Rahmen für sein später publiziertes Hauptwerk Eine Untersuchung über das Wesen und die Ursachen des Wohlstands der Nationen, sondern diente auch als Grund-lage für die Herausbildung der klassischen Nationalökonomie sowie des Wirtschaftsliberalismus.
Seine theoretischen Überlegungen weisen dabei eklektische Grundzüge auf, denn für Smith scheint es von zentraler Bedeutung zu sein, Gesetzmäßigkeiten, wie sie in den Naturwissenschaften üblich sind, für die Ökonomie abzuleiten und neu zu interpretieren. Es er-scheint logisch, dass seine revolutionäre Vision von einem sich selbst regulierenden und harmonischen Wirtschaftssystem, respektive das generelle Funktionieren des Marktes, Kern seiner wirtschaftlichen Analyse sind und gleichzeitig Merkmale seines freiheitlichen Liberalismus darstellen. Gleichzeitig wird er oft in dezimierter Art und Weise „als Ökonom wahrgenommen, der allzu idealistisch davon ausging, dass sich der individuelle Egoismus im gesellschaftlichen Miteinander auf dem Markt durch das Wirken einer unsichtbaren Hand in allgemeines Wohlgefallen auflöst.“
Die Tatsache, dass das ursprüngliche Weltbild des Liberalismus und der damit verknüpfte Egoismus im Zuge der modernen Debatte in den Fokus kritischer Auseinandersetzungen geraten ist, spiegelt sich in der Kritik der Antikapitalisten wider: Als Gegner eines exzessiven Marktliberalismus sehen sie sich durch die aktuellen Folgen dieser Wirtschaftstheorie symptomatisch in ihrer Ansicht bestärkt, dass die Grundprinzipien des Liberalismus zum Scheitern verurteilt sind. Demnach ist es kaum überraschend, dass Adam Smith in den Vordergrund der Schuldzuweisungen geraten ist.
Im Folgenden erscheint eine kritische Auseinandersetzung mit den historischen Werken Adam Smiths als sinnvoll, um die vorliegende Forschungsfrage adäquat beantworten zu können: Kann das Eigeninteresse nach Adam Smith als Antriebskraft für die Finanzkrise 2008 deklariert werden?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ursachen der Finanzkrise 2008
- Fragwürdige Kreditvergabe
- Der Egoismus der Finanzbranche...
- Das Adam-Smith-Problem
- Theorie der ethischen Gefühle
- Die Sympathie als Grundkraft menschlichen Zusammenlebens.
- Das Vergeltungsgefühl als Kontrollmechanismus
- Der unparteiische Beobachter...
- Wohlstand der Nationen.
- Schluss.......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Adam Smiths Eigeninteresse als treibende Kraft für die Finanzkrise von 2008 betrachtet werden kann. Sie analysiert Smiths Werk „Eine Untersuchung über das Wesen und die Ursachen des Wohlstands der Nationen“ und untersucht, inwiefern seine Theorien die Ursachen der Finanzkrise erklären könnten. Dabei werden insbesondere die Rolle des Egoismus im Wirtschaftsprozess und die Beziehung zwischen individuellem Eigeninteresse und gesellschaftlichem Wohlstand beleuchtet.
- Adam Smiths Vorstellung von Eigeninteresse und seiner Rolle im Wirtschaftsprozess
- Kritik an Smiths Theorien im Kontext der Finanzkrise 2008
- Analyse der Ursachen der Finanzkrise 2008, insbesondere im Hinblick auf fragwürdige Kreditvergabe und den Egoismus der Finanzbranche
- Die Verbindung zwischen Smiths „Theorie der ethischen Gefühle“ und „Wohlstand der Nationen“
- Die Relevanz von Smiths Werk im Kontext der modernen Finanzmärkte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Adam Smith als einen einflussreichen Ökonomen und Moralphilosophen vor und präsentiert die Forschungsfrage, ob sein Eigeninteresse als Antriebskraft für die Finanzkrise 2008 dienen kann. Kapitel 2 beleuchtet die Ursachen der Finanzkrise, wobei der Fokus auf fragwürdige Kreditvergabe und den Egoismus der Finanzbranche liegt. Kapitel 3 beleuchtet das Adam-Smith-Problem, die symbiotische Verbindung seiner beiden Hauptwerke. Kapitel 4 erforscht Smiths Menschenbild anhand der „Theorie der ethischen Gefühle“, bevor Kapitel 5 die Erkenntnisse auf „Wohlstand der Nationen“ anwendet.
Schlüsselwörter
Adam Smith, Finanzkrise 2008, Eigeninteresse, Egoismus, Liberalismus, „Theorie der ethischen Gefühle“, „Wohlstand der Nationen“, Finanzmarkt, Kreditvergabe, Subprime-Kredite, Kapitalismus, Wirtschaftsliberalismus, Unsichtbare Hand
Häufig gestellte Fragen
Kann Adam Smiths Theorie des Eigeninteresses die Finanzkrise 2008 erklären?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob Smiths Konzept des Eigeninteresses als Antriebskraft für den exzessiven Egoismus der Finanzbranche und die folgende Krise deklariert werden kann.
Was versteht man unter dem "Adam-Smith-Problem"?
Es beschreibt die scheinbare Spannung zwischen Smiths Fokus auf Sympathie in der 'Theorie der ethischen Gefühle' und dem Eigeninteresse im 'Wohlstand der Nationen'.
Welche Rolle spielt die 'unsichtbare Hand' in der Diskussion?
Kritiker werfen Smith vor, idealistisch davon auszugehen, dass individueller Egoismus durch eine unsichtbare Hand stets zum allgemeinen Wohl führt, was 2008 widerlegt schien.
Wie sieht Smith das Verhältnis von Moral und Wirtschaft?
Für Smith ist die Sympathie die Grundkraft des menschlichen Zusammenlebens, und Mechanismen wie der "unparteiische Beobachter" dienen als ethische Kontrollinstanzen.
Was sind laut Arbeit die konkreten Ursachen der Finanzkrise 2008?
Dazu zählen fragwürdige Kreditvergaben (Subprime), mangelnde Regulierung und ein fehlgeleiteter Egoismus innerhalb der Finanzmärkte.
- Quote paper
- Alexander Rosarius (Author), 2019, Adam Smiths Wohlstand der Nationen als ökonomische Antriebskraft für die Finanzkrise 2008, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/489182