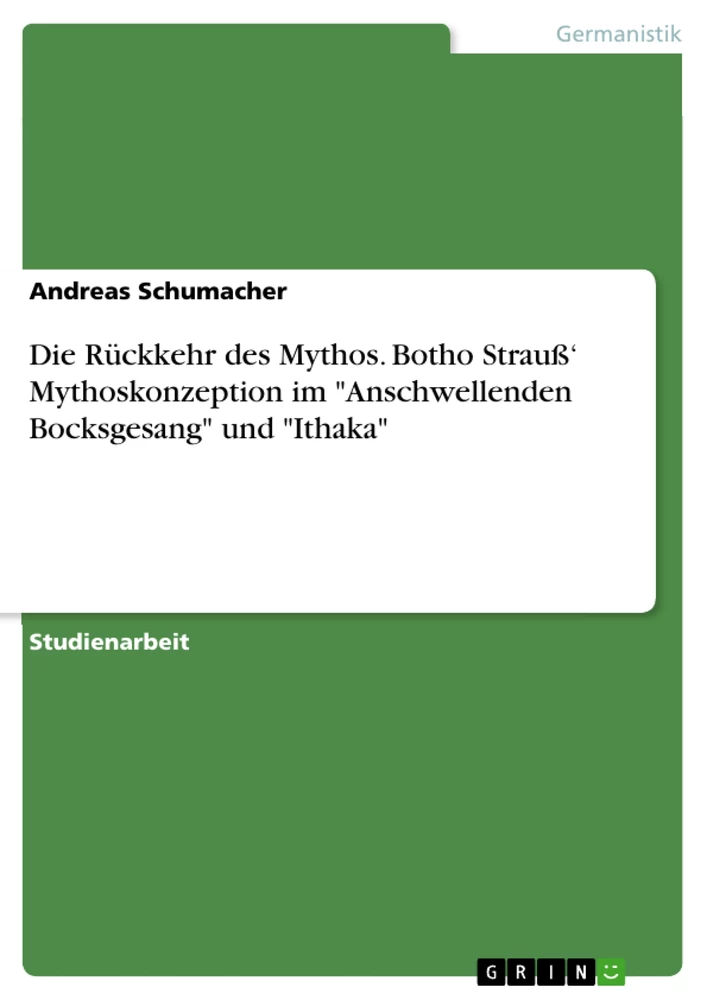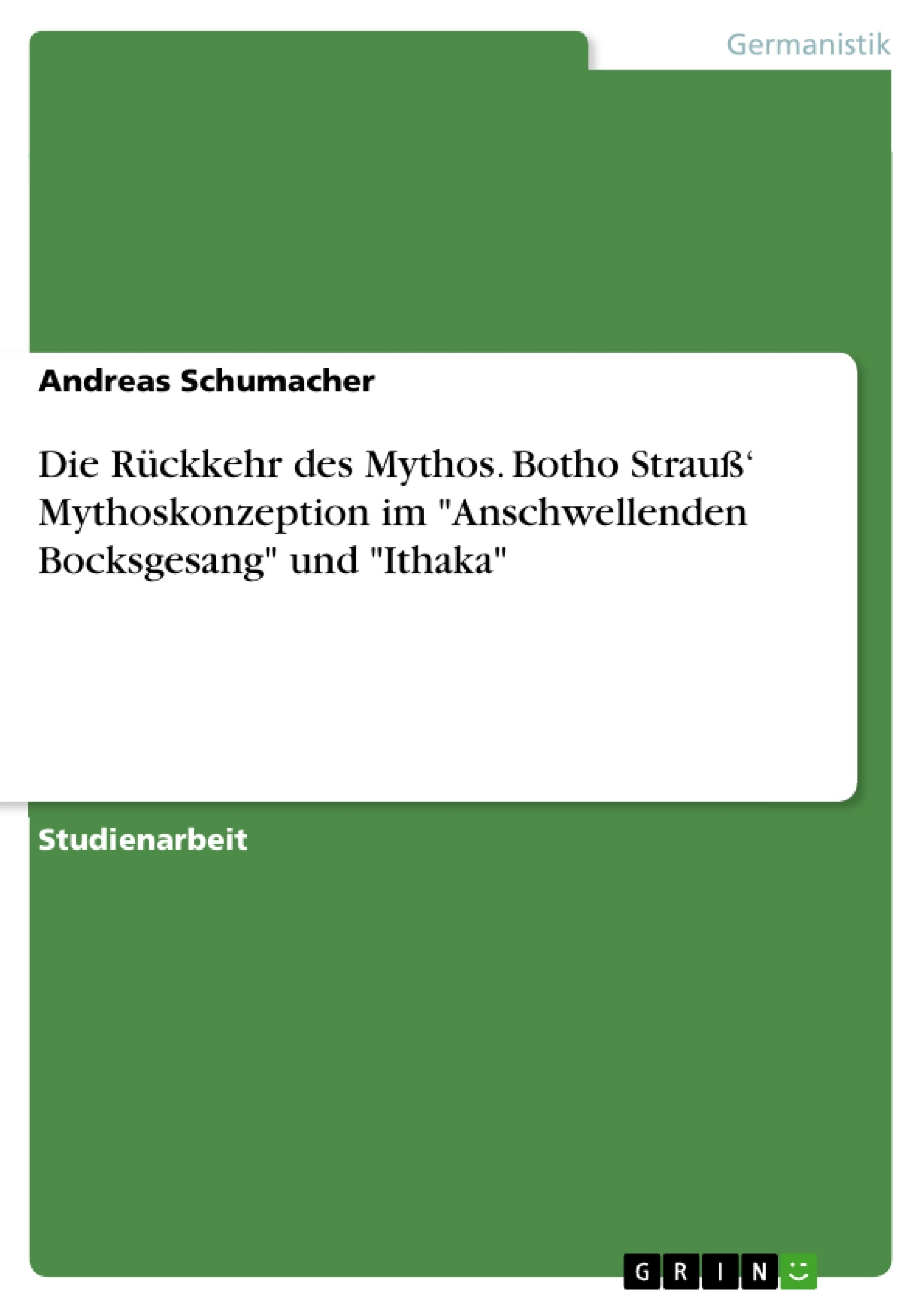Botho Strauß gehört zweifelsohne zu den wohl meist diskutiertesten und mitunter auch sehr häufig gespielten Dramatikern der zeitgenössischen Gegenwartsliteratur. Berühmtheit erreichte er unter anderem mit seinem 1993 erschienenen Essay "Anschwellender Bocksgesang". Drei Jahre später erschien sein mit Spannung erwartetes Drama mit dem Titel "Ithaka". Auch dieses löste bereits im Vorfeld eine große Debatte aus, da zum Beispiel der berühmte Schauspieler Helmut Griem sich weigerte, die Rolle des Odysseus zu spielen und daher von der Rolle zurücktrat. Mit Spannung erwartet wurde es vor allem deshalb, weil man spekulierte, dass das Stück in einem inhaltlichen Zusammenhang zum Anschwellenden Bocksgesang stehen würde.
In dieser Arbeit wird nun Ithaka analysiert. Hierzu werden zentrale Stellen des Dramas detailliert untersucht und bewertet. Vor allem die Bearbeitungstendenz Strauß‘ im Unterschied zum Prätext der Odyssee von Homer liefert aufschlussreiche Erkenntnisse zu Strauß‘ Mythoskonzeption. Diese Bearbeitungstendenz zeigt deutlich, dass es Strauß trotz der oftmals erdrückenden Nähe am epischen Original gelungen ist, eigene Akzente zu setzen. Hierzu muss während der Analyse des Textes zwischen dem poetologischen Programm, welches als eine Art Überbau dient, und den inhaltlichen Aussagen, die sozusagen von ebendiesem Programm abhängen, differenziert werden. Anhand einer exemplarischen Untersuchung soll also die Beschaffenheit des Überbaus konkretisiert werden. In dieser Arbeit wird also der Versuch unternommen, zu zeigen, dass die Ithaka keinesfalls eine reine eins-zu-eins-Umsetzung des Anschwellenden Bocksgesangs in ein Drama ist, sondern dass es sich um einiges komplexer verhält.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Anschwellende Bocksgesang
- Entstehung und Rezeption
- Mythos- und Tragödienrezeption
- Von der Gestalt der neuen Tragödie in Ithaka
- Entstehungs- und Stoffgeschichte
- Die Rolle des Chors
- Die Gesellschaft in Ithaka
- Penelope
- Die Saalschlacht als Katharsis
- Die doppelte Anagnorisis
- Die Aussöhnung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Mythos- und Tragödienverständnis von Botho Strauß, indem sie seinen Essay „Anschwellender Bocksgesang“ und das Drama „Ithaka“ untersucht. Strauß' Werk befasst sich mit einer Kulturkritik am herrschenden Diskurs und entwirft gleichzeitig ein poetologisches Programm über die Rückkehr des Mythos in die postmoderne Gesellschaft.
- Strauß' Kritik am zeitgenössischen Konformismus und seine These von einer linken Meinungshegemonie
- Die Rekonstruktion der Tragödie als Ursprung des Schreckens im Opferritual
- Die Bedeutung der kathartischen Wirkung der Tragödie und ihre Fähigkeit, das Unheil zu ertragen
- Die Gefahr einer mythenleeren Gesellschaft und die drohende „Wiederkehr der Götter“
- Strauß' Bearbeitungstendenz in „Ithaka“ im Vergleich zum homerischen Original und die Herausarbeitung eigener Akzente
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Botho Strauß als prominenten Dramatiker vor und beleuchtet die Entstehungsgeschichte und Rezeption seines Essays „Anschwellender Bocksgesang“ und des Dramas „Ithaka“.
Der zweite Abschnitt widmet sich dem Essay „Anschwellender Bocksgesang“ und analysiert die Entstehung und Rezeption des Werks. Dabei wird Strauß' Kritik am zeitgenössischen Diskurs sowie die Rolle des Mythos und der Tragödie im Kontext der Wiedervereinigung beleuchtet.
Kapitel 2.2 untersucht die Mythos- und Tragödienrezeption in „Anschwellender Bocksgesang“. Strauß' Rekonstruktion der Tragödie als Ursprung des Schreckens im Opferritual sowie seine Kritik an der Unfähigkeit unserer Gesellschaft, mit dem Unheil umzugehen, werden analysiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Mythos, Tragödie, Kulturkritik, postmoderne Gesellschaft, Konformismus, kathartische Wirkung, „Wiederkehr der Götter“, Homerische Odyssee, Botho Strauß, „Anschwellender Bocksgesang“, „Ithaka“.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Botho Strauß' Essay „Anschwellender Bocksgesang“?
Der Essay ist eine scharfe Kulturkritik am zeitgenössischen Konformismus und fordert eine Rückkehr zu tragischen und mythischen Werten.
Wie interpretiert Strauß den Mythos in seinem Drama „Ithaka“?
Strauß nutzt den antiken Stoff der Odyssee, um eigene Akzente zu setzen und die Tragödie als Ursprung des Schreckens und der Katharsis darzustellen.
Warum löste „Ithaka“ eine große Debatte aus?
Die Debatte entzündete sich an der inhaltlichen Nähe zum kontroversen „Bocksgesang“ und führte sogar zum Rücktritt prominenter Schauspieler.
Was versteht Strauß unter der „Wiederkehr der Götter“?
Es beschreibt die Gefahr, dass in einer mythenleeren Gesellschaft verdrängte archaische Mächte unkontrolliert zurückkehren könnten.
Welche Rolle spielt die Katharsis in Strauß' Werk?
Die Katharsis wird als reinigende Wirkung der Tragödie gesehen, die es dem Menschen ermöglicht, dem Unheil der Welt standzuhalten.
- Citar trabajo
- Andreas Schumacher (Autor), 2017, Die Rückkehr des Mythos. Botho Strauß‘ Mythoskonzeption im "Anschwellenden Bocksgesang" und "Ithaka", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/489204