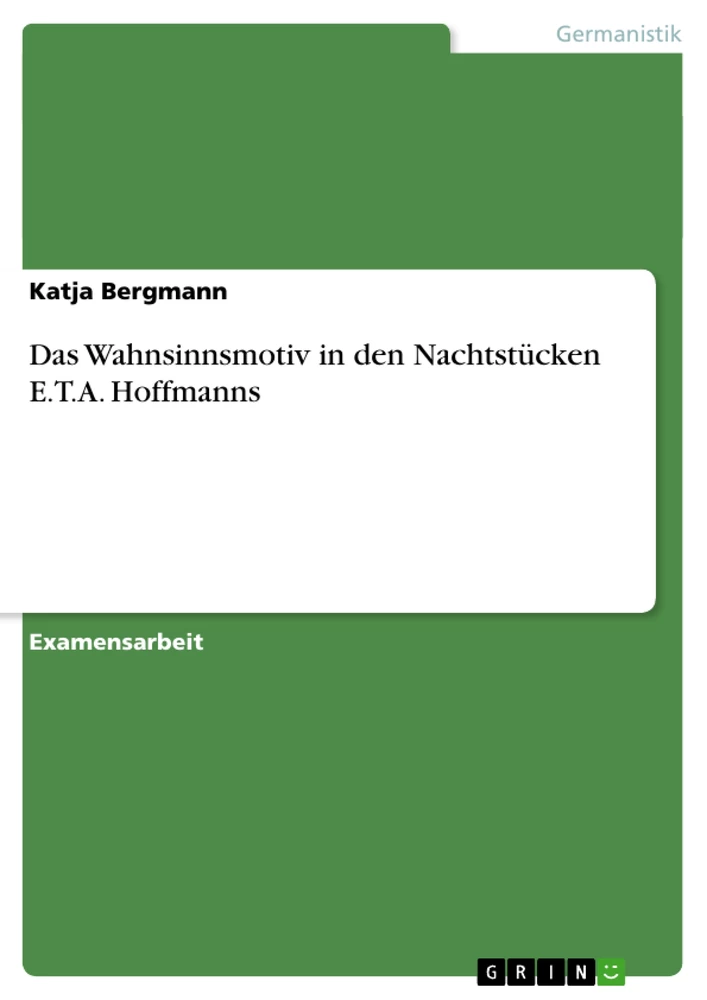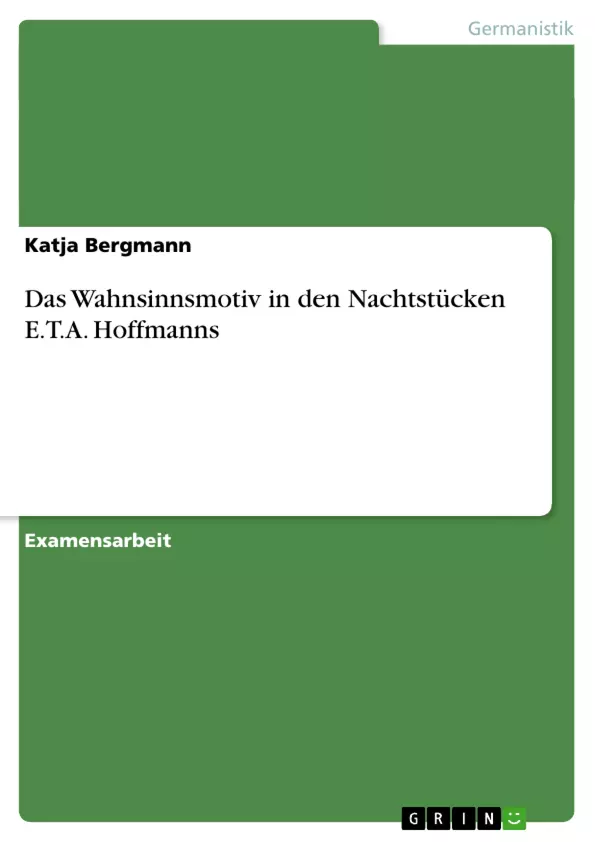Der Leser betritt mit der Lektüre der 1816 und 1818 entstandenen „Nachtstücke“, einem späten Erzählband E.T.A. Hoffmanns, die Welt des Seltsamen, des Verbrechens, des Dämonischen und des Übernatürlichen. Der romantische Dichter widmet sich in seinen acht Erzählungen der Psyche des Menschen sowie den Abgründen der Krankheit. Dabei liefert Hoffmann in facettenreicher Ausgestaltung ein verzerrtes groteskes Bild, das sich durch alle Gesellschaftsschichten zieht. Mehr als die früheren Märchen und Erzählungen, eröffnen die Nachtstücke einen Blick auf die Seiten des Lebens, die dem aufgeklärten Verstand schrecklich und rätselhaft erscheinen. Das „Nächtliche“ beschränkt E.T.A. Hoffmann jedoch nicht allein auf den Raum der Nacht, sondern bettet es in das reale alltägliche Umfeld seiner Zeit. Die acht Erzählungen kennzeichnen den Aufbruchcharakter der Spätromantik. Hoffmann hält als begabter und kritischer Beobachter jedes Details seines gesellschaftlichen Umfeldes fest. Subjektivität bestimmt das Wesen seiner Erzählungen. In der folgenden Arbeit sollen nicht die Person E.T.A. Hoffmann und deren Gesamtwerk im Vordergrund stehen, sondern die Sammlung der „Nachtstücke“ unter besonderer Berücksichtigung des Wahnsinnsmotivs. Die analytische Arbeit umfasst aufgrund des Umfangs der Sammlung lediglich eine Auswahl der Nachstücke. „Der Sandmann“, „Das öde Haus“ und „Das Gelübde“ sollen hinsichtlich ihrer thematischen Ausgestaltung sowie ihrer strukturellen und sprachlich-stilistischen Eigenheiten untersucht werden. Im Anschluss daran werden die Ergebnisse der Analyseschwerpunkte verglichen und ausgewertet. Die Arbeit versucht Einsichten in das Hoffmann’sche Erzählen zu gewinnen und Grundtendenzen zu erarbeiten. Dabei soll herausgestellt werden, welche dichterischen Mittel nutzt, um das Wahnsinnsmotiv vielschichtig verarbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Epoche der Romantik
- 1.1. Historische Hintergründe
- 1.2. Der Einfluss der Romantischen Philosophie und Medizin auf die Literarische Strömung
- 2. E.T.A. Hoffmann und sein literarisches Werk
- 2.1. Der Autor
- 2.1.1. Biografische Zäsuren
- 2.1.2. Ein vielseitiger Künstler
- 2.2. Literarisches Werk
- 2.2.1. Poetisches Schaffen
- 2.2.2. Rezeption
- 2.2.3. Poetologischer Standpunkt
- 2.2.4. Gestaltungsprinzipien
- 2.2.5. Nachtstücke
- 2.2.5.1. Begriffsbestimmung
- 2.2.5.2. Thematische Aspekte
- 2.2.5.3. Strukturelle Organisation
- 2.2.5.4. Sprachliche Schwerpunkte
- 2.2.6. Motiv des Wahnsinns
- 2.2.6.1. Arten des Wahnsinns
- 2.2.6.2. Die vom Wahnsinn betroffenen Figuren
- 2.2.6.3. Die den Wahnsinn auslösenden Figuren
- 3. Einzelanalyse ausgewählter Nachtstücke
- 3.1. Methode
- 3.2. Der Sandmann
- 3.2.1. Inhaltliche Analyse
- 3.2.1.1. Handlungsverlauf
- 3.2.1.2. Art des Wahnsinns
- 3.2.1.3. Wahnsinnsfiguren
- 3.2.1.4. Motivik
- 3.2.2. Strukturelle Analyse
- 3.2.3. Sprachlich-formale Analyse
- 3.3. Das öde Haus
- 3.3.1. Inhaltliche Analyse
- 3.3.1.1. Handlungsverlauf
- 3.3.1.2. Art des Wahnsinns
- 3.3.1.3. Wahnsinnsfiguren
- 3.3.1.4. Motivik
- 3.3.2. Strukturelle Analyse
- 3.3.3. Sprachlich-stilistische Analyse
- 3.4. Das Gelübde
- 3.4.1. Inhaltliche Analyse
- 3.4.1.1. Handlungsverlauf
- 3.4.1.2. Art des Wahnsinns
- 3.4.1.3. Wahnsinnsfiguren
- 3.4.1.4. Motivik
- 3.4.2. Strukturale Analyse
- 3.4.3. Sprachlich-stilistische Analyse
- 4. Auswertung der Analyse
- 4.1. Thematische Ausgestaltung des Wahnsinnsmotiv in den ausgewählten Erzählungen
- 4.2. Strukturelle Einbindung des Wahnsinnsmotivs
- 4.3. E.T.A. Hoffmanns sprachlich-formale Unsetzung
- 4.4. Ergebnisse der Analyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Motiv des Wahnsinns in den "Nachtstücken" von E.T.A. Hoffmann. Ziel ist es, die Vielschichtigkeit des Motivs in den ausgewählten Erzählungen zu analysieren und seine Einbindung in die erzählerische Struktur, die sprachlich-formale Umsetzung und die Gesamtdeutung des Werkes zu beleuchten.
- Die Einordnung des Wahnsinnsmotivs in die Epoche der Romantik
- Die Gestaltung des Wahnsinnsmotivs durch E.T.A. Hoffmann
- Die Analyse des Wahnsinnsmotivs in ausgewählten Nachtstücken
- Die Verbindung von Wahnsinn, Gesellschaft und individueller Erfahrung in den Erzählungen
- Die Bedeutung des Wahnsinnsmotivs für die Gesamtdeutung der "Nachtstücke"
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Erzählband "Nachtstücke" von E.T.A. Hoffmann vor und erläutert die Relevanz des Wahnsinnsmotivs in den Erzählungen. Das erste Kapitel widmet sich der Epoche der Romantik, insbesondere dem Einfluss von Philosophie und Medizin auf die literarische Strömung. Im zweiten Kapitel wird E.T.A. Hoffmann als Autor und sein literarisches Werk vorgestellt, mit besonderem Fokus auf die "Nachtstücke" und das Motiv des Wahnsinns. Das dritte Kapitel analysiert ausgewählte Nachtstücke, wie "Der Sandmann", "Das öde Haus" und "Das Gelübde", um den Gehalt des Wahnsinnsmotivs zu beleuchten. In der Auswertung der Analyse werden die Ergebnisse der einzelnen Kapitel zusammengetragen, wobei insbesondere die thematische Ausgestaltung, die strukturelle Einbindung und die sprachlich-formale Umsetzung des Wahnsinnsmotivs im Vordergrund stehen.
Schlüsselwörter
E.T.A. Hoffmann, Nachtstücke, Wahnsinn, Romantik, Phantastik, Groteske, Gesellschaft, Individuum, Erzählstruktur, Sprachstil, Analyse, Interpretation.
- Quote paper
- Katja Bergmann (Author), 2005, Das Wahnsinnsmotiv in den Nachtstücken E.T.A. Hoffmanns, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48927