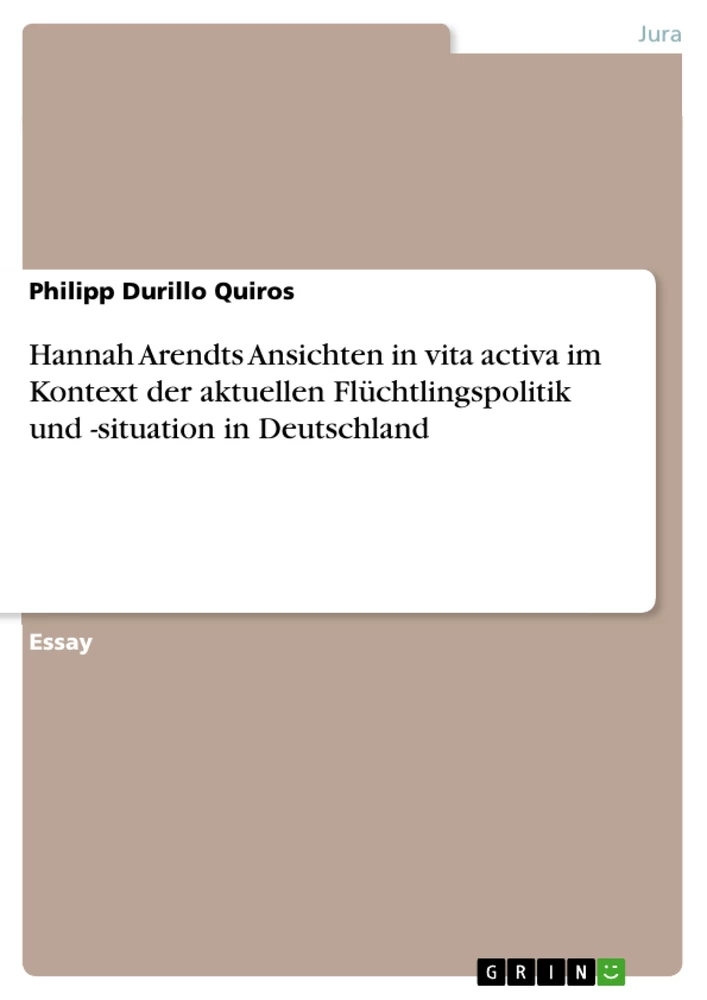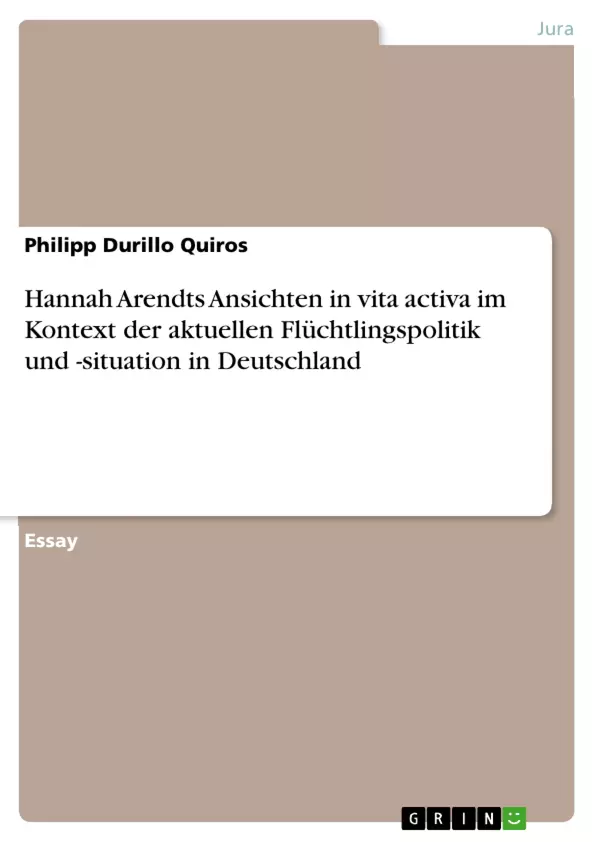Diese Arbeit betrachtet Hannah Arendts Ansichten in vita activa im Kontext der aktuellen Flüchtlingspolitik und -situation in Deutschland.
In meinem Essay möchte ich auf folgendes Zitat von Hannah Arendt Rückbezug nehmen. Es erschien in ihrem vielbeachteten und -diskutierten Werk „Vita activa oder vom tätigen Leben“ (1960) im fünften Kapitel, in dem sie sich mit dem Handeln befasst.
„Dies Risiko, als ein Jemand im Miteinander in Erscheinung zu treten, kann nur auf sich nehmen, wer bereit ist, in diesem Miteinander auch künftig zu existieren (…) und im Miteinander seinesgleichen sich zu bewegen. (…) Auf die ursprüngliche Fremdheit dessen, der durch Geburt als Neuankömmling in die Welt gekommen ist, zu verzichten. (…) Diese Fremdheit realisiert sich in dem einen Fall als Selbstopfer und im anderen in einer absoluten Selbstsucht. (…) Es handelt sich dabei um Phänomene, die nur am Rande des Bereichs menschlicher Angelegenheiten erscheinen dürfen, soll dieser Bereich nicht zerstört werden. (…) In solchen Zeiten verdunkelt sich der Bereich der menschlichen Angelegenheiten. Er verliert die strahlende Helle (…), die unerlässlich ist (…), sollen die Handelnden und Sprechenden über das Gehandelte und Gesprochene hinaus miteinander in Erscheinung treten. In diesem Zwielicht, in dem niemand mehr weiß, wer einer ist, fühlen Menschen sich fremd, nicht nur in einer Welt, sondern auch untereinander. Und in der Stimmung der Fremdheit und Verlassenheit gewinnen die Gestalten der Fremdlinge unter den Menschen, die Heiligen und die Verbrecher, ihre Chance.“ (Arendt, 1960, S. 220/221)
Dieses Zitat soll nun im folgenden auf die aktuelle Flüchtlingssituation im Nahen Osten beziehungsweise Europa bezogen werden. Von vielen Betrachtern unterschiedlicher politischer Spektren wurde auch der negativ konnotierte Begriff einer „Flüchtlingskrise“ verwendet. In ihr vereinigt sich das Aufeinandertreffen verschiedenartiger Kulturen und der von ihr geprägten Individuen. Auf der einen Seite hat man die Flüchtlinge, die bedroht von unmenschlichem Leid und Krieg ihr Land verlassen (müssen), in der Hoffnung in den westlichen Gefilden ihren Frieden zu finden. Auf der anderen befinden sich wiederum die Menschen, die bereits in friedvollen Demokratieverhältnissen leben.
Inhaltsverzeichnis
- Essay: Hannah Arendts Ansichten in vita activa im Kontext der aktuellen Flüchtlingspolitik und -situation in Deutschland
-
Einleitung
- Hannah Arendts Zitat aus „Vita activa“
- Bezug zur Flüchtlingskrise
- Natalität und Fremdheit
- Reflexive Sichtbarkeit und soziales Regulativ
- Das Risiko der Integration
- Arendts eigene Erfahrungen als Jüdin im NS-Regime
- Das „Recht, Rechte zu haben“
- Kritik an Arendts Sicht auf Menschenrechte
- Interkulturelle Vernetzung und Toleranz
- Der „verdunkelte“ Bereich der menschlichen Angelegenheiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay analysiert Hannah Arendts Ansichten über das aktive Leben („vita activa“) im Kontext der aktuellen Flüchtlingspolitik und -situation in Deutschland. Ziel ist es, Arendts Zitat über das Risiko der Begegnung mit Fremden auf die Herausforderungen der Integration und die Entstehung einer gemeinsamen Gesellschaft zu beziehen.
- Das Konzept der Natalität (Gebürtlichkeit) in Arendts Philosophie
- Die Rolle der reflexiven Sichtbarkeit für die Integration
- Die Bedeutung von gegenseitiger Rücksichtnahme für die Koexistenz von verschiedenen Kulturkreisen
- Die Bedeutung der „Recht, Rechte zu haben“ für die Integration von Flüchtlingen
- Die potenziellen Folgen einer durch Fremdheit gespaltenen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Essay beginnt mit einem Zitat von Hannah Arendt aus ihrem Werk „Vita activa“, das sich mit der Begegnung mit Fremden und dem Risiko der Integration befasst.
- Das Konzept der Natalität (Gebürtlichkeit) in Arendts Philosophie wird erläutert, wobei die Fremdheit des Einzelnen bei der Geburt betont wird.
- Der Essay diskutiert die Rolle der reflexiven Sichtbarkeit als soziales Regulativ im Umgang mit Flüchtlingen und der Bedeutung von gesellschaftlichen Normen für das Verhalten im Alltag.
- Das Risiko der Integration wird aus makrotheoretischer Perspektive beleuchtet, wobei Arendts Konzept der „vita activa“ als Grundlage für eine fruchtbare Koexistenz verschiedener Kulturkreise vorgestellt wird.
- Arendts eigene Erfahrungen als Jüdin im NS-Regime und ihre Sicht auf das Flüchtlingsdasein werden als Kontext für ihre Aussagen über Menschenrechte und Integration dargestellt.
- Arendts Konzept des „Rechts, Rechte zu haben“ wird im Hinblick auf die Situation von Flüchtlingen diskutiert, wobei die Frage nach der Gültigkeit von Menschenrechten außerhalb des Heimatlandes gestellt wird.
- Kritik an Arendts Sicht auf Menschenrechte wird geübt, wobei die Möglichkeit der Integration von Flüchtlingen in neue Gesellschaften und die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit für die Wahrung von Menschenrechten betont werden.
- Die Bedeutung der interkulturellen Vernetzung und Toleranz für eine kommunikativ-produktive Gesellschaft wird hervorgehoben.
- Der Essay schließt mit einer metaphorischen Beschreibung der „verdunkelten“ Gesellschaft, die durch die Folgen der Fremdheit und der Spaltung bedroht ist.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter des Essays sind: Hannah Arendt, vita activa, Natalität, Fremdheit, Flüchtlingskrise, Integration, reflexive Sichtbarkeit, soziale Normen, Menschenrechte, interkulturelle Vernetzung, Toleranz, Gesellschaft, Verdunkelung.
Häufig gestellte Fragen
Wie verknüpft der Essay Hannah Arendt mit der Flüchtlingspolitik?
Der Essay nutzt Arendts Werk „Vita activa“, um das Risiko des Miteinanders und die Begegnung mit Fremden im Kontext der aktuellen Flüchtlingssituation in Deutschland zu analysieren.
Was bedeutet der Begriff „Natalität“ bei Hannah Arendt?
Natalität (Gebürtlichkeit) bezeichnet die ursprüngliche Fremdheit jedes Menschen, der als Neuankömmling in die Welt tritt, und die Fähigkeit, etwas Neues zu beginnen.
Was ist mit dem „Recht, Rechte zu haben“ gemeint?
Dies ist Arendts zentrales Konzept, das besagt, dass Menschen ein grundlegendes Recht auf die Zugehörigkeit zu einer politischen Gemeinschaft benötigen, um überhaupt Menschenrechte beanspruchen zu können.
Welche Rolle spielt die „reflexive Sichtbarkeit“?
Sie dient als soziales Regulativ für das Verhalten im Alltag und ist entscheidend dafür, wie Flüchtlinge in der Gesellschaft wahrgenommen und integriert werden.
Welchen Einfluss hatte Arendts eigene Biografie auf ihre Ansichten?
Ihre Erfahrungen als jüdischer Flüchtling während des NS-Regimes prägten maßgeblich ihre Sicht auf das Flüchtlingsdasein und die Bedeutung staatlicher Zugehörigkeit.
- Citation du texte
- Philipp Durillo Quiros (Auteur), 2017, Hannah Arendts Ansichten in vita activa im Kontext der aktuellen Flüchtlingspolitik und -situation in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/489334