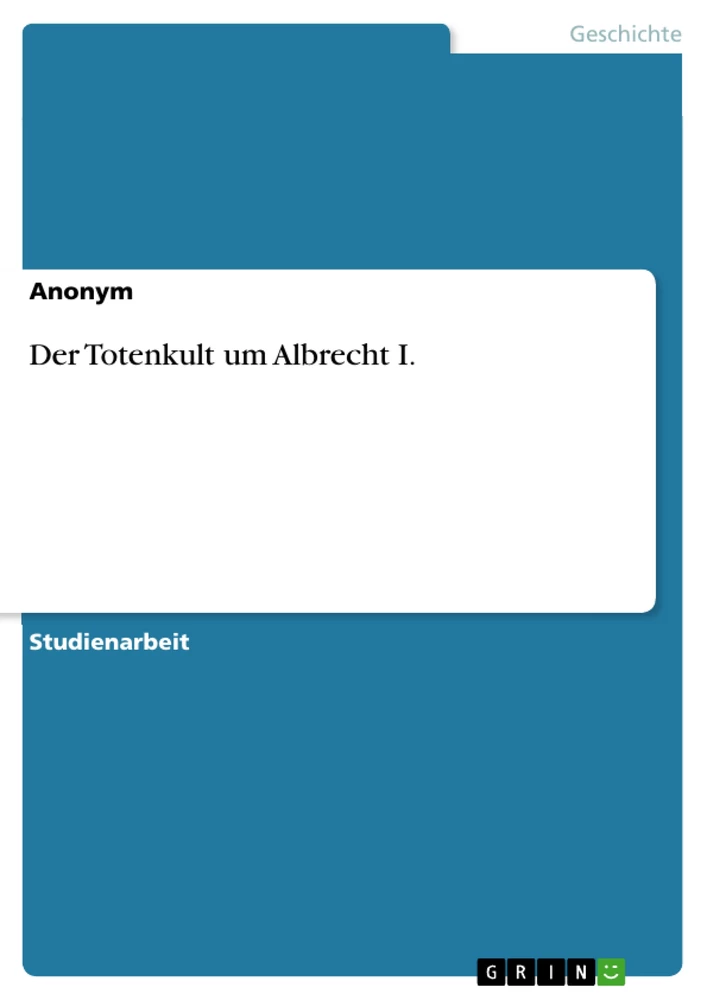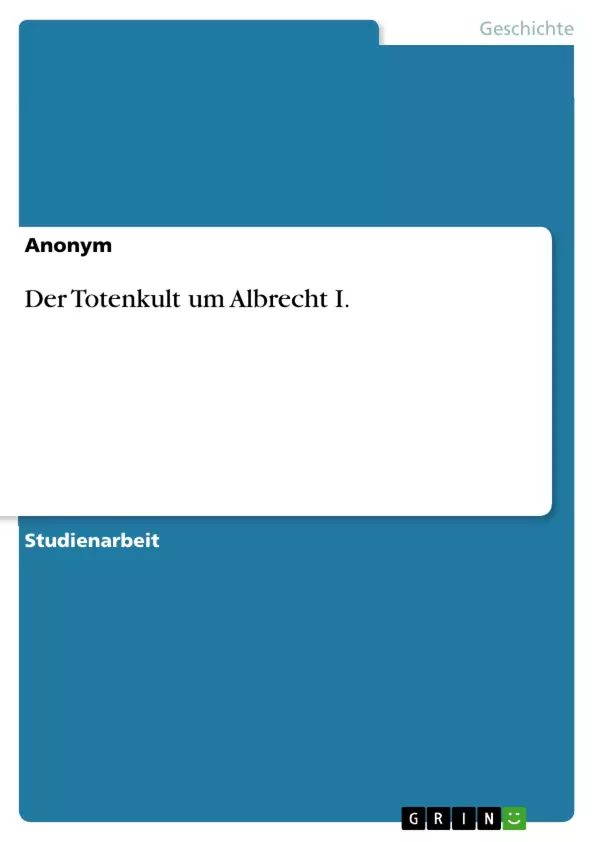Memoria tauchte vor allem sehr häufig im christlichen Mittelalter auf. Sie hatte zum einen die Funktion, das Seelenheil des Verstorbenen im Jenseits zu sichern, zugleich aber auch die Aufgabe, sein Andenken im Diesseits zu bewahren. Wie Memoria für den 1308 ermordeten habsburgischen König Albrecht I. realisiert wurde, werde ich im Folgenden darstellen. Hierbei sind mehrere Fragen zu berücksichtigen: Inwieweit sind Albrechts Todesumstände mit der Memoria verknüpft? Setzte etwa ein plötzlicher, gewaltsamer Tod einen besonderen Totenkult voraus? Ist die einzige Intention bei der Memoria ausschließlich das Bemühen um das Seelenheil des Verstorbenen oder steckt dort noch mehr dahinter?
Um dies beantworten zu können, ist es nötig, die verschiedenen Orte, an denen Totengedenken für den König abgehalten wurde, zu betrachten: Wettingen, Speyer und Königsfelden. Hierfür lassen sich einige Quellen, wie Necrologien, Memorialbilder, Gräber, Urkunden und Chroniken finden. Die Königsfelder Chronik, die Chronik des Johann von Winterthur, die Sarkophaginschrift von Wettingen und die Glasmalereien von Königsfelden werden dabei unter anderem eine wichtige Rolle spielen. Was den Forschungstand zu meinem Thema anbelangt, lässt sich sagen, dass Memoria im Mittelalter zwar allgemein zahlreich behandelt wird, Darstellungen über den Totenkult Albrechts hingegen in ausführlicher Form nicht so weit verbreitet sind. Ich werde mich deshalb im Folgenden auch auf einige Quellen stützen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Geschichtlichter Überblick
- Albrechts Bestattungen
- Das Provisorium Wettingen und die Sorge um das Seelenheil
- Der Dom zu Speyer als endgültige Grabstätte
- Das Doppelkloster Königsfelden: Sühnekloster und habsburgische Familiengrablege
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem Totenkult um Albrecht I., den ermordeten habsburgischen König. Er untersucht, wie Albrechts Todesumstände mit dem Konzept der Memoria verknüpft sind und welche Rolle der Totenkult für die Sicherung seines Seelenheils und die Bewahrung seines Andenkens spielte.
- Die Bedeutung von Memoria im christlichen Mittelalter
- Die verschiedenen Orte des Totengedenkens für Albrecht I. (Wettingen, Speyer, Königsfelden)
- Die Rolle von Quellen wie Necrologien, Memorialbildern, Gräbern, Urkunden und Chroniken
- Die Bedeutung von Albrechts plötzlichem und gewaltsamem Tod für den Totenkult
- Die Intentionen hinter dem Totenkult: Seelenheil, Ruhm, politisches Kalkül
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert den Begriff der Memoria und ihre Bedeutung im Mittelalter. Sie stellt die Forschungsfrage nach der Rolle von Memoria im Zusammenhang mit dem Tod König Albrechts I. und den verschiedenen Orten des Totengedenkens.
Der Hauptteil bietet einen geschichtlichen Überblick über Albrechts Leben und seinen Tod. Im Fokus steht die Ermordung durch seinen Neffen Johann Parricida und die Ereignisse, die zu diesem tragischen Ereignis führten. Die Kapitel über Albrechts Bestattungen beleuchten die verschiedenen Stationen seines Leichnams: Das Provisorium in Wettingen als Ort der ersten Bestattung und die endgültige Grabstätte im Dom zu Speyer. Dabei werden die Beweggründe für die Wahl dieser Orte und die Bedeutung des Totengedenkens in diesem Zusammenhang analysiert.
Schlüsselwörter
Memoria, Totenkult, Albrecht I., Habsburger, Mittelalter, Seelenheil, Ermordung, Wettingen, Speyer, Königsfelden, Necrologien, Memorialbilder, Gräber, Urkunden, Chroniken, Geschichte, Kunstgeschichte, Kulturgeschichte
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „Memoria“ im Mittelalter?
Memoria bezeichnet das institutionalisierte Totengedenken. Es diente einerseits der Sicherung des Seelenheils des Verstorbenen im Jenseits und andererseits der Bewahrung seines Andenkens im Diesseits.
Wie starb der habsburgische König Albrecht I.?
Albrecht I. wurde im Jahr 1308 von seinem Neffen Johann „Parricida“ ermordet. Dieser gewaltsame Tod erforderte einen besonderen Totenkult zur Sühne und zum Gedenken.
Welche Orte waren für den Totenkult Albrechts I. zentral?
Wichtige Orte waren Wettingen (provisorische Bestattung), der Dom zu Speyer (endgültige Grabstätte) und das Doppelkloster Königsfelden, das als Sühnekloster und habsburgische Grablege gegründet wurde.
Welche Quellen belegen den Totenkult um Albrecht I.?
Zu den Quellen zählen Necrologien (Totenverzeichnisse), Memorialbilder, Glasmalereien in Königsfelden sowie Chroniken wie die des Johann von Winterthur.
Steckte hinter der Memoria auch eine politische Absicht?
Ja, neben dem Seelenheil diente der Totenkult auch der dynastischen Repräsentation der Habsburger und der politischen Legitimation ihres Herrschaftsanspruchs.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2015, Der Totenkult um Albrecht I., Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/489444