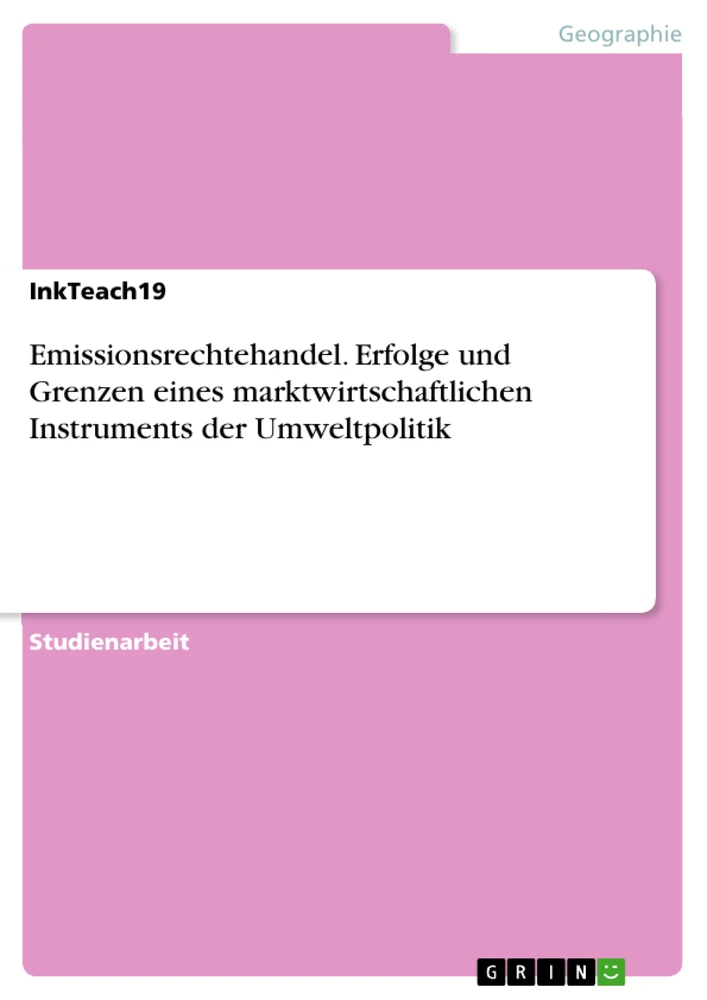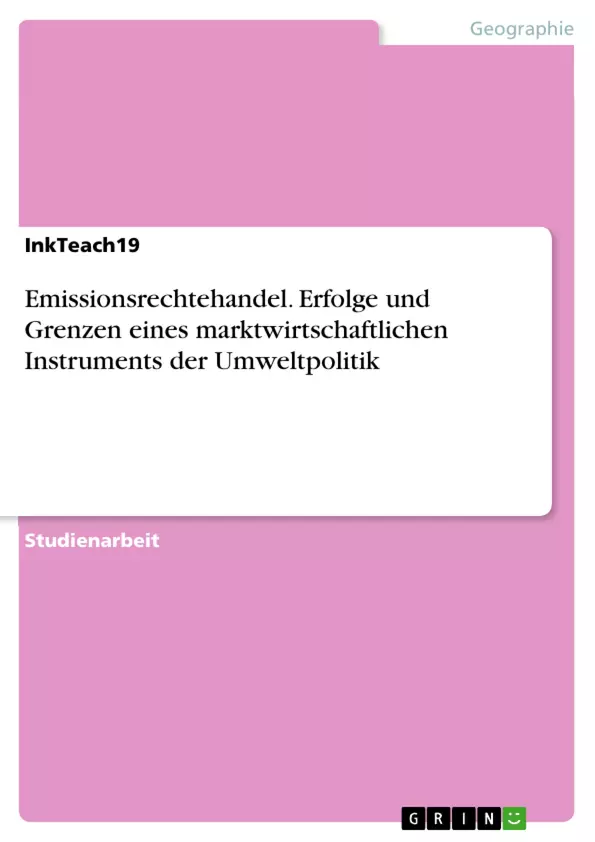Der Europäische Emissionsrechtshandel ist ein umstrittenes Instrument. Er wird zum einen in den Himmel gelobt und als die Chance schlechthin beschrieben und im selben Atemzug von Kritikern als durchweg negativ und von Vorderrein zum Scheitern verurteilt missbilligt. Die Dringlichkeit etwas gegen den (anthropogen verursachten) Klimawandel zu unternehmen ist weitestgehend anerkannt, Emissionsrechtehandel hin- oder her. Die noch relativ junge globale Klimapolitik weist nur bedingt Erfolge auf und strahlt eher mit Misserfolgen und Überkalkulierungen.
Das Europäische Emissionshandelsystem wird vom Großteil der Befürworter als das mit Abstand wichtigste Klimaschutzinstrument innerhalb der EU betitelt und soll dafür sorgen, dass „die Treibhausgas-Emissionen der teilnehmenden Energiewirtschaft und energieintensiven Industrie reduziert werden“ (Umweltbundesamt 2015). Das wesentliche Merkmal des Abkommens beinhaltet die Vergabe sogenannter Emissionszertifikate, welche vergeben und verhandelt werden können. Diese beziehen sich auf den Kohlenstoffdioxidausstoß pro Tonne und können je nach marktwirtschaftlicher Lage preislich (stark) schwanken.
Das Projekt startete ursprünglich schon in den 1990er Jahren und wurde erst nach anfänglichen Schwierigkeiten im Rahmen des Protokolls von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, kurz Kyoto-Protokoll, festgelegt und umsetzungsfähig gemacht (Konstantin, P. 2013). Des Weiteren wurden drei Phasen für die Praxisphase beschlossen, die Pilotphase, Phase II, sowie Phase III (ibid.).
Im Rahmen dieser Studienarbeit wird zu Beginn die Historie, mitsamt Bedingungen und Geschehnissen, erläutert, welche zur Idee des Emissionsrechtehandels geführt hat. Anschließend wird sich näher mit den drei Phasen des Systems beschäftigt und im Nachhinein die Erfolge und die Grenzen aufgezeigt. Zum Schluss folgt ein Fazit sowie eine kurze Zukunftsprognose.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entstehungsgeschichte
- 2.1 Kyoto-Protokoll
- 2.2 Greenhouse gases im Kyoto-Protokoll
- 3. Klimaschutzrechtliche Rahmenbedingungen
- 3.1 Das EU Emissionshandelssystem
- 3.2 Die Ebenen des EU-Emissionshandels
- 3.3 Prinzipielle Funktionsweise des Emissionshandels
- 3.4 CDM- und JI-Projekte
- 4. Die dritte Handelsperiode 2013-2020
- 4.1 Zuteilungsregeln für die dritte Handelsperiode
- 5. Reform des EU-EHS - aber richtig!
- 5.1 Überblick
- 5.2 Woher kommen die hohen Überschüsse an Zertifikaten?
- 5.3 Die Marktstabilitätsreserve
- 5.4 Preiskorridor und Emissionshandel in Reinform - Die besseren Alternativen?
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Europäische Emissionshandelssystem (EU-EHS), ein marktwirtschaftliches Instrument der Umweltpolitik zur Reduktion von Treibhausgasemissionen. Die Zielsetzung besteht darin, die Entstehungsgeschichte, die Funktionsweise, die Erfolge und die Grenzen des EU-EHS zu analysieren und mögliche Reformansätze zu diskutieren.
- Entstehungsgeschichte und rechtliche Rahmenbedingungen des EU-EHS
- Funktionsweise des Emissionshandels und seine Prinzipien
- Analyse der Erfolge und Grenzen des EU-EHS, insbesondere im Hinblick auf die hohen Zertifikatsüberschüsse
- Diskussion von Reformoptionen zur Verbesserung der Effektivität des EU-EHS
- Bewertung des EU-EHS als Klimaschutzinstrument
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt das Europäische Emissionshandelssystem (EU-EHS) als umstrittenes, aber wichtiges Instrument der Klimapolitik vor. Sie hebt die gegensätzlichen Beurteilungen des Systems hervor und betont die Notwendigkeit von Maßnahmen gegen den Klimawandel. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau, der die Entstehungsgeschichte, die Funktionsweise und die Bewertung des EU-EHS umfasst.
2. Entstehungsgeschichte: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Emissionshandels, beginnend mit dem Kyoto-Protokoll. Es beschreibt die rechtlich verbindlichen Emissionsgrenzen für Industrieländer und die Einführung marktwirtschaftlicher Mechanismen zur Emissionsreduktion. Die Rolle des Kyoto-Protokolls bei der Festlegung von Reduktionszielen und der Etablierung des EU-EHS wird detailliert dargestellt, inklusive der Herausforderungen und Vereinbarungen ( Burden Sharing) unter den EU-Mitgliedstaaten.
3. Klimaschutzrechtliche Rahmenbedingungen: Dieses Kapitel beschreibt die rechtlichen und institutionellen Grundlagen des EU-EHS. Es erläutert die Funktionsweise des Systems, die verschiedenen Ebenen des Handels und die Rolle von CDM- und JI-Projekten. Der Fokus liegt auf der detaillierten Erläuterung der rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen des EU-EHS, seiner Funktionsmechanismen und der damit verbundenen Herausforderungen. Die verschiedenen Ebenen und Prinzipien des Systems werden systematisch dargestellt.
4. Die dritte Handelsperiode 2013-2020: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die dritte Handelsperiode des EU-EHS (2013-2020) und analysiert die spezifischen Regelungen dieser Phase, insbesondere die Zuteilungsregeln für Emissionszertifikate. Es untersucht die Herausforderungen und Anpassungen im Vergleich zu den vorherigen Perioden und analysiert den Einfluss dieser Regelungen auf die Wirksamkeit des Systems. Die Bedeutung der Zuteilungsregeln für den Erfolg des Emissionshandelssystems wird hervorgehoben.
5. Reform des EU-EHS - aber richtig!: Dieses Kapitel befasst sich mit der Notwendigkeit einer Reform des EU-EHS und analysiert die Ursachen für die hohen Überschüsse an Emissionszertifikaten. Es diskutiert verschiedene Reformansätze, darunter die Marktstabilitätsreserve und alternative Modelle wie einen Preiskorridor, und bewertet deren jeweilige Vor- und Nachteile. Der Fokus liegt auf einer kritischen Bewertung der bestehenden Mechanismen und der Suche nach effektiven Reformen, um die Wirksamkeit des Systems zu steigern.
Schlüsselwörter
Emissionsrechtehandel, EU-Emissionshandelssystem (EU-EHS), Kyoto-Protokoll, Treibhausgasemissionen, Klimaschutz, Marktstabilitätsreserve, Zertifikatsüberschüsse, Klimapolitik, Emissionsreduktion, marktwirtschaftliche Instrumente.
Häufig gestellte Fragen zum Europäischen Emissionshandelssystem (EU-EHS)
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Europäische Emissionshandelssystem (EU-EHS). Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Schlüsselwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf der Entstehungsgeschichte, der Funktionsweise, den Erfolgen, den Grenzen und möglichen Reformansätzen des EU-EHS.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Entstehungsgeschichte des EU-EHS im Kontext des Kyoto-Protokolls, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Funktionsweise des Emissionshandels einschließlich CDM- und JI-Projekte, die dritte Handelsperiode (2013-2020) mit ihren Zuteilungsregeln, die Problematik der hohen Zertifikatsüberschüsse und mögliche Reformen wie die Marktstabilitätsreserve und alternative Ansätze.
Wie ist das Dokument aufgebaut?
Das Dokument ist Kapitel für Kapitel aufgebaut, beginnend mit einer Einleitung und endend mit einem Fazit. Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst. Zusätzlich enthält es ein Inhaltsverzeichnis, eine Darstellung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte sowie ein Verzeichnis der Schlüsselbegriffe.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Die Zielsetzung des Dokuments ist die Analyse des EU-EHS, seiner Entstehungsgeschichte, Funktionsweise, Erfolge und Grenzen. Es diskutiert außerdem mögliche Reformansätze zur Verbesserung der Effektivität des Systems als Instrument des Klimaschutzes.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Das Dokument umfasst Kapitel zu folgenden Themen: Einleitung (Vorstellung des EU-EHS), Entstehungsgeschichte (Kyoto-Protokoll und die Entwicklung des EU-EHS), Klimaschutzrechtliche Rahmenbedingungen (Funktionsweise und rechtliche Grundlagen), Die dritte Handelsperiode 2013-2020 (Zuteilungsregeln), Reform des EU-EHS (Ursachen für Überschüsse und Reformansätze) und ein Fazit.
Warum gibt es hohe Überschüsse an Emissionszertifikaten?
Das Dokument analysiert die Ursachen für die hohen Überschüsse an Emissionszertifikaten im EU-EHS. Diese Problematik wird im Kapitel zur Reform des EU-EHS detailliert behandelt und verschiedene Erklärungsansätze werden diskutiert.
Welche Reformansätze werden diskutiert?
Das Dokument diskutiert verschiedene Reformansätze zur Verbesserung des EU-EHS, darunter die Einführung einer Marktstabilitätsreserve und alternative Modelle wie einen Preiskorridor. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze werden bewertet.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Dokument verwendet?
Schlüsselbegriffe umfassen: Emissionsrechtehandel, EU-Emissionshandelssystem (EU-EHS), Kyoto-Protokoll, Treibhausgasemissionen, Klimaschutz, Marktstabilitätsreserve, Zertifikatsüberschüsse, Klimapolitik, Emissionsreduktion, marktwirtschaftliche Instrumente.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist für Wissenschaftler, Studenten, Politiker und alle anderen Personen relevant, die sich mit dem Europäischen Emissionshandelssystem, Klimapolitik und dem Thema Klimaschutz auseinandersetzen.
Wo finde ich weitere Informationen zum EU-EHS?
Weitere Informationen zum EU-EHS finden sich auf den Webseiten der Europäischen Kommission und anderer relevanter Institutionen, die sich mit Klimapolitik und Emissionshandel befassen. Die genaue Quellenangabe hängt vom spezifischen Thema ab.
- Citar trabajo
- InkTeach19 (Autor), 2015, Emissionsrechtehandel. Erfolge und Grenzen eines marktwirtschaftlichen Instruments der Umweltpolitik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/489461