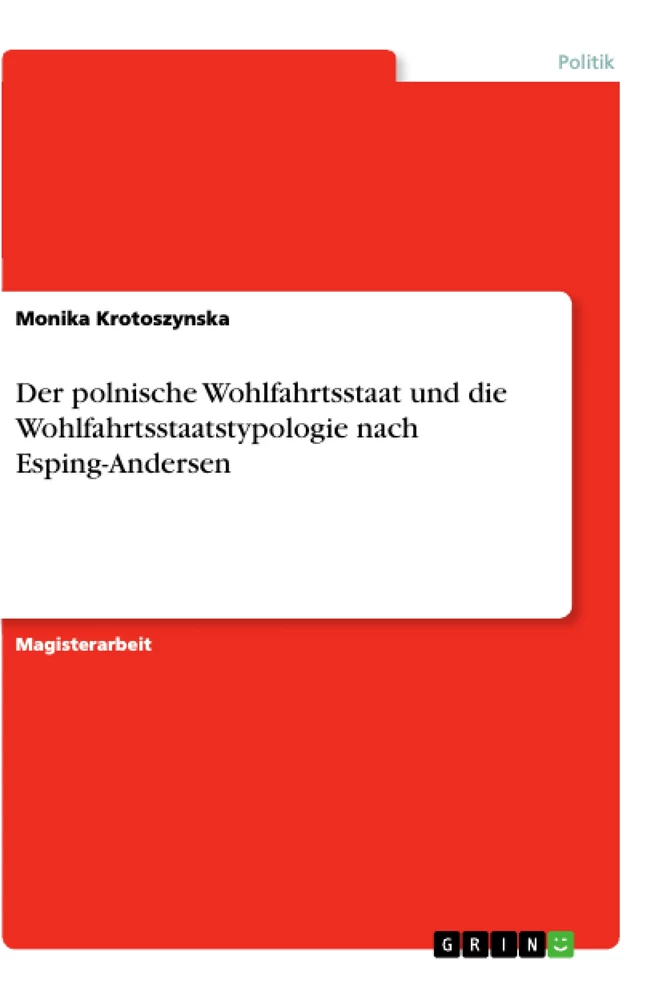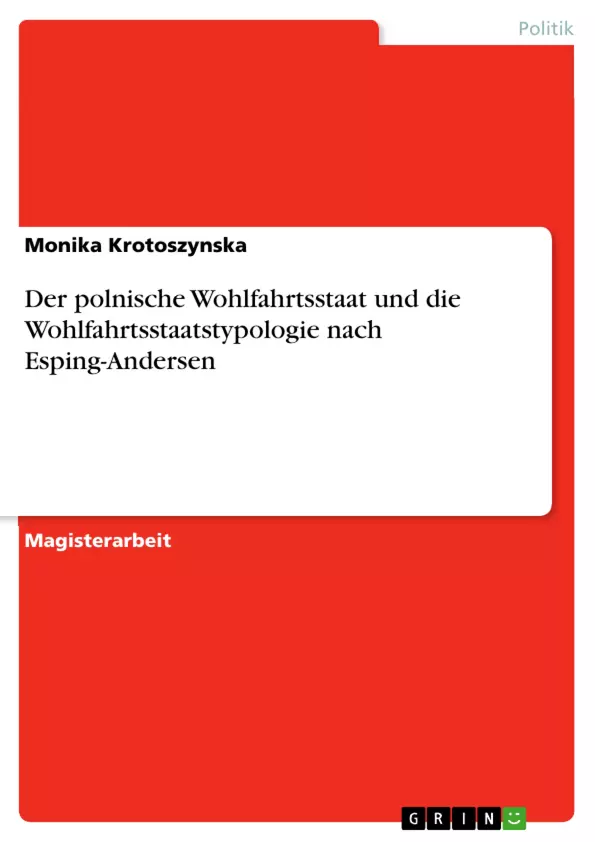Die folgende Arbeit mit dem Titel "Der polnische Wohlfahrtsstaat und die Wohlfahrtsstaatstypologie Esping-Andersen" hat sich zum Hauptziel gesetzt, die Konzeption des Wohlfahrtsstaates, die größte Erfindung des 20. Jahrhunderts, darzustellen. Es soll vor allem die Lage der polnischen Sozialpolitik vor und nach den Transformationen im Jahre 1999 analysiert werden.
Zudem soll die Arbeit klären, welche Wohlfahrtsstaatstypen es nach Gøsta Esping-Andersen gibt und zu welchem Polen gehört. Darum lautet die konkrete Frage, in welcher der Wohlfahrtstypen nach Gøsta Esping-Andersen sich Polen einordnen lässt.
Die Arbeit besteht aus sechs Kapiteln. Das erste beinhaltet eine Einführung in die Thematik der Arbeit und erläutert die ihr zu Grunde liegenden theoretischen Ansätze. Es wird dabei auf die methodische Vorgehensweise, die Struktur der Arbeit und der Forschungsstand zum Wohlfahrtsstaat in Polen eingegangen.
Im zweiten Kapitel soll der Begriff des Wohlfahrtsstaates definiert werden. Dazu wird wird die sich am Ende der 1980er Jahre entwickelte Typologie der Wohlfahrtsstaaten von Gøsta Esping-Andersen analysiert. Dieses Kapitel wird auch dem liberalen, konservativen und sozialdemokratischen Typ gewidmet.
Darauf folgend soll im Hauptteil der Arbeit der Wohlfahrtsstaat in Polen untersucht werden. Um diesen in seiner heutigen Verfasstheit verstehen zu können, ist es notwendig, die sozioökonomische Situation in Polen und ihren Wandel zu erfassen. Daher wird im dritten Kapitel die sozioökonomische Situation kurz nach dem Jahre 1989 sowie nach dem Beitritt in die Europäische Union, die im Jahre 2004 stattfand, erläutert.
Den Schwerpunkt der Arbeit stellt das vierte Kapitel dar. Neben einer allgemeinen Beschreibung des polnischen Sozialsystems steht die vergleichende Analyse unterschiedlich ausgewählter Bereiche des polnischen Wohlfahrtsstaates im Fokus. Es werden dabei sowohl die Rentenversicherung, Sach- und Geldleistungen bei Krankheit, Arbeitslosigkeit und Berufsunfähigkeit als auch die Sozialhilfe sowie alle anderen Pflegeleistungen sozialer Sicherheit untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Fragestellung
- 1.2 Methodische Vorgehensweise
- 1.3 Forschungstand zum Wohlfahrtsstaat in Polen
- 1.4 Struktur der Arbeit
- 2. Grundzüge des Wohlfahrtstaates
- 2.1 Wohlfahrtsstaat – Definition
- 2.3 Die drei Wohlfahrtsstaatsregime
- 2.3.1 Der liberale Typus
- 2.3.2 Der konservative Typus
- 2.3.3 Der sozialdemokratische Typus
- 2.4 Dekommodifizierung
- 2.5 Kritik an Esping-Andersens drei Wohlfahrtsregime
- 2.6 Die Theorie der Entstehung des modernen Sozialstaates
- 3. Polen auf dem Weg in die neue Wohlfahrtstaatlichkeit
- 3.1 Situation nach der Wende 1989
- 3.2 Situation nach dem EU Beitritt 2004
- 4. Beschreibung ausgewählter Bereiche sozialer Sicherheit
- 4.1 Einblick in die gegenwärtige Sozialpolitik in Polen
- 4.1.1 Das polnische Wohlfahrtssystem im Wandel
- 4.2 Rentenversicherung
- 4.3 Krankenversicherung
- 4.3.1 Sachleistungen
- 4.3.2 Geldleistungen
- 4.4 Familienleistungen
- 4.4.1 Mutterschafts- und Vaterschaftsgeld
- 4.4.2 Kindergeld
- 4.4.3 Pflegeleistungen
- 4.5 Leistungen bei Invalidität
- 4.6 Leistungen bei Berufskrankheiten und Arbeitsunfällen
- 4.7 Leistungen bei Arbeitslosigkeit
- 4.7.1 Sachleistungen
- 4.7.2 Geldleistungen
- 4.8 Mindestsicherung
- 4.8.1 Geldleistungen
- 4.8.2 Sachleistungen
- 4.9 Sozialprogramme
- 5. Zur Frage der Typologisierung der Wohlfahrtsstaatlichkeit in Polen
- 5.1 Einteilungsversuch der polnischen Wohlfahrtsstaatlichkeit
- 6. In welche Richtung geht die polnische Wohlfahrtsstaatlichkeit?
- 6.1 Tendenzen der Entwicklungen in Polen
- 6.2 Richtung der polnischen Wohlfahrtstaatspolitik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den polnischen Wohlfahrtsstaat im Kontext der Wohlfahrtsstaatstypologie nach Esping-Andersen. Das Hauptziel besteht in der Untersuchung der polnischen Sozialpolitik vor und nach den Transformationsprozessen von 1989, mit dem Fokus darauf, in welches der von Esping-Andersen definierten Wohlfahrtsstaatsregime sich Polen einordnen lässt. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des polnischen Sozialsystems und untersucht ausgewählte Bereiche der sozialen Sicherheit.
- Entwicklung des polnischen Wohlfahrtsstaates seit 1989
- Einordnung Polens in die Wohlfahrtsstaatstypologie nach Esping-Andersen
- Analyse ausgewählter Bereiche der sozialen Sicherheit in Polen (z.B. Renten-, Kranken-, und Familienversicherung)
- Vergleichende Betrachtung des polnischen Systems mit anderen Wohlfahrtsstaaten
- Zukünftige Entwicklungstendenzen der polnischen Wohlfahrtsstaatlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, beschreibt die Forschungsfrage – die Einordnung Polens in die Wohlfahrtsstaatstypologie nach Esping-Andersen – und skizziert die methodische Vorgehensweise. Es beleuchtet den bisherigen Forschungsstand, der eine Lücke in der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung für Polen aufzeigt, und beschreibt die Struktur der Arbeit. Die Einleitung betont die Bedeutung der Analyse der sozioökonomischen Transformationen in Polen seit 1989.
2. Grundzüge des Wohlfahrtstaates: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Wohlfahrtsstaates und analysiert die Typologie von Esping-Andersen, die drei Wohlfahrtsstaatsregime (liberal, konservativ, sozialdemokratisch) umfassend. Es beschreibt die Konzepte der Dekommodifizierung und Stratifizierung im Kontext der Wohlfahrtsstaaten und diskutiert die Kritik an Esping-Andersens Typologie. Die theoretischen Grundlagen für die spätere Analyse des polnischen Systems werden hier gelegt.
3. Polen auf dem Weg in die neue Wohlfahrtstaatlichkeit: Dieses Kapitel beschreibt die sozioökonomische Situation in Polen nach dem Fall des Kommunismus 1989 und nach dem EU-Beitritt 2004. Es analysiert die Veränderungen und Herausforderungen für den Aufbau eines neuen Wohlfahrtsstaates in Polen und legt die Grundlage für das Verständnis der Entwicklung des polnischen Sozialsystems.
4. Beschreibung ausgewählter Bereiche sozialer Sicherheit: Dieses Kapitel bietet einen detaillierten Überblick über das polnische Sozialsystem, einschließlich einer vergleichenden Analyse verschiedener Bereiche wie Renten-, Kranken-, und Familienversicherung, Leistungen bei Arbeitslosigkeit, Invalidität und Berufsunfällen sowie Mindestsicherung und Sozialprogramme. Es untersucht die Struktur und Funktionsweise dieser Systeme und verdeutlicht die Entwicklung und den Wandel des polnischen Wohlfahrtsstaates.
5. Zur Frage der Typologisierung der Wohlfahrtsstaatlichkeit in Polen: Dieses Kapitel widmet sich dem Versuch, die polnische Wohlfahrtsstaatlichkeit in die Typologie von Esping-Andersen einzuordnen. Es analysiert die Merkmale des polnischen Systems und diskutiert dessen Positionierung im Vergleich zu den drei idealtypischen Regimen.
Schlüsselwörter
Polnischer Wohlfahrtsstaat, Esping-Andersen, Wohlfahrtsstaatstypologie, Sozialpolitik, Transformationsprozess, soziale Sicherheit, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Familienleistungen, Arbeitslosigkeit, Osteuropa, EU-Beitritt, Dekommodifizierung, Stratifizierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum polnischen Wohlfahrtsstaat
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den polnischen Wohlfahrtsstaat im Kontext der Wohlfahrtsstaatstypologie nach Esping-Andersen. Das Hauptziel ist die Einordnung Polens in eines der von Esping-Andersen definierten Wohlfahrtsstaatsregime. Die Arbeit untersucht die Entwicklung des polnischen Sozialsystems und ausgewählte Bereiche der sozialen Sicherheit vor und nach den Transformationsprozessen von 1989.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des polnischen Wohlfahrtsstaates seit 1989, die Einordnung Polens in die Wohlfahrtsstaatstypologie nach Esping-Andersen, die Analyse ausgewählter Bereiche der sozialen Sicherheit (Renten-, Kranken-, und Familienversicherung), einen Vergleich mit anderen Wohlfahrtsstaaten und zukünftige Entwicklungstendenzen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung (Fragestellung, Methodik, Forschungsstand, Struktur), Grundzüge des Wohlfahrtstaates (Definition, Esping-Andersens Typologie, Dekommodifizierung, Kritik), Polen auf dem Weg in die neue Wohlfahrtstaatlichkeit (Situation nach 1989 und 2004), Beschreibung ausgewählter Bereiche sozialer Sicherheit (detaillierte Analyse verschiedener Sozialleistungen), Typologisierung der Wohlfahrtsstaatlichkeit in Polen (Einordnung in Esping-Andersens Typologie) und die zukünftige Richtung der polnischen Wohlfahrtsstaatlichkeit (Entwicklungstendenzen und -politik).
Wie wird die methodische Vorgehensweise beschrieben?
Die methodische Vorgehensweise wird in der Einleitung erläutert. Sie beinhaltet die Analyse der polnischen Sozialpolitik im Kontext der Wohlfahrtsstaatstypologie nach Esping-Andersen. Die Arbeit vergleicht das polnische System mit den drei idealtypischen Regimen und untersucht ausgewählte Bereiche der sozialen Sicherheit, um eine Einordnung vorzunehmen.
Welche Bereiche der sozialen Sicherheit werden analysiert?
Die Arbeit analysiert detailliert die Rentenversicherung, Krankenversicherung (Sach- und Geldleistungen), Familienleistungen (Mutterschafts-/Vaterschaftsgeld, Kindergeld, Pflegeleistungen), Leistungen bei Invalidität, Leistungen bei Berufskrankheiten und Arbeitsunfällen, Leistungen bei Arbeitslosigkeit (Sach- und Geldleistungen) und die Mindestsicherung (Sach- und Geldleistungen).
Wie wird Polen in die Wohlfahrtsstaatstypologie nach Esping-Andersen eingeordnet?
Die Einordnung Polens in die Typologie von Esping-Andersen erfolgt im fünften Kapitel. Die Arbeit analysiert die Merkmale des polnischen Systems und diskutiert dessen Positionierung im Vergleich zu den drei idealtypischen Regimen (liberal, konservativ, sozialdemokratisch).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Polnischer Wohlfahrtsstaat, Esping-Andersen, Wohlfahrtsstaatstypologie, Sozialpolitik, Transformationsprozess, soziale Sicherheit, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Familienleistungen, Arbeitslosigkeit, Osteuropa, EU-Beitritt, Dekommodifizierung, Stratifizierung.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zur Entwicklung und zukünftigen Richtung der polnischen Wohlfahrtsstaatlichkeit, basierend auf der Analyse der ausgewählten Bereiche der sozialen Sicherheit und der Einordnung in die Typologie nach Esping-Andersen. Die genauen Schlussfolgerungen sind im Text selbst nachzulesen.
- Citar trabajo
- Monika Krotoszynska (Autor), 2017, Der polnische Wohlfahrtsstaat und die Wohlfahrtsstaatstypologie nach Esping-Andersen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/489549