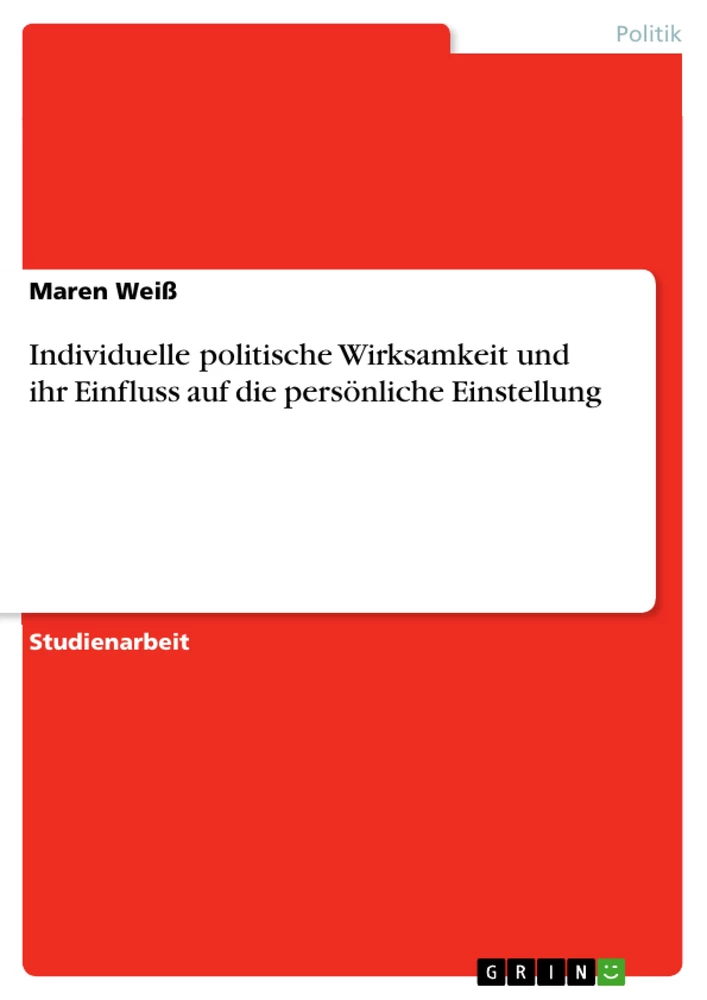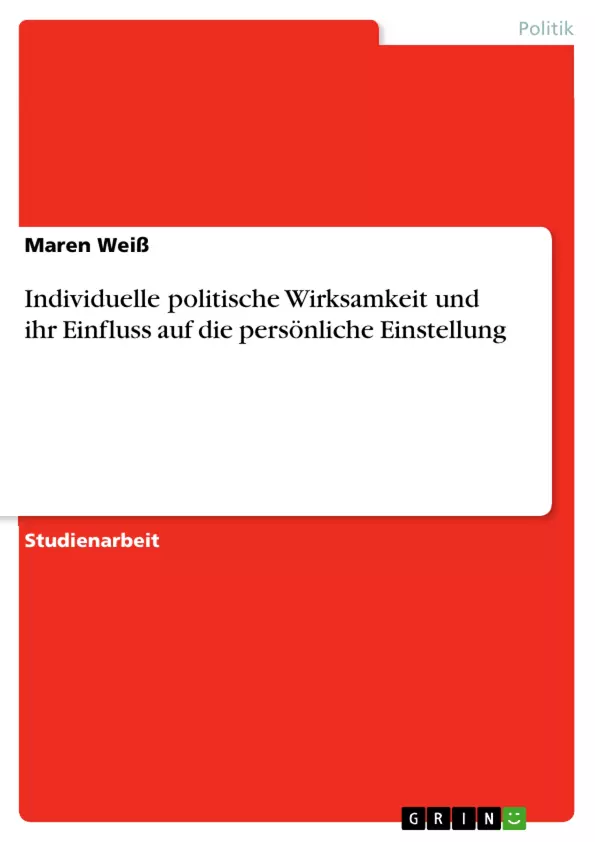Diese Forschungsarbeit thematisiert die Auswirkung von individueller politischer Wirksamkeit auf die Zusammensetzung außenpolitischer Einstellungen zur Europäischen Union auf der Mikroebene. Dabei wird theoretisch und empirisch zwischen interner und externer politischer Wirksamkeit unterschieden. Durch die Verwendung des neuesten Datensatzes der "European Election Studies" (EES) aus dem Jahr 2014 ergeben sich die Ergebnisse, dass sowohl höher wahrgenommene interne als auch externe politische Wirksamkeit zu allgemein positiven Einstellungen zur Europäischen Union führen. Somit können beide zuvor aufgestellten Hypothesen bestätigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Abstrakt
- 1. Einleitung
- 2. Literaturüberblick
- 3. Theorie
- 4. Hypothesen
- 5. Empirie
- 5.1. Daten
- 5.2. Operationalisierung
- 5.3. Methode
- 5.4. Statistische Ergebnisse
- 5.5 Hypothesenauswertung
- 6. Konklusion und Diskussion
- 7. Referenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Forschungsarbeit untersucht, wie individuelle politische Wirksamkeit die Bildung von außenpolitischen Einstellungen gegenüber der Europäischen Union auf der Mikroebene beeinflusst. Dabei wird zwischen interner und externer politischer Wirksamkeit unterschieden. Die Forschungsarbeit nutzt Daten aus den „European Election Studies“ (EES) von 2014, um zu analysieren, ob eine höhere wahrgenommene interne oder externe politische Wirksamkeit zu allgemein positiven Einstellungen zur Europäischen Union führt.
- Die Rolle individueller Faktoren bei der Gestaltung von EU-Einstellungen
- Der Zusammenhang zwischen politischer Wirksamkeit und Einstellungen zur EU
- Unterscheidung zwischen interner und externer politischer Wirksamkeit
- Analyse der Auswirkungen von politischer Wirksamkeit auf EU-Einstellungen mittels der EES-Daten
- Bewertung der Hypothese, dass politische Wirksamkeit positive EU-Einstellungen fördert
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen politischer Wirksamkeit und Einstellungen zur Europäischen Union. Dabei wird die Forschungslücke aufgezeigt, dass die individuelle politische Wirksamkeit in Bezug auf EU-Einstellungen bisher nur selten berücksichtigt wurde.
- Literaturüberblick: Die Arbeit präsentiert die wichtigsten literarischen Werke, die sich mit politischer Wirksamkeit und Einstellungen zur Europäischen Union befassen. Diese Werke werden zusammengefasst, kritisch reflektiert und in Verbindung zum Forschungsvorhaben gestellt.
- Theorie: Die Arbeit entwickelt eine Theorie, die auf verschiedenen theoretischen Argumenten aufbaut und die testbaren Hypothesen für die empirische Untersuchung formuliert.
- Empirie: Die Arbeit analysiert die Daten der „European Election Studies“ (EES) von 2014 mit Hilfe einer logistischen Regression, um den Zusammenhang zwischen subjektiver interner und externer politischer Wirksamkeit und Einstellungen zur Europäischen Union zu untersuchen.
Schlüsselwörter
Die Forschungsarbeit befasst sich mit den zentralen Themen der politischen Wirksamkeit, der Einstellungen zur Europäischen Union, der Unterscheidung zwischen interner und externer politischer Wirksamkeit, der empirischen Datenanalyse mittels der „European Election Studies“ (EES) und der logistischen Regression.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen interner und externer politischer Wirksamkeit?
Interne Wirksamkeit beschreibt das Vertrauen in die eigene Kompetenz, Politik zu verstehen. Externe Wirksamkeit ist der Glaube, dass das politische System auf die Bedürfnisse der Bürger reagiert.
Wie beeinflusst politische Wirksamkeit die Einstellung zur EU?
Die Forschung zeigt, dass eine höher wahrgenommene interne und externe politische Wirksamkeit zu einer positiveren Einstellung gegenüber der Europäischen Union führt.
Welche Datenquelle wurde für die empirische Analyse genutzt?
Es wurde der Datensatz der "European Election Studies" (EES) aus dem Jahr 2014 verwendet.
Welche statistische Methode kommt in der Arbeit zum Einsatz?
Die Zusammenhänge wurden mittels einer logistischen Regression auf der Mikroebene analysiert.
Warum ist die Untersuchung auf der Mikroebene wichtig?
Sie erlaubt es, individuelle psychologische Faktoren und persönliche Einstellungen unabhängig von nationalen Trends zu betrachten.
- Quote paper
- Maren Weiß (Author), 2018, Individuelle politische Wirksamkeit und ihr Einfluss auf die persönliche Einstellung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/489708