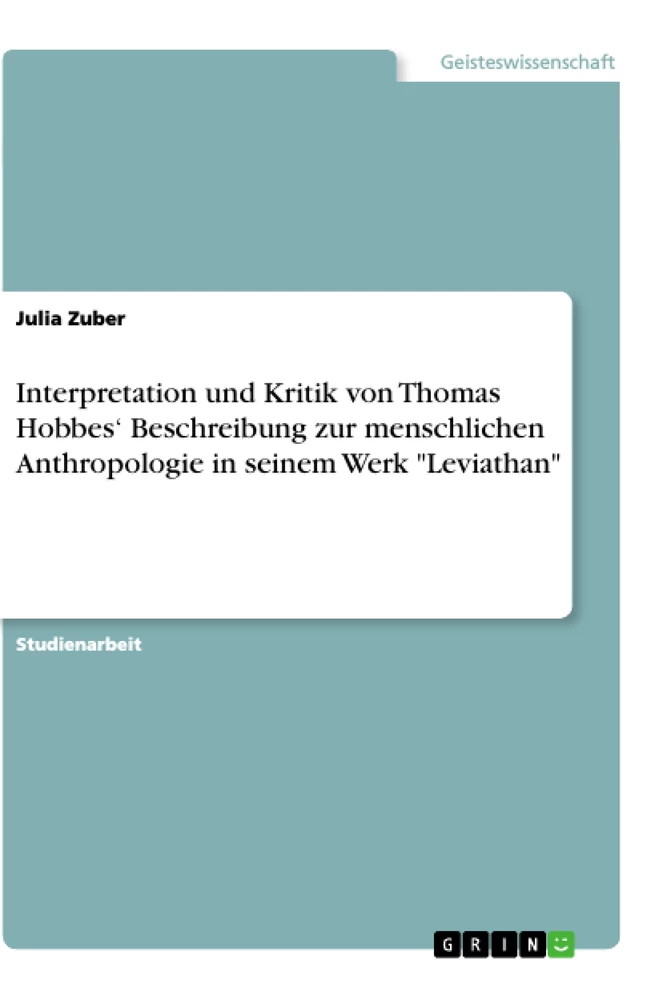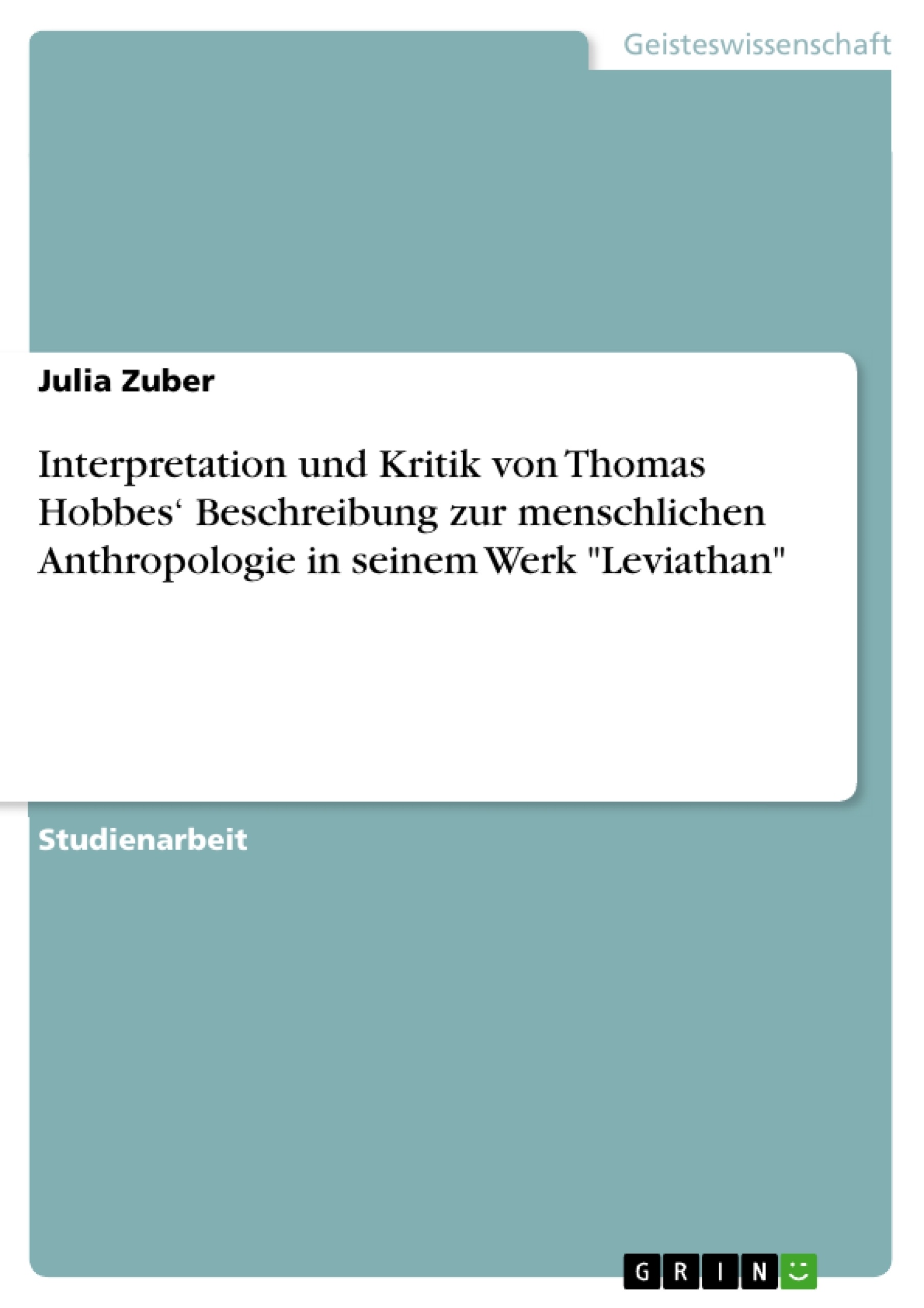Ziel dieser Arbeit ist, herauszufinden, warum Hobbes die Politik nicht beeinflussen konnte. Dazu sollen die Schwachstellen und Mängel der Basis des „Leviathan“, der hobbesschen Anthropologie herausgearbeitet werden.
In Bezug auf die Kapitel Eins bis Sieben wird zuerst beschrieben, wie der Mensch nach Hobbes funktioniert.
Anschließend soll dieses Menschenbild nach Christine Chwaszcza interpretiert werden. Zuletzt wird Hobbes‘ Anthropologie unterteilt, um sie kritisch untersuchen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Überblick über T. Hobbes' Menschenbild durch die Zusammenfassung der Kapitel Eins bis Sieben des ,,Leviathan"
- Interpretation der hobbesschen Anthropologie nach Christine Chwaszcza
- Kritik an Thomas Hobbes' Anthropologie
- Sinneswahrnehmung
- Denken, Sprache und Vernunft
- Leidenschaften
- Wissenschaft
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Schwachstellen und Mängel der hobbesschen Anthropologie, die als Grundlage für seine Staatstheorie im „Leviathan“ dient, aufzuzeigen. Hierbei wird untersucht, warum Hobbes' politische Ideen zu seiner Zeit nur geringen Einfluss hatten.
- Beschreibung der hobbesschen Anthropologie basierend auf den Kapiteln Eins bis Sieben des „Leviathan“
- Interpretation der hobbesschen Anthropologie nach Christine Chwaszcza
- Kritische Analyse der hobbesschen Anthropologie in Bezug auf Sinneswahrnehmung, Denken, Sprache und Vernunft, Leidenschaften und Wissenschaft
- Zusammenhang zwischen der hobbesschen Anthropologie und der Etablierung eines Staates
- Bewertung der Auswirkungen der Schwachstellen der hobbesschen Anthropologie auf die praktische Umsetzung seiner Staatstheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer detaillierten Beschreibung der hobbesschen Anthropologie, die auf den ersten sieben Kapiteln des „Leviathan“ basiert. Hobbes definiert Gedanken als Erscheinungen im Gehirn, die durch Reize von Objekten ausgelöst werden. Diese Erscheinungen führen zu Bewegungen der Organe und ermöglichen dem Menschen die Unterscheidung von Objekten. Erinnerungen werden als zurückbleibende Bewegungen der Organe definiert, die durch die Lebenserfahrung des Menschen geprägt sind. Das Einbilden durch Worte wird als Verstehen bezeichnet. Sprache dient der Kommunikation von Gedanken und Erinnerungen und ist eine Voraussetzung für Vernunft. Hobbes unterscheidet zwei Arten von Bewegungen: die vitale und die animalische Bewegung. Letztere beinhaltet natürliches Streben und Verlangen, das durch unterschiedliche Objekte beeinflusst wird. Die stärkste Leidenschaft des Menschen ist das Maximieren von Macht. Leidenschaften entstehen durch Objekte, die die Organe in Bewegung versetzen.
Hobbes argumentiert, dass alle Gedanken ein Ende haben und zu Meinungen führen. Wissenschaft entsteht durch genaue Definitionen und logische Schlussfolgerungen, die zu sicherem Wissen führen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der hobbesschen Anthropologie, dem „Leviathan“, Sinneswahrnehmung, Denken, Sprache, Vernunft, Leidenschaften, Wissenschaft, Staatstheorie, Christine Chwaszcza und der Kritik an Hobbes' philosophischen Ansätzen. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der Schwachstellen der hobbesschen Anthropologie auf die praktische Umsetzung von Hobbes' politischen Ideen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Untersuchung des „Leviathan“?
Das Ziel ist es, die Schwachstellen der hobbesschen Anthropologie aufzuzeigen und zu klären, warum Hobbes' politische Ideen zu seiner Zeit wenig Einfluss hatten.
Wie erklärt Thomas Hobbes die menschliche Wahrnehmung?
Gedanken sind für Hobbes Erscheinungen im Gehirn, die durch Reize von äußeren Objekten auf die Sinnesorgane ausgelöst werden.
Welche Rolle spielt die Sprache in Hobbes‘ Menschenbild?
Sprache dient der Kommunikation von Gedanken und Erinnerungen und ist laut Hobbes die notwendige Voraussetzung für Vernunft.
Was ist laut Hobbes das Hauptstreben des Menschen?
Hobbes sieht das natürliche Streben des Menschen in der Maximierung von Macht, getrieben durch Leidenschaften.
Welche Kritikpunkte werden an Hobbes‘ Anthropologie geäußert?
Die Arbeit kritisiert Hobbes' Ansichten zur Sinneswahrnehmung, zum Denken, zur Sprache, zur Vernunft und zur Wissenschaft.
Wer interpretierte Hobbes‘ Anthropologie in dieser Arbeit?
Die hobbessche Anthropologie wird in dieser Arbeit unter anderem nach den Ansätzen von Christine Chwaszcza interpretiert.
- Quote paper
- Julia Zuber (Author), 2012, Interpretation und Kritik von Thomas Hobbes‘ Beschreibung zur menschlichen Anthropologie in seinem Werk "Leviathan", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/489738