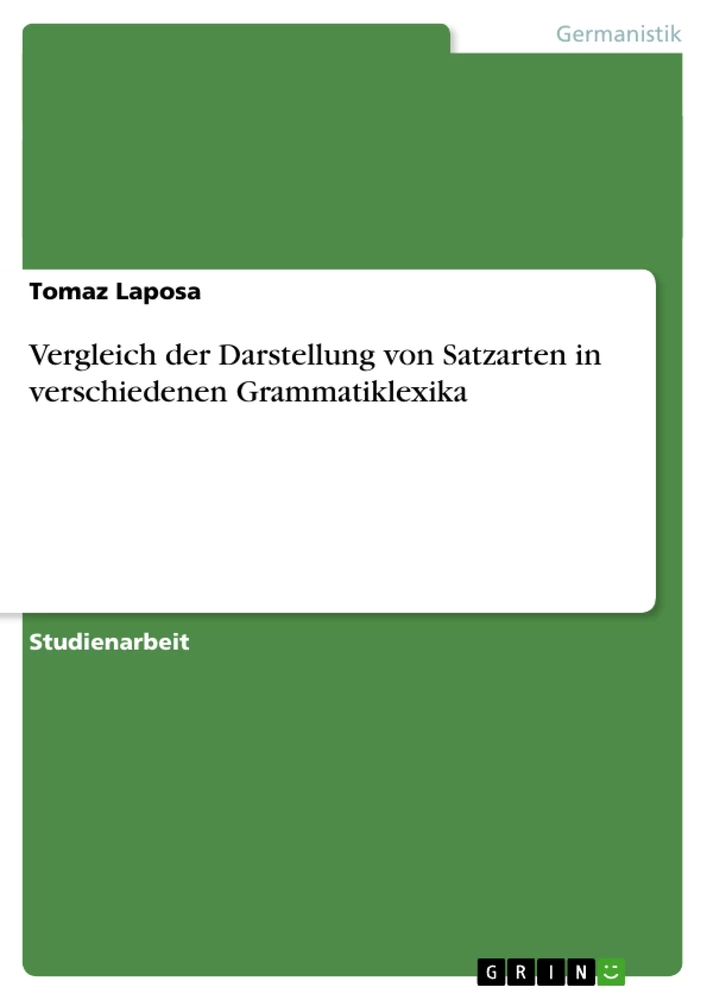Bei dieser Seminararbeit, die ich bei Seminarübungen des Faches Moderne deutsche Sprache-Syntax II geschrieben habe, werde ich die Satzarten der drei verschiedenen Grammatiken vergleichen, und zwar: der Duden-Grammatik, der Helbig/Buscha-Grammatik und der Sommerfeldt/Starke-Grammatik. Zuerst werde ich schreiben, wie die einzelnen Grammatiken das Wort Satzarten definieren bzw. was sie darunter verstehen. Danach werde ich die einzelnen Satzarten vorstellen, wie die Grammatiken sie definieren, erläutern und ähnliches. Am Ende werde ich die Grammatiken miteinander vergleichen, zuerst nach den einzelnen Satzarten und dann noch allgemein.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was sind eigentlich Satzarten?
- 3. Der Aussagesatz
- 3.1 Die Duden-Grammatik
- 3.2 Die Helbig/Buscha-Grammatik
- 3.3 Die Sommerfeldt/Starke-Grammatik
- 4. Der Fragesatz
- 4.1 Die Duden-Grammatik
- 4.1.1 Ergänzungsfragesätze oder Wortfragesätze
- 4.1.2 Entscheidungsfragesätze oder Satzfragesätze
- 4.2 Die Helbig/Buscha-Grammatik
- 4.2.1 Entscheidungsfrage
- 4.2.2 Ergänzungsfrage
- 4.3 Die Sommerfeldt/Starke-Grammatik
- 4.1 Die Duden-Grammatik
- 5. Der Aufforderungssatz
- 5.1 Die Duden-Grammatik
- 5.2 Die Helbig/Buscha-Grammatik
- 5.3 Die Sommerfeldt/Starke-Grammatik
- 6. Der Wunschsatz
- 6.1 Die Duden-Grammatik
- 6.2 Die Helbig/Buscha-Grammatik
- 7. Der Ausrufesatz
- 7.1 Die Duden-Grammatik
- 7.2 Die Helbig/Buscha-Grammatik
- 8. Vergleich der Grammatiken
- 8.1 Der Aussagesatz
- 8.2 Der Fragesatz
- 8.3 Der Aufforderungssatz
- 8.4 Der Wunschsatz
- 8.5 Der Ausrufesatz
- 8.6 Allgemeiner Vergleich von Satzarten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit vergleicht die Darstellung von Satzarten in drei verschiedenen deutschen Grammatiken: Duden-Grammatik, Helbig/Buscha-Grammatik und Sommerfeldt/Starke-Grammatik. Die Arbeit untersucht die Definitionen von Satzarten in jeder Grammatik und analysiert die Unterschiede in ihrer Klassifizierung und Beschreibung. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der jeweiligen Ansätze und der Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Abweichungen.
- Definition und Klassifizierung von Satzarten in verschiedenen Grammatiken
- Vergleich der Ansätze der drei Grammatiken bezüglich der Definition von Satzarten
- Analyse der formalen und funktionalen Kriterien zur Bestimmung von Satzarten
- Untersuchung der inhaltlichen und kommunikativen Aspekte von Satzarten
- Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der Behandlung der verschiedenen Satzarten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Zweck der Seminararbeit: einen Vergleich der Darstellung von Satzarten in drei bedeutenden deutschen Grammatiken. Sie skizziert den methodischen Ansatz, der darin besteht, zunächst die Definitionen der Satzarten in jeder Grammatik zu untersuchen, um anschließend einen detaillierten Vergleich der einzelnen Satzarten und einen abschließenden allgemeinen Vergleich durchzuführen. Die Arbeit betont die Bedeutung des Vergleichs für ein tieferes Verständnis der grammatischen Konzepte.
2. Was sind eigentlich Satzarten?: Dieses Kapitel analysiert die Definitionen von "Satzarten" in den drei Grammatiken. Die Duden-Grammatik definiert Satzarten als feste sprachliche Muster, die aus dem Zusammenspiel verschiedener Faktoren (Modus, Verbposition, Intonation, Interpunktion) entstehen. Die Helbig/Buscha-Grammatik betrachtet Satzarten sowohl inhaltlich (als Äußerungsmodalitäten) als auch formal (mit intonatorischen, morphosyntaktischen und lexikalischen Merkmalen), wobei sie auf die teilweise unterschiedliche Übereinstimmung beider Ebenen hinweist. Die Sommerfeldt/Starke-Grammatik konzentriert sich auf die kommunikative Funktion und unterscheidet lediglich zwischen Sätzen, die etwas mitteilen, und solchen, die eine Reaktion hervorrufen wollen.
3. Der Aussagesatz: Das Kapitel widmet sich dem Aussagesatz und analysiert dessen Darstellung in den drei Grammatiken. Es werden die spezifischen Merkmale des Aussagesatzes in jeder Grammatik untersucht, wie z.B. die Verbposition und die Intonation, um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Beschreibungen herauszuarbeiten. Die Analyse soll ein differenziertes Verständnis des Aussagesatzes und seiner grammatischen Beschreibung in den verschiedenen Grammatiken ermöglichen.
4. Der Fragesatz: Dieses Kapitel befasst sich mit der Darstellung des Fragesatzes in den drei Grammatiken. Es wird zwischen Ergänzungsfragen (Wortfragen) und Entscheidungsfragen (Satzfragen) unterschieden und der jeweilige Ansatz jeder Grammatik in Bezug auf die Beschreibung dieser Fragetypen analysiert. Die Untersuchung konzentriert sich auf die formalen und semantischen Merkmale, die jede Grammatik verwendet, um Fragesätze zu definieren und zu kategorisieren. Der Vergleich zeigt die unterschiedlichen Perspektiven auf die grammatische Struktur und Funktion von Fragesätzen.
5. Der Aufforderungssatz: Dieser Abschnitt vergleicht die Darstellung des Aufforderungssatzes in den drei Grammatiken. Der Fokus liegt auf den formalen Merkmalen, die den Aufforderungssatz kennzeichnen, wie z.B. die Verwendung des Imperativs, die Intonation und die Satzstruktur. Die Analyse untersucht, wie die unterschiedlichen Grammatiken diese Merkmale beschreiben und welche zusätzlichen Aspekte sie berücksichtigen, um ein umfassendes Bild des Aufforderungssatzes zu vermitteln. Der Vergleich verdeutlicht die unterschiedlichen grammatischen Perspektiven auf diesen Satztyp.
6. Der Wunschsatz: Das Kapitel analysiert die Behandlung des Wunschsatzes in den Grammatiken von Duden und Helbig/Buscha. Es werden die grammatischen Merkmale und die semantische Funktion des Wunschsatzes beleuchtet. Der Vergleich konzentriert sich auf die Unterschiede in der Beschreibung und Klassifizierung des Wunschsatzes. Die Analyse zeigt auf, wie die verschiedenen Grammatiken die Besonderheiten des Wunschsatzes erfassen und welche grammatikalischen Strukturen sie zur Darstellung dieses Satztyps heranziehen.
7. Der Ausrufesatz: Hier wird die Behandlung des Ausrufesatzes in den Grammatiken von Duden und Helbig/Buscha verglichen. Die Analyse konzentriert sich auf die formalen und funktionalen Charakteristika des Ausrufesatzes, wie z.B. die Intonation und die Ausdrucksweise. Der Vergleich der beiden Grammatiken verdeutlicht, wie die unterschiedlichen Ansätze die Besonderheiten des Ausrufesatzes erfassen und welche grammatikalischen Strukturen sie verwenden, um ihn zu beschreiben.
Schlüsselwörter
Satzarten, Grammatik, Duden-Grammatik, Helbig/Buscha-Grammatik, Sommerfeldt/Starke-Grammatik, Aussagesatz, Fragesatz, Aufforderungssatz, Wunschsatz, Ausrufesatz, Vergleich, Morphologie, Syntax, Semantik, Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Vergleich der Darstellung von Satzarten in drei deutschen Grammatiken
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit vergleicht die Darstellung von Satzarten (Aussagesatz, Fragesatz, Aufforderungssatz, Wunschsatz, Ausrufesatz) in drei bedeutenden deutschen Grammatiken: der Duden-Grammatik, der Helbig/Buscha-Grammatik und der Sommerfeldt/Starke-Grammatik. Der Fokus liegt auf der Analyse der Definitionen, Klassifizierungen und Beschreibungen der Satzarten in den jeweiligen Grammatiken und der Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden.
Welche Grammatiken werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Ansätze der Duden-Grammatik, der Helbig/Buscha-Grammatik und der Sommerfeldt/Starke-Grammatik. Jeder Grammatik wird ein eigenes Kapitel gewidmet, in dem ihre spezifische Darstellung der Satzarten detailliert untersucht wird.
Welche Satzarten werden untersucht?
Die Seminararbeit analysiert die folgenden Satzarten: Aussagesatz, Fragesatz (inklusive Ergänzungs- und Entscheidungsfragen), Aufforderungssatz, Wunschsatz und Ausrufesatz.
Wie wird der Vergleich der Grammatiken durchgeführt?
Der Vergleich erfolgt kapitelweise für jede Satzart. Zuerst werden die Definitionen und Beschreibungen der jeweiligen Satzart in jeder Grammatik einzeln dargestellt. Anschließend werden die einzelnen Ansätze verglichen und Gemeinsamkeiten sowie Abweichungen herausgearbeitet. Ein abschließendes Kapitel fasst die Ergebnisse des Vergleichs zusammen und bietet einen Gesamtüberblick über die unterschiedlichen Perspektiven auf die Satzarten.
Welche Aspekte werden im Vergleich berücksichtigt?
Der Vergleich berücksichtigt sowohl formale Aspekte (z.B. Verbposition, Intonation, Interpunktion) als auch funktionale und semantische Aspekte (z.B. kommunikative Funktion, Äußerungsmodalität). Die Analyse untersucht, wie die jeweiligen Grammatiken die formalen und funktionalen Merkmale der Satzarten definieren und kategorisieren.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der verschiedenen Ansätze zur Beschreibung von Satzarten in der deutschen Grammatik zu vermitteln und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der drei untersuchten Grammatiken aufzuzeigen. Dies soll zu einem tieferen Verständnis der grammatischen Konzepte beitragen.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung jedes Kapitels, die die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse jedes Abschnitts prägnant darstellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Satzarten, Grammatik, Duden-Grammatik, Helbig/Buscha-Grammatik, Sommerfeldt/Starke-Grammatik, Aussagesatz, Fragesatz, Aufforderungssatz, Wunschsatz, Ausrufesatz, Vergleich, Morphologie, Syntax, Semantik, Kommunikation.
Wo finde ich das Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis ist im HTML-Dokument enthalten und listet alle Kapitel und Unterkapitel detailliert auf.
- Citation du texte
- Tomaz Laposa (Auteur), 2003, Vergleich der Darstellung von Satzarten in verschiedenen Grammatiklexika, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48987