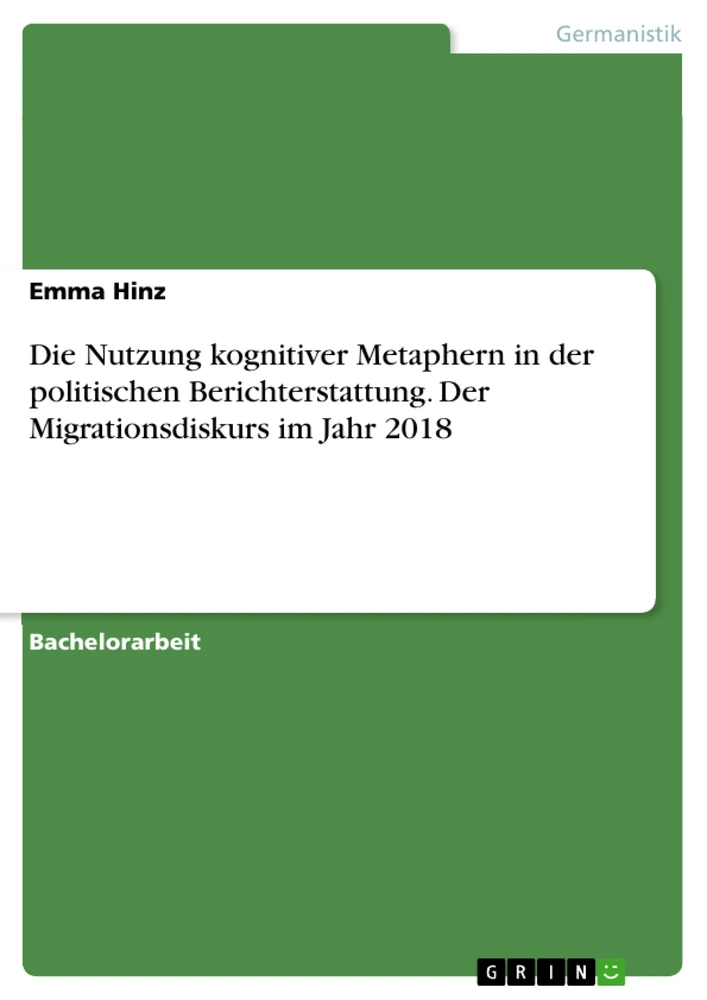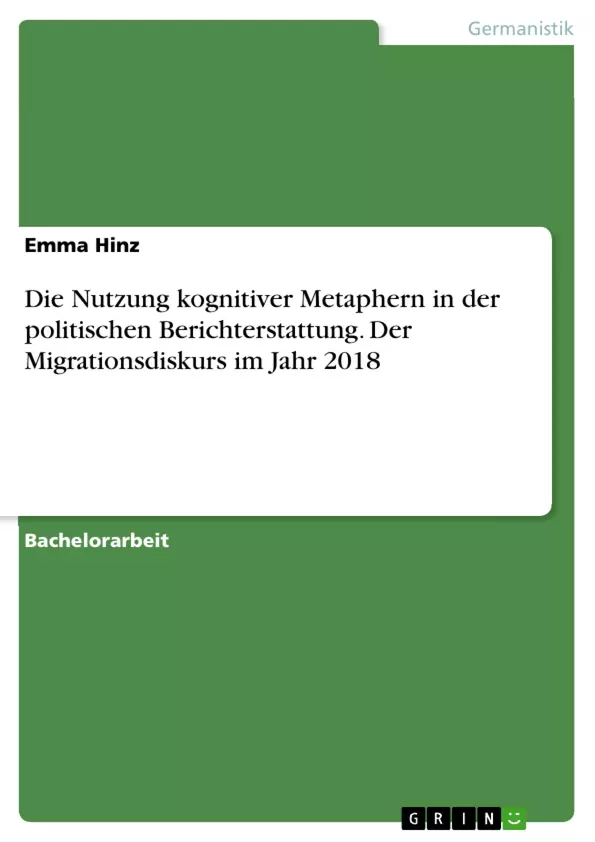Im Rahmen dieser Bachelorarbeit soll beantwortet werden, wie der Migrationsdiskurs durch Metapherngebrauch in der politischen Berichterstattung im Jahr 2018 strukturiert wird. Ziel dabei ist es, herauszufinden, welche metaphorischen Konzepte und kognitiven Metaphern im Bereich Kriegs-Metaphorik, Wasser-Metaphorik, Waren-Metaphorik und Weg-Metaphorik besonders häufig genutzt werden und vor allem welche Funktion dies hat.
Sobald man eine bildliche Vorstellung von einem komplexen Konstrukt hat, ist es nicht mehr möglich, sich von dieser Vorstellung zu lösen. Die Metapher repräsentiert einen Sachverhalt oder einen Gegenstand, um die Wirklichkeit zu vermitteln und eine Idee von der Realität im Inneren zu bekommen. Die politische Berichterstattung arbeitet mit diesem Phänomen, denn Politik an sich ist etwas Komplexes, das als nicht leicht zu erschließen gilt. Aus diesem Grund werden kognitive Metaphern eingesetzt, welche unser Denken, Handeln und Fühlen beeinflussen, ohne, dass es uns bewusst ist.
Medien gelten bekanntlich als die vierte Gewalt in unserer Gesellschaft und tragen maßgeblich dazu bei, wie über ein Thema diskutiert wird, ob das Thema als Bedrohung in der Gemeinschaft gesehen wird oder wie der Diskurs allgemein verläuft. Diesbezüglich wird sich diese Forschungsarbeit damit beschäftigen, welche metaphorischen Konzepte im Migrationsdiskurs zu finden sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in die Metapherntheorie
- Die Substitutionstheorie
- Die Interaktionstheorie
- Die kognitive Metapherntheorie nach Lakoff und Johnson
- Die Typologie konzeptueller Metaphern
- Kritik an der kognitiven Metapherntheorie
- Forschungsüberblick zum Migrationsdiskurs
- Metaphernanalyse in der politischen Berichterstattung
- Methodisches Vorgehen
- Das Korpus
- Fragestellung und Hypothesen nach Drößiger
- Die Analyse
- Migration als Krieg
- Migration als Fluss, Zuwanderung als Strom und Migration als Wasser
- Migration als Ware/Warenhandel und Asylsuchende als Produkt/Gegenstand
- Die Weg- und Ziel-Metaphorik
- Hypothesen verfizieren/falsifizieren
- Diskussion der Ergebnisse
- Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Forschungsarbeit zielt darauf ab, zu untersuchen, wie der Migrationsdiskurs durch den Einsatz von Metaphern in der politischen Berichterstattung des Jahres 2018 strukturiert wird. Im Mittelpunkt steht dabei die Analyse verschiedener metaphorischer Konzepte, um deren Funktionsweise und Häufigkeit im Diskurs zu ergründen.
- Die Rolle von Metaphern in der politischen Berichterstattung
- Die Analyse verschiedener metaphorischer Konzepte im Migrationsdiskurs
- Die Untersuchung der Funktion und Häufigkeit dieser Konzepte
- Die Strukturierung des Migrationsdiskurses durch Metapherngebrauch
- Die Auswirkungen von Metaphern auf das Denken, Handeln und Fühlen im Kontext des Migrationsdiskurses
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile: einen theoretischen und einen analytischen. Der theoretische Teil behandelt die Grundlagen der Metapherntheorie, wobei verschiedene Ansätze wie die Substitutionstheorie, die Interaktionstheorie und die kognitive Metapherntheorie nach Lakoff und Johnson vorgestellt werden. Der analytische Teil fokussiert sich auf die Metaphernanalyse in der politischen Berichterstattung. Hier werden die Methoden und das Korpus der Analyse erläutert sowie die wichtigsten Ergebnisse und ihre Interpretation diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Thematik des Migrationsdiskurses, insbesondere mit der Verwendung von kognitiven Metaphern in der politischen Berichterstattung. Im Fokus stehen dabei die Analyse verschiedener metaphorischer Konzepte wie der Kriegsmetaphorik, Wassermetaphorik, Warenmetaphorik und Weg-Metaphorik, um die Funktion und Häufigkeit ihres Gebrauchs im Diskurs zu untersuchen.
Häufig gestellte Fragen zu Metaphern im Migrationsdiskurs
Welche Rolle spielen Metaphern in der politischen Berichterstattung?
Metaphern machen komplexe politische Sachverhalte anschaulich. Sie beeinflussen unbewusst unser Denken und Fühlen, indem sie bestimmte Bilder der Realität vermitteln.
Was ist die kognitive Metapherntheorie nach Lakoff und Johnson?
Diese Theorie besagt, dass Metaphern nicht nur sprachliche Schmuckmittel sind, sondern unsere gesamte Wahrnehmung und unser Handeln strukturieren.
Welche Metaphern wurden im Migrationsdiskurs 2018 häufig genutzt?
Besonders häufig waren Kriegs-Metaphorik (Migration als Kampf), Wasser-Metaphorik (Flüchtlingsstrom), Waren-Metaphorik (Asylsuchende als Produkt) und Weg-Metaphorik.
Welche Funktion hat die Wasser-Metaphorik bei Migration?
Begriffe wie "Flüchtlingswelle" oder "Zustrom" suggerieren eine unaufhaltsame Naturgewalt, die bedrohlich wirken kann und politisches Handeln (Eindämmen) rechtfertigt.
Warum gelten Medien als "vierte Gewalt" im Diskurs?
Medien entscheiden durch die Wahl ihrer Metaphern maßgeblich darüber, ob ein Thema in der Gesellschaft als Bedrohung oder als Chance wahrgenommen wird.
- Quote paper
- Emma Hinz (Author), 2019, Die Nutzung kognitiver Metaphern in der politischen Berichterstattung. Der Migrationsdiskurs im Jahr 2018, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/490097