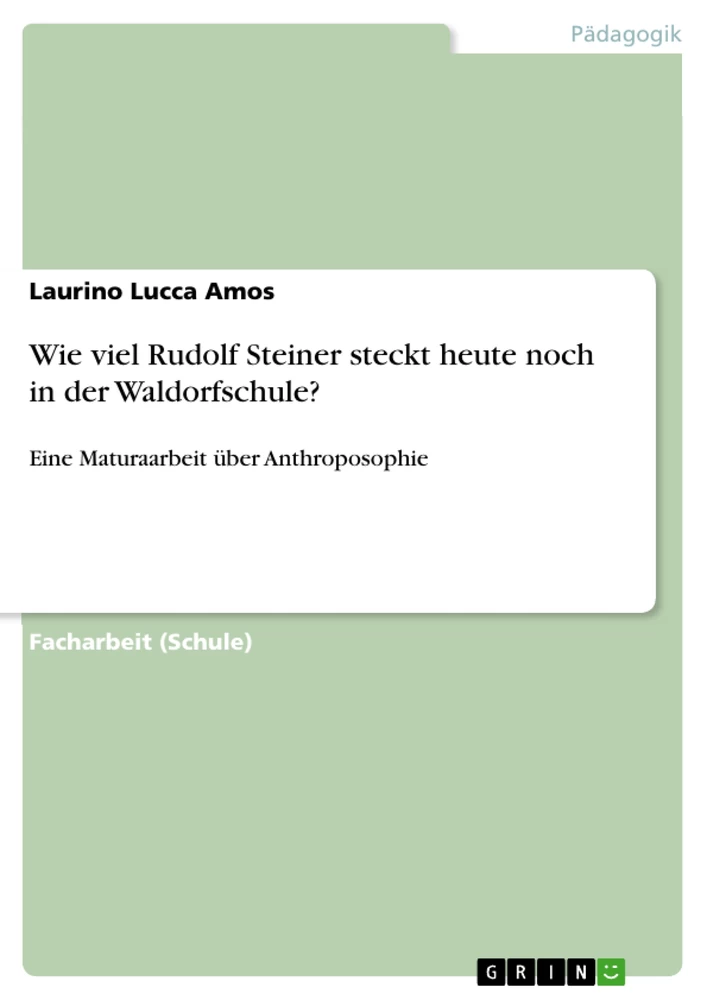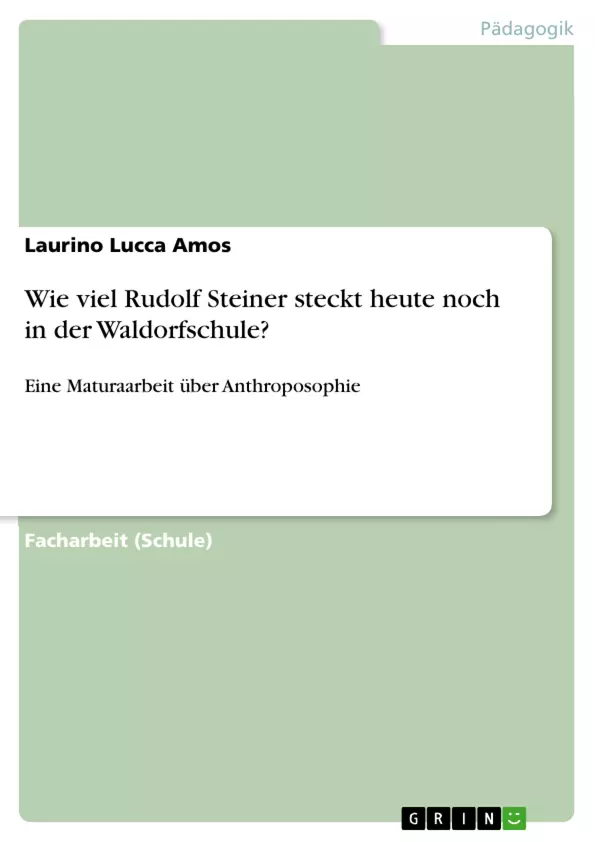Diese Maturaarbeit versucht zu klären, wie viel Rudolf Steiner heute noch in der Waldorfschule steckt. Im theoretischen Teil werden Rudolf Steiners Leben und die Anthroposophie dargestellt und zusammengefasst, danach wird die Waldorfpädagogik beschrieben. Im praktischen Teil beschreibt der Autor den praktischen Teil seiner Arbeit, welcher den Besuch einer Waldorfschule in Südafrika beinhaltete. In der Reflexion werden alle Themen grob zusammengefasst und die Leitfrage wird beantwortet.
Rudolf Steiner wird von einigen als mystischen Meister gesehen, manche wiederum halten ihn für einen Schwindler, Scharlatan und Opportunist und eine ganze Menge Leute hält ihn einfach für den «Mann, der die Steinerschule gegründet hat». In der NZZ wurde er «grosser Unbekannter der Moderne» genannt. Um die Anthroposophie und die Waldorfpädagogik zu verstehen, muss man erst Steiner kennenlernen. Er ist untrennbar mit ihnen verwoben. Um eine Person «kennenzulernen», muss man einen Blick auf die Biographie werfen. Steiners Biographie beantwortet viele Fragen, wirft aber gleichzeitig neue Fragen auf. Dieses Kapitel zeigt anhand Steiners Autobiographie «Mein Lebensgang» und anderen Quelle das Leben eines Philosophen, eines Wissenschaftlers, eines Künstlers, eines Eingeweihten, eines Lehrers, eines Reformers, eines Menschen.
Rudolf Joseph Lorenz Steiner wurde am 27. Februar 1861 in Kraljevec (Damals Kaisertum Österreich, heute Kroatien) geboren. Seine Eltern, Vater Johann Steiner und Mutter Franziska Steiner, geborene Blie, kamen aus Niederösterreich. Der Vater wurde als Telegraph der Südbahn nach Kraljevec versetzt. Den Vater beschrieb Steiner als wohlwollend, aber aufbrausend. Er hatte keine Freude an seiner Arbeit. Seine Mutter war im Haushalt tätig. 1862 zog die Familie nach Mödling bei Wien und 1863 nach Pottschach, wo seine Geschwister Leopoldine und Gustav auf die Welt kamen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Teil
- 2.1. Einleitung theoretischer Teil
- 2.2. Wer war Rudolf Steiner - eine Biographie
- 2.3. Die Anthroposophie im Umriss
- 2.3.1. Anthroposophie in Steiners Buch «Theosophie>>
- Einleitung des Buches
- 2.3.1.1.
- 2.3.1.2. Das Wesen des Menschen
- 2.3.1.3. Reinkarnation und Karma
- 2.3.1.4. Die drei Welten
- 2.3.1.5. Eine kurze Einführung in die Aura
- 2.3.1.6. Der Erkenntnispfad
- 2.3.2. Weitere wichtige Elemente der Anthroposophie
- 2.3.2.1. Der Lebenslauf des Menschen/ Siebenjahresperioden
- 2.3.2.2. Die Weltentwicklung
- 2.3.2.3. Christliche Inhalte
- 2.3.2.4. Die Akasha-Chronik
- 2.3.2.5. Die funktionelle Dreigliedrigkeit des Menschen
- 2.4. Das Hereinwirken der Anthroposophie in die Pädagogik / Waldorfpädagogik
- 2.4.1. Wie Rudolf Steiner die Waldorfpädagogik entwickelte
- 2.4.2. Die Jahrsiebte in der Waldorfpädagogik
- 2.4.3. Die vier Temperamente und die Farbenlehre in der Waldorfpädagogik
- 2.4.4. Der Klassenlehrer und der Epochenunterricht
- 2.4.5. Das Waldorfzeugnis und der Morgenspruch
- 2.4.6. Zum Waldorflehrplan
- 2.4.7. Religion und Anthroposophie an Waldorfschulen
- 2.4.8. Zur Architektur und Organisation der Waldorfschulen
- 2.4.9. Schulfeste und Traditionen
- 2.4.10. Was ist bis heute gleich geblieben? Was ist neu?
- 2.5. Vortrag über Brand des Goetheamum I.; Verhältnis Waldorflehrer zu AG
- 3. Praktischer Teil
- 3.1. Einleitung praktischer Teil
- 3.2. Besuch des Goetheanums in Dornach am 09.08.2018
- 3.3. Besuch einer Waldorfschule in Kapstadt, Südafrika
- 3.3.1. Planung von Besuchen an Waldorfschulen
- 3.3.2. Mein Besuch der C. Waldorf School, Kapstadt (09. bis 20.10.18)
- 3.4. Verhältnis der Lehrer der Atelierschule zur Anthroposophie
- 3.5. Gespräche mit Lehrern über Anthroposophie und die Atelierschule
- 4. Reflexion und Fazit
- 4.1. Wie ging ich vor?
- 4.2. Was wurde erreicht und was wurde nicht erreicht (Probleme)?
- 4.3. Was habe ich daraus gelernt?
- 4.4. Beantwortung der Fragestellung
- 4.5. Fazit
- 4.6. Danksagung
- 5. Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, inwiefern Rudolf Steiners Anthroposophie in der heutigen Waldorfpädagogik präsent ist, insbesondere im Kontext der Atelierschule Zürich. Die Arbeit analysiert die Beziehung zwischen der Waldorfpädagogik und der Anthroposophie und untersucht, wie sich diese Beziehung über die Zeit entwickelt hat.
- Das Leben und Werk Rudolf Steiners
- Die zentralen Elemente der Anthroposophie
- Die Entwicklung der Waldorfpädagogik
- Die Bedeutung der Jahrsiebte in der Waldorfpädagogik
- Der Einfluss der Anthroposophie auf die Praxis an Waldorfschulen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung führt den Leser in die Thematik der Arbeit ein und erläutert den Hintergrund des Projekts. Der Autor beschreibt seine persönliche Verbindung zur Anthroposophie und zur Waldorfpädagogik und stellt die Leitfrage der Arbeit vor: «Anthroposophie- Wie viel Rudolf Steiner steckt heute noch in der Waldorfschule?».
- Kapitel 2: Theoretischer Teil: Dieses Kapitel befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der Arbeit. Der Autor stellt Rudolf Steiner und seine Anthroposophie vor und erläutert die zentralen Elemente der Anthroposophie. Er analysiert Steiners Buch «Theosophie» und untersucht, wie die Anthroposophie die Entwicklung der Waldorfpädagogik beeinflusst hat.
- Kapitel 3: Praktischer Teil: Dieses Kapitel präsentiert die praktischen Erfahrungen des Autors in der Waldorfpädagogik. Er beschreibt seine Besuche des Goetheanums in Dornach und einer Waldorfschule in Kapstadt, Südafrika. Der Autor führt Gespräche mit Lehrern an verschiedenen Schulen und untersucht, inwieweit die Anthroposophie in der Praxis umgesetzt wird.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Begriffen Anthroposophie, Waldorfpädagogik, Rudolf Steiner, Goetheanum, Jahrsiebte, Waldorfschule, Atelierschule Zürich, Lehrerumfrage und der Frage nach der Aktualität anthroposophischer Ideen in der heutigen Zeit.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Rudolf Steiner?
Rudolf Steiner (1861–1925) war ein österreichischer Philosoph, Naturwissenschaftler und der Begründer der Anthroposophie sowie der Waldorfpädagogik.
Was ist das Kernkonzept der Waldorfpädagogik?
Die Waldorfpädagogik basiert auf Steiners anthroposophischem Menschenbild, das die Entwicklung des Kindes in Jahrsiebten betrachtet und Körper, Seele und Geist gleichermaßen fördern will.
Was sind "Jahrsiebte" in der Waldorfpädagogik?
Steiner unterteilte die menschliche Entwicklung in Phasen von jeweils sieben Jahren, wobei jede Phase spezifische pädagogische Ansätze und Schwerpunkte erfordert.
Wie viel von Steiners Lehren steckt heute noch in Waldorfschulen?
Die Arbeit untersucht dies anhand von Praxisbeispielen (z.B. Atelierschule Zürich) und stellt fest, dass viele Traditionen wie der Epochenunterricht, der Morgenspruch und die Temperamentenlehre weiterhin zentral sind.
Was ist der Epochenunterricht?
Beim Epochenunterricht wird ein bestimmtes Fach (z.B. Mathematik oder Geschichte) über mehrere Wochen hinweg intensiv in den ersten Stunden des Schultages behandelt.
- Citar trabajo
- Laurino Lucca Amos (Autor), 2019, Wie viel Rudolf Steiner steckt heute noch in der Waldorfschule?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/490292