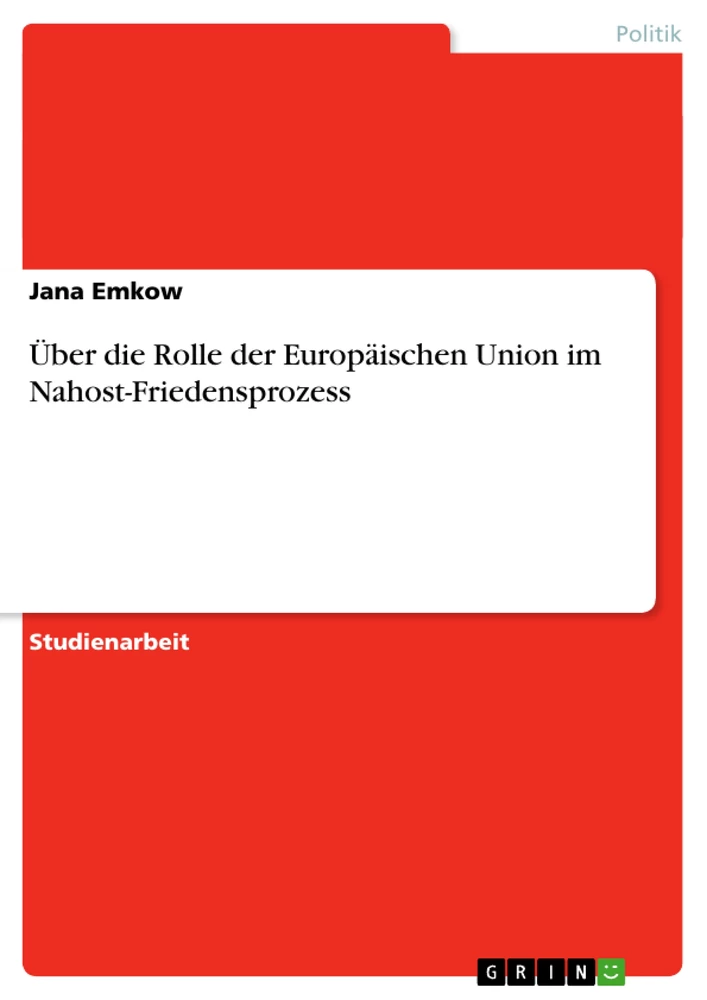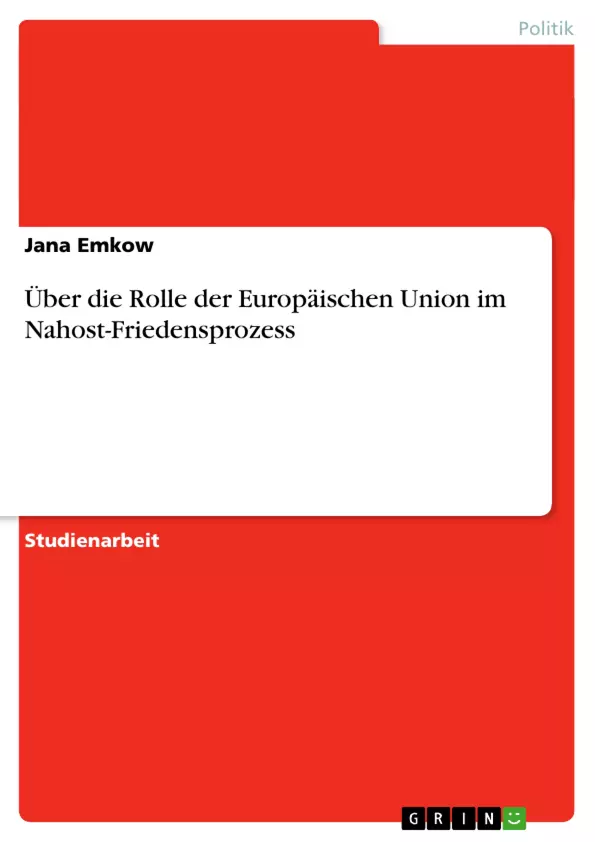Seit Menschengedenken führen die Völker Kriege. Sei es aus Gründen der Religionskonflikte oder der Territorialerweiterung, mit welcher oft eine Ausbeutung der „Verlierer“ und der natürlichen Ressourcen einhergeht. Und obgleich die Menschen der Gegenwart von allen bisherigen Generationen am friedlichsten leben, toben doch vereinzelt Konflikte, die in Grausamkeit und geforderten Menschenleben vielen großen Kriegen der Geschichte in nichts nachstehen. Nach dem Ausbruch der Al-Aqsa Intifada Ende September 2000 steht der Nahostkonflikt wieder im Fokus der Weltöffentlichkeit. Die Menschen auf der ganzen Welt fragten sich, warum nach all den Abkommen und Deklarationen, der gegenseitigen Anerkennung der PLO und Israels in der Prinzipienerklärung des Osloer Vertragswerkes ab 1993 und der „Road Map to Peace“, immer noch kein Frieden in das zerrüttete Land eingekehrt ist. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Ausrufung des Israelischen Staates 1948 ist der Israelisch-Palästinensische Konflikt zunehmend prekär geworden und Terroranschläge beiderseits, die viele Todesopfer forderten, ließen den Konflikt schnell verhärten, sodass eine Einigung ohne fremde Hilfe nahezu aussichtslos erschien. So folgten im Laufe der Jahrzehnte verschiedene Bemühungen lokaler und ausländischer Diplomaten, den Konflikt zu beenden, was beispielsweise im Vertragswerk von Oslo im Jahre 1993 oder in den Verhandlungen von Camp David Mitte 2000 ratifiziert werden sollte. Da jedoch diese Friedensbemühungen keine absolute Wende in den Friedensprozess gebracht haben, fragen sich die westlichen Politologen und Politiker, welche Gründe alle Bemühungen, die Auseinandersetzungen endgültig beizulegen, bisher scheitern ließen. Eine „Schule“, die sich mit derartigen Fragen und deren Lösung auseinandersetzt, ist die der „Mediation“. Hierbei wurden immer wieder Verhandlungskonzepte ausgearbeitet, die versuchen, eine genaue Verfahrensweise des richtigen Vermittelns zwischen zwei Konfliktparteien zu erstellen. Seit langer Zeit wird der EU vorgeworfen, sie habe im Nahostkonflikt zu wenig Einfluss geltend gemacht. In der Vergangenheit war die EU bemüht, Defizite der US-amerikanischen Nahostpolitik, deren Ausgewogenheit seit Ende der Clinton-Ära immer anzweifelbarer geworden ist, durch eigene Initiativen auszugleichen und so mehr oder weniger als Mediator, also als Vermittler, zu fungieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der israelisch-palästinensische Konflikt
- Entwicklung des Konfliktes am Anfang des 19. Jh.
- Der Nahostkonflikt nach dem Ende des zweiten Weltkrieges
- Versuche der Vermittlung
- Die „Osloer-Verträge“ als Farce der Mediation
- Zähes Zerren in „Camp-David“
- Der „Fahrplan“ zu zwei Staaten und die „Genfer Initiative“
- Die Nahostpolitik der Europäischen Union
- Die europäische Nahostpolitik bis 1993
- Streitfragen der Konfliktakteure und die Haltung der EU
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Europäischen Union im Nahost-Friedensprozess. Sie analysiert die Entwicklung des israelisch-palästinensischen Konflikts und beleuchtet verschiedene Vermittlungsversuche. Darüber hinaus wird die Nahostpolitik der EU im Kontext der Geschichte und der Streitfragen der Konfliktparteien erörtert.
- Die Entwicklung des israelisch-palästinensischen Konflikts
- Die Rolle der Mediation im Nahost-Friedensprozess
- Die Nahostpolitik der Europäischen Union
- Die Einflussmöglichkeiten der EU im Nahostkonflikt
- Die Bedeutung der EU im Friedensprozess
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik des Nahostkonflikts und die Rolle der Europäischen Union im Friedensprozess ein. Sie beleuchtet die Aktualität des Konflikts und stellt die Forschungsfrage nach der Bedeutung der EU im Nahost-Friedensprozess.
2. Der israelisch-palästinensische Konflikt
Dieses Kapitel skizziert die Entstehung und Entwicklung des israelisch-palästinensischen Konflikts. Es analysiert die historischen Wurzeln des Konflikts, die unterschiedlichen Perspektiven der Konfliktparteien und die Bedeutung des „Heiligen Landes“ für beide Seiten.
3. Versuche der Vermittlung
Kapitel 3 behandelt verschiedene Vermittlungsversuche im Nahost-Friedensprozess. Es analysiert das Vertragswerk von Oslo, die Verhandlungen in Camp David und den „Fahrplan“ zu zwei Staaten. Zudem wird die „Genfer Initiative“ als Beispiel für ein Bemühen um einen unparteiischen Friedensprozess vorgestellt.
4. Die Nahostpolitik der Europäischen Union
Dieses Kapitel beleuchtet die Nahostpolitik der EU im Kontext der Geschichte und der Streitfragen der Konfliktparteien. Es analysiert die europäischen Bemühungen um eine friedliche Lösung des Konflikts und die Rolle der EU als Mediator.
Schlüsselwörter
Nahost-Friedensprozess, israelisch-palästinensischer Konflikt, Mediation, Europäische Union, Vermittlungsversuche, Osloer Verträge, Camp David, „Road Map to Peace“, Genfer Initiative, Streitfragen der Konfliktakteure, Einflussmöglichkeiten der EU.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die EU im Nahost-Friedensprozess?
Die EU agiert oft als Mediator und versucht, durch eigene Initiativen die Defizite der US-Nahostpolitik auszugleichen und eine ausgewogene Vermittlung zu bieten.
Was waren die Osloer Verträge?
Das 1993 begonnene Osloer Vertragswerk sah eine gegenseitige Anerkennung von Israel und der PLO sowie einen Fahrplan für den Frieden vor, der jedoch letztlich scheiterte.
Was ist die "Road Map to Peace"?
Ein von dem Nahost-Quartett (EU, USA, Russland, UN) entwickelter Plan, der eine schrittweise Lösung des Konflikts und eine Zwei-Staaten-Lösung zum Ziel hatte.
Was bedeutet "Mediation" im politischen Kontext?
Mediation ist ein strukturiertes Verhandlungskonzept, bei dem ein unparteiischer Dritter (z. B. die EU) versucht, zwischen zwei Konfliktparteien zu vermitteln.
Warum ist eine Einigung im Nahostkonflikt so schwierig?
Tiefe historische Wurzeln, territoriale Ansprüche, religiöse Konflikte und Terroranschläge auf beiden Seiten haben die Fronten über Jahrzehnte verhärtet.
- Quote paper
- Jana Emkow (Author), 2005, Über die Rolle der Europäischen Union im Nahost-Friedensprozess, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49052