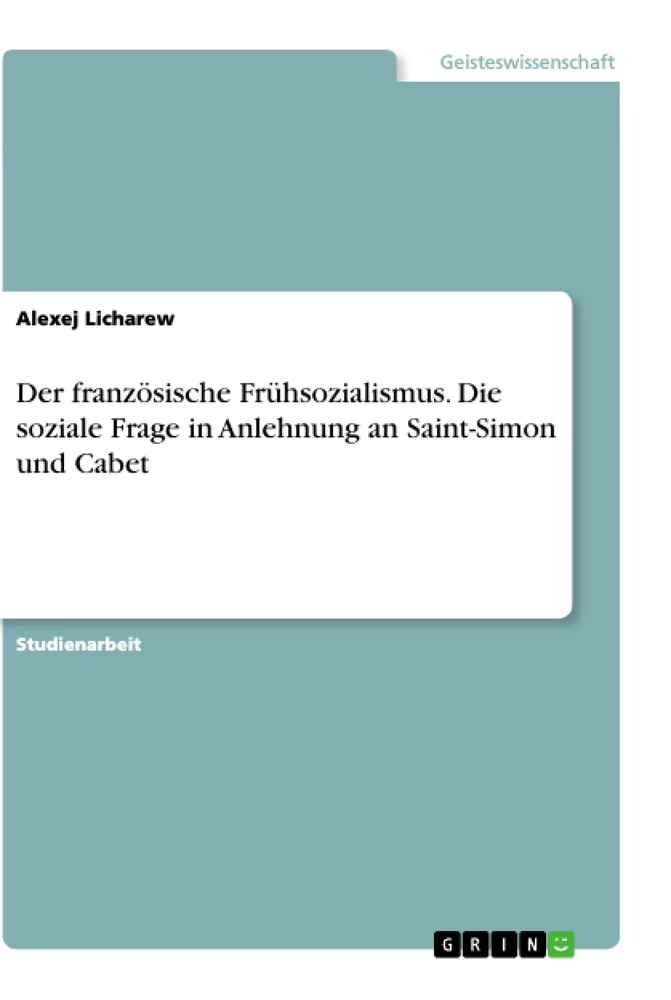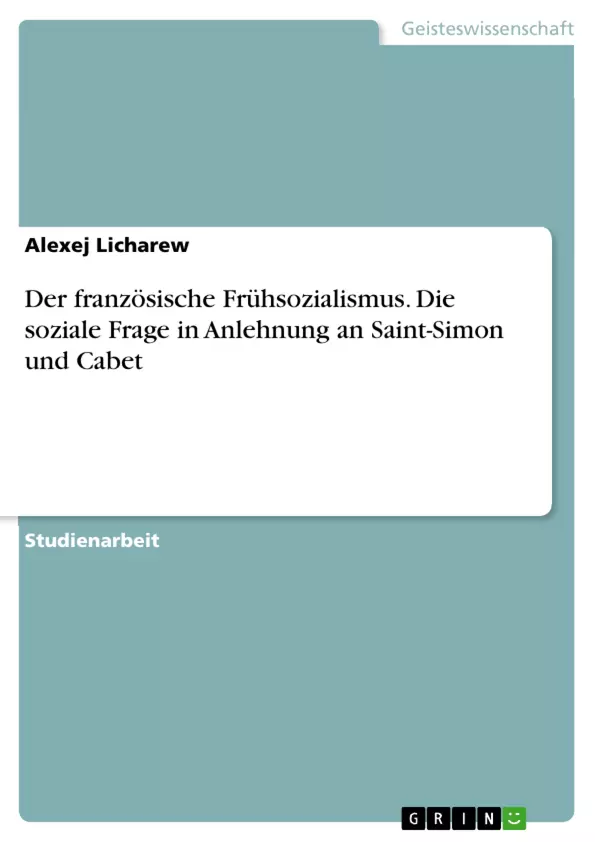Kurz nach der Französischen Revolution und mit der Entwicklung der industriellen Produktion, die die gesellschaftliche Ordnung neu formierten, tauchten sogleich auch theoretisch geschulte Köpfe auf, die sowohl das positive Potential des sozialen Fortschritts, als auch die bereits negativen Auswirkungen innerhalb der Gesellschaft sozialtheoretisch konstatierten. Ideengeschichtlich werden die politisch-philosophischen Reflexionen dem damaligen Frühsozialismus zugeordnet, der als eine praxisorientierte Bewegung sowohl zeithistorisch im nachrevolutionären Frankreich die politisch aktiven Menschen bewegte, als auch darüber hinaus eine sozialpolitische Bedeutung bei einigen Romantikern und anderen politischen Aktivisten bewirkte. Es sind Namen wie Babeuf, Saint-Simon, Fourier, Cabet und noch viele andere, die sich vorrangig die soziale Frage stellten und zukunftsorientierte Gesellschaftsentwurfe konzipierten, die den allgemeinen menschlichen Fortschritt mitgestalten sollten. In meiner Arbeit werde ich mir hauptsächlich die Theorien von Saint-Simon und zum Teil die Anschauung von Cabet vergegenwärtigen. Wenn wir Saint-Simon als einen Vertreter des meriokratischen Sozialismus gelten lassen, dann könnten wir Cabet als einen Befürworter des bedarfsorientierten Kommunismus charakterisieren. Meine Aufgabe in dieser vorliegenden Arbeit ist es nun, die zwei unterschiedlichen Sozial-Vorstellungen sinngemäß zu reformulieren, um daraus die Gemeinsamkeiten und die Differenzen beider Konzepte abzuleiten.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Saint- Simon oder der Beginn der sozialistischen Theoriebildung:
3. Die Negation der bestehenden Verhältnisse:
4. Die saint-simonistische Gesellschaftauffassung:
5. Zur saint-simonistischen Anthropologie
6. Die Kooperationsidee
7. Die Negation der Herrschaftsverhältnisse und das Leistungsprinzip
8. Kritisches zum Leistungsprinzip:
9. Die Gleichheitsvorstellung Cabets
10. Die Missionierungs-Absicht und der Wille der Vernunft
11. Die Vorzüge der Gütergemeinschaft
12. Schlussgedanken
Literaturverzeichnis:
1. Einleitung
Kurz nach der Französischen Revolution und mit der Entwicklung der industriellen Produktion, die die gesellschaftliche Ordnung neu formierten, tauchten sogleich auch theoretisch geschulte Köpfe auf, die sowohl das positive Potential des sozialen Fortschritts, als auch die bereits negativen Auswirkungen innerhalb der Gesellschaft sozialtheoretisch konstatierten. Ideengeschichtlich werden die politisch-philosophischen Reflexionen dem damaligen Frühsozialismus zugeordnet, der als eine praxisorientierte Bewegung sowohl zeithistorisch im nachrevolutionären Frankreich die politisch aktiven Menschen bewegte, als auch darüber hinaus eine sozialpolitische Bedeutung bei einigen Romantikern und anderen politischen Aktivisten bewirkte. Es sind Namen wie Babeuf, Saint-Simon, Fourier, Cabet und noch viele andere, die sich vorrangig die soziale Frage stellten und zukunftsorientierte Gesellschaftsentwurfe konzipierten, die den allgemeinen menschlichen Fortschritt mitgestalten sollten. In meiner Arbeit werde ich mir hauptsächlich die Theorien von Saint-Simon und zum Teil die Anschauung von Cabet vergegenwärtigen. Wenn wir Saint-Simon als einen Vertreter des meriokratischen Sozialismus gelten lassen, dann könnten wir Cabet als einen Befürworter des bedarfsorientierten Kommunismus charakterisieren. Meine Aufgabe in dieser vorliegenden Arbeit ist es nun, die zwei unterschiedlichen Sozial-Vorstellungen sinngemäß zu reformulieren, um daraus die Gemeinsamkeiten und die Differenzen beider Konzepte abzuleiten.
2. Saint- Simon oder der Beginn der sozialistischen Theoriebildung:
Vermittels eines großangelegten Sozialentwurfs und eines ökonomischen Gesellschaftsideals verfolgte Henri de Saint-Simon mithilfe seiner Analysefähigkeit und der theoretischen Vorstellungskraft ein durchaus pragmatisches Ziel: das Ziel der gesellschaftlichen und ökonomischen Veränderung der Lebensbedingungen für die Gesamtheit der Menschen.
Seine Absicht war: die restlose Aufhebung des menschlichen Elends, die Abschaffung des Erbrechtes und die Verwirklichung einer Idee, die zugleich in der Idee der Gerechtigkeit, in der Idee der gesellschaftlichen Teilhabe und in der Idee der allgemeinen Zufriedenheit seine Wurzeln hatte. Es erscheint als eine sozial-politische Weiterführung christlicher Religösität mithilfe von wissenschaftlich rhetorischen Mitteln.
Saint-Simon wusste von den materiellen Ungleichheiten, die im damaligen Frankreich, aber auch in England und dem damalig zersplitterten Deutschland so offensichtlich waren. Im Zuge der Industrialisierung etablierten sich eine Vielzahl an Manufakturen, Fabriken und industriellen Produktionsstätten, die neue Formen der Ausbeutung, des menschlichen Elends, der Verzweiflung und der Ungerechtigkeit erzeugten. Diese sich zuspitzenden Antagonismen zwischen Besitzenden und Besitzlosen, zwischen sowohl theoretischen als auch praktischen Widersprüchen innerhalb der sich entwickelnden Gesellschaftsordnung, die zuzeiten Saint-Simons noch viel eher einer Unordnung entsprochen hatte, beeinflussten seine geschichtsbewusste Gesellschaftstheorie. Seine soziale Hoffung, das Falsche innerhalb der sozialen Welt zu überwinden, intendierte mithilfe einer kritisch historischen Analyse den Entwurf eines sozialen Soll-Zustandes, welcher sich erst in der Organisation der Zukunftsgesellschaft realisiert. Denn „Seine „science générale“ war eine wesentlich zielsetzende, nicht erklärende Disziplin.“1
Saint-Simon gilt als einer der Ersten, der den Weg für die Idee des Sozialismus geebnet hatte. Er zeichnete ein rationalistisch-ökonomisches Gesellschaftsmodell, welches er Zeit seines Lebens religiös einkleidete. Denn ein neues Christentum sollte seiner Meinung nach zum Leben erwachen. Die Gebote der Stunde seien dabei die menschliche Friedfertigkeit, die Brüderlichkeit mit den Ärmsten der Gesellschaft und die Überwindung von obskuren Aberglauben und angsterzeugenden Irrlehren. Seine Schüler und Anhänger nannten sich Vertreter des Saint-Simonismus. Die Saint-Simonisten brachten in der theoretischen Weiterführung der Lehren ihres Meisters sogar eine europaweit Verbreitung findende Zeitschrift heraus: „Le Globale“, in der sie zum ersten Mal von „socilisme“ sprachen; in Abgrenzung zu dem Oppositionsbegriff des „individualsme“. Augustus Comte, einer der ersten Baumeister der positiven Soziologie war Student, Sekretär und Freund von Saint-Simon gewesen. Karl Marx und Friedrich Engels haben sich Anfang der 1840er Jahre mit den Theorien der französischen Sozialisten beschäftigt und betitelten sie im Kommunistischen Manifest von 1848 als Vertreter des „utopischen Sozialismus“. In kritisch-reflexiver Verarbeitung der Lehren von Saint-Simon und anderen Frühsozialisten, wie Charles Fourier und Robert Owen, einem englischen Sozialisten, nahmen sie sich für ihre Theorie das wertvollste Gedankengut heraus, und begründeten in Abgrenzung zum utopischen den wissenschaftlichen Sozialismus. „Es sind vor allem drei leitende Ideen Saint-Simons, die einen Zusammenhang mit dem späteren wissenschaftlichen Sozialismus hergestellt haben: die Kritik der bürgerlichen Gesellschaft, die Überwindung des Staates als einer Beherrschungsform und die Umwandlung der Politik in eine Wissenschaft.“2
Die Betrachtungsweise von Saint-Simon, welche mit Bezug auf die historische Zivilisationsentwicklung in Europa konzipiert worden war, machte gleichsam die theoretische Vorarbeit für die dialektische Geschichtsauffassung. Seine teils religiösen Sozialschriften fanden ebenso Gehör und Nachklang in der Christlichen Soziallehre.
3. Die Negation der bestehenden Verhältnisse:
Durch Bodenspekulation gelang Saint-Simon kurzzeitig zu immensen Reichtum, welches er aber in wenigen Jahren für die Förderung von Wissenschaft und Künsten wieder verausgabte. Seitdem hatte er keine sonderlichen finanziellen Einnahmen und lebte in den darauffolgenden Jahren leicht oberhalb des Existenzminimums. In der Zeit, um 1805 herum, verfasste er seine gesellschafts-analytischen und sozial-idealistischen Schriften, die nicht frei von religiösem Gedankengut waren. Er forderte zu Beginn seiner politischen Werke eine europäische Konföderation mit einem europäischen Parlament, welches eine gewisse Interessensgleichheit bewahren und im Geiste der europäischen Gemeinschaft handeln sollte. Dafür waren ihm die Entwicklung der Gefühle, der Verstandeseigenschaften und der inhärenten Kräfte und Vermögen gemeinschaftliche Tugenden der vernünftigen Erziehung.
Er strebte die politische Einheit Europas an. Denn zwei Jahrtausende haben sich die Völker und Nationen in Europa bis aufs Blut befehdet, zwei Jahrtausende waren sie häufig in feindselige und kriegerische Auseinandersetzungen geraten und zwei Jahrtausende herrschten verheerende Konflikte, folgenschwere Krankheiten, religiöse Krisen und Kriege. Europa war gespalten in mehrere religiöse, philosophische und politische Gruppen. Die Katholiken waren gegen die Protestanten, der Deisten war gegen den Atheisten, die Demokraten waren gegen die Konservativen und umgekehrt. Es war eine zerstrittenes, feindliches und unversöhntes Europa, indem innerhalb der Nationen die Menschen von ihren Mitmenschen gedemütigt worden und nach außen hin entweder Eroberungskriege stattfanden oder militärische Verteidigungsmaßnahmen zum Schutz der eigenen Bevölkerung greiften. „und ebenso gehört die Ausbeutung der Schwachen durch den Starken zu den auffallendsten und charakteristischsten Zügen der Vergangenheit.“3 , wie es die Saint-Simonisten später dann formulierten. Überall innerhalb der Völker, als auch zwischen den Völkern herrschte Konkurrenz, religiöse, philosophische, politische und ökonomische Konkurrenz, sowohl in den Wissenschaften als auch in der Alltagswelt der Menschen. Das Grundproblem der Konkurrenz aber war der in der Geschichte ablaufende Klassengegensatz. Der Antagonismus zwischen Sklaven und Sklavenhalten, Patriziern und Plebejern, Besitzlosen und Besitzenden, Beherrschten und Herrschern. Um dieses Hierarchie-Verhältnis zugunsten der Mächtigen zu bewahren, wurden zum einen psychische und physische Gewalt angewendet, als auch kamen bestimmte Herrschaftstechniken zu Einsatz, wie Zwangsausübungen, Schikanierungen und Folter. Diese Methoden der Herrscher wurden gebraucht, um den Untertanen auch untertänig zu halten. Sklaven in der Antike wurden zum Beispiel nicht als Menschen erachtet, sondern als Gegenstände, als Eigentum, als Instrumente. Sie waren physischen Leiden unterworfen, waren zeitlebens gefangen, erlitten eine geistige und moralische Abstumpfung und wurden abgewertet, erniedrigt, schikaniert und teilweise verstümmelt. Mit dem Erstarken des Christentums und den Predigen der Evangelien wurde zwar die Sklaverei formal abgeschafft, es wandelten sich jedoch die Ausbeutungsverhältnisse. An die Stelle der Sklaven traten nun die Leibeigenen, die mühselige Frondienste und Abgaben zu leisten hatten. Obzwar sie partiell frei waren, das heißt, dass für sie nicht mehr der Status des Eigentums irgendeines Gutbesitzers oder Feudalherren galt, so bestand ihre partielle Freiheit allenfalls darin, wählen zu dürfen, von welchen Feudalherren sie sich ausbeuten lassen wollten. Sie waren zusammen genommen mit den Bauern kein Menschen-Besitz mehr wie es noch die Sklaven waren, aber dennoch stellten sie diejenige Majorität dar, die das allgemeine Elend zu ertragen hatten. Um diese gewinnorientierte Repression für sich zu prolongieren, scheuten sich die feudalen Herrschaftsstrukturen nicht, eine mörderische Staatsgewalt anzuwenden. Für die Rehabilitierung der politischen Ordnung im Sinne der konservierenden Aufrechterhaltung der hierarischen Machverhältnisse worden einigen Kritikern oder unangenehmen Konkurrenten per Dekret kurzerhand der Kopf abgehackt. Gefängnisstrafen, Freiheitsentzug, Quälerei, körperliche Schändungen oder Erpressungen waren weitere Zuchtmittel zur damaligen Zeit, um die Menschen, die unadlige Untertanen waren, gefügig und gehorsam zu machen. Doch dieses Unheil, welches sich als Schreckensgespenst von Seiten der Regierungen und der aristokratischen Führungsschicht verbreitete, war ein unverkennbares Signum für eine unvollständige Zivilisation. Schnell stellten sich auch die psychologischen Begleiterscheinungen in den Köpfen ein, die in allgemeiner Ängstlichkeit und in Misstrauen zu den Zeitgenossen seinen Ausdruck fanden. Aus Unbekannten wurden Feinde, die man mit List, Betrug, Diebstahl und bewusster Täuschung zu schwächen beabsichtigte. Wodurch der soziale Antagonismus sich keineswegs auflöste, sondern in ein neues Stadium seiner Entwicklung hineingeriet. Mit der Industrialisierung und der zunehmenden Anwendung von Maschinen entstand zugleich auch das Industrieproletariat. Die feudale Herrschaftsordnung wurde zunehmend von der bürgerlichen Herrschaftsordnung ersetzt, und die Kapitalisten übernahmen vermehrt die Zügel der Ausbeutung. Das Proletariat, die größtenteils besitzlos waren, mussten ihre Arbeitskraft dem Kapitalisten verkaufen, und teilweise bis zu 16 Stunden täglich schuften, während die Besitzenden, die das Kapital als ihr Privatbesitz auf ihrer Seite hatten, immer reicher und bequemlicher worden. Eine ausschlaggebende Ursache für die materielle Ungleichheit sowie für die Verelendung der Massen sah Saint-Simon gerade in den Eigentumsverhältnissen begründet, die oftmals nicht durch Verdienst erarbeitet, sondern durch familiäre Vererbung weitergeführt worden.
4. Die saint-simonistische Gesellschaftauffassung:
Da schien eine Gesellschafts-Utopie für die neue Industriegesellschaft im Zuge der Aufklärung nahezu als eine politische und sozio-ökonomische Notwendigkeit zu sein. Eine neue Gesellschaftslehre als Epiphänomen der französischen Revolution sollte entstehen, die die Menschen in den sozialen Aktionsräumen, Gerechtigkeit, Ausgeglichenheit und Eintracht geben wollte. So suchte Saint-Simon nach den Entwicklungsgesetzen der Menschen, gleichsam nach der sozialen Gesetzmäßigkeit in der kulturellen Genese. Er schreibt: „Die Menschheit ist ein Kollektivwesen, dass sich durch Generation zu Generation hindurch so entwickelt wie das Individuum im Verlaufe der Lebensalter. Ihre Entwicklung geht aufwärts.“
Das Prinzip, welches die Saint-Simonisten als „ das physiologische Gesetz des Menschengeschlechts“4 benennen, ist das Prinzip der Soziogenese. Er ist der Ansicht, dass der gesellschaftliche Fortschritt, sich in einer Höherentwicklung des gesellschaftlichen Zusammenlebens manifestiert. Dafür durchläuft die Menschheit, bzw. eine Volksnation oder eine soziale Gemeinschaft, die durch eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Tradition, und gemeinsame kulturelle Werte gekennzeichnet ist, im historischen Verlauf mehrere Entwicklungsphasen. Diese Entwicklungsphasen, die zu unterschiedlichen Epochen gehören, sind eingeteilt in organische Epochen (konstruktive, aufbauende, versöhnende Zeitalter) und in kritische Epochen (destruktive, zerstörerische, negative Zeitalter) Die Übergänge passieren in einem allmählich historischen Prozess und tragen zur allgemeinen Entwicklung der Menschheit bei. Dabei ist die kritische Epoche, diejenige Epoche, die als überprüfende Antwort zu den unerfüllten Zielen der organischen Epoche seine Wirksamkeit erfährt, als auch stellt sie eine Vorraussetzung für die weitere soziale Genese und Bildung einer organischen Epoche dar. In diesen organischen Epochen werden allgemeine Entwicklungsziele festgesetzt, Gesetzgebung und Rechtssprechung sind an diesen entworfenen Zielen orientiert, als auch soll durch die Erziehung, das Denken, Fühlen und Handeln der Menschen in Einklang mit den allgemeinen gesellschaftlichen Zielen gebracht werden. Dabei sah Saint-Simon ein immer Weitervoranschreiten in der Organisation der Assoziationen, von Familien, als die ursprünglichen Assoziationen hin zu Gemeinden, Städtegemeinschaften, zu Nationen, zu Staatsbündnissen, internationalen Allianzen und bis hin zur Weltgesellschaft. Die gesellschaftlichen Antagonisten sollten überwunden, Eroberungskriege nach außen und Ausbeutungsverhältnisse innerhalb der Gesellschaften sollten durch den Fortschritt der Assoziationen abgeschafft werden. Desweiteren plädierte er für die Beseitigung des finanziellen und materiellen Erbrechts, wodurch die materiellen Ungleichheiten als Grundvoraussetzung für die individuelle und kollektive Lebensentwicklung abgeschafft werden sollten. Die Produzenten der Gemeinschaftsgüter seien gleichberechtigt und gleichwertig in ihrer menschlichen Existenz, sie hätten sich durch eigene Leistungen auszuzeichnen und würden nicht beurteilt werden auf Basis ihrer geerbten Privilegien oder materiellen Vorrechte.
5. Zur saint-simonistischen Anthropologie
Um der menschlichen Verdummung und der sittlichen Verrohung entgegenzuwirken, besteht ein allgemeines Recht auf Bildung. Im Allgemeinen ist eine Annahme in dem anthropologischen Verständnis von Saint-Simon, dass wir Menschen von Natur aus alle unterschiedlich begabt und mit anderen Fähigkeiten ausgestattet sind. Durch verschiedene Anlagen, Talente und seelische Vermögen können wir unsere Potentiale auf je selbstständige Weise verwirklichen. Dieser Umstand begründet eine natürliche Ungleichheit der Menschen untereinander, die wiederum den Ausgangspunkt darstellt, für die Bildung von Vereinigungen, Organisationen und Assoziationen. Die unterschiedlichen Begabungen seien angeboren und könnten durch Erziehung und Erfahrung zum Nutzen des Gemeinwohls entfaltet werden. Durch Austausch und gegenseitiger Hilfe könnten wir uns wechselseitig ergänzen, von einander lernen, mithilfe unserer Erinnerungen das schon Gewusste wieder erkennen, sodass kooperative Interaktionsbeziehungen entstehen. Auf Grundlage dieser Überlegung erwägt er eine Dreiteilung der Gesellschaft in Industrielle, Wissenschaftler und Künstler, die jedoch nicht getrennt von einander arbeiten, sondern Brücken bauen, sich vernetzen und gemeinsam werktätig sind . „Aufgabe der Wissenschaftler sei es, den „pouvoir spirituel“ (die geistliche Macht bzw. die spirituelle Kraft) auszuüben, d.h. vor allem, die wissenschaftlichen Vorraussetzungen für die Produktionssteigerung zu schaffen. Eine nicht minder dienende Funktion haben die Künstler: sie sind die Propagandisten der Zukunftsvision der neuen Gesellschaft.“5
Die Arbeit gilt für Saint-Simon als das Medium der menschlichen Schöpferkraft. Sie ist als Ausdruck individueller Fähigkeiten und Vermögen, die Quelle für die innere Erfüllung und den äußeren Reichtum. Nur durch selbstgewählte Arbeit können wir das Glück erreichen, nur durch selbsttätige Arbeit können wir von einem sinnvollen und nützlichen Leben sprechen. Dabei ist die individuelle Tätigkeit zugleich ein Prozess für die gesellschaftliche Wirklichkeit. „Deshalb ist der produktive Mensch nicht bloß der allein glückliche, er ist auch der allein moralische Mensch.“6 (s.118 Höppner-Seidel)
Die Auslebung seiner Fähigkeiten, die Mühen, Anstrengungen, Initiativen und die nützliche Einsatzfreude sind primärer Grund dafür, welche gesellschaftliche Position und Wertschätzung der Einzelne erfährt. Diejenigen, die sich durch den ihrigen Arbeitseinsatz ihre Position auch verdienen, sollen dort auch entscheidungsberechtigt sein, für das Wohl des Kollektivs handlungswirksam zu agieren. Diejenigen also, die sich durch mühevollen Verdienst im organisierten Gesellschafts- und Produktionsprozess auszeichnen, sollen demnach bestimmte Funktionen übernehmen, in denen sie für den Nutzen der Gesellschaft entscheiden und zweckdienlich handeln. Dabei wird der Dienst innerhalb politischer, sozialer, kultureller, medizinischer und therapeutischer Einrichtungen ebenso als eine verdienstvolle Arbeit anerkannt, wie die wertschöpfenden Arbeiten von Industriellen und Warenproduzenten. Die Leitung in solchen Produktions- und Aktionsstätten sollen die Erfahrendsten und Tüchtigsten übernehmen, die am besten handelnden Individuen und somit den Produktions- und Tätigkeitsprozess im Sinne des Gemeinwohls uneigennützig koordinieren. „Im alten System wird die Gesellschaft von Menschen regiert, im neuen nurmehr von Grundsätzen.“7 (s.130) Das persönliche Interesse ist gleichsam durchdrungen von dem gemeinschaftlichen Interesse und sämtliche produktionsentscheidenden Handlungen sind am Vorteil der Mehrheit orientiert. Bei verminderter Einsatzbereitschaft oder mangelhafter Pflichterfüllung müssten die Personen in diesen produktionsleitenden Positionen wieder abgesetzt werden, sodass keiner sich, wenn er seine Position behalten will, auf die faule Haut legen dürfte, um sich dem Müßiggang oder der instrumentalisierenden Ausbeutung hingeben zu können. Ein Für-sich-Arbeiten-lassen, ohne eigene verdienstvolle Beteiligung am Gesamtprozess, wäre von vornherein verboten und müsste, falls es doch in Einzelfällen aufträte, gerechtigkeitsausgleichend sanktioniert werden.
[...]
1 Adler, Max, „Wegweiser. Studien zu Geistesgeschichte des Sozialismus“ Hess&Co.Verlag Wien, Leipzig, 1931, s. 248
2 Adler, Max, „Wegweiser. Studien zu Geistesgeschichte des Sozialismus“ Hess&Co.Verlag Wien, Leipzig, 1931, s. 238
3 „Darstellung der saint-simonistischen Lehre“ in „Der Frühsozialismus“ ausgewählte Quellentexte hrsg. von Thilo Ramm, Alfred Körner Verlag Stuttgart, 1956, s.73
4 „Die saint-simonistische Lehre“ in „Von Babeuf bis Blanqui. Französischer Sozialismus und der Kommunismus vor Marx, Band II“ hrsg. von J.Höppner/ W.Seidel-Höppner, Reclam Verlag,Leipzig,1975 s. 149
5 Metzler Philosophen Lexikon. Von den Vorsokratikern bis zu den Neuen Philosophen. Hrsg. von Bernd Lutz, J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung Stuttgart, 1989, s. 773
6 „Claude-Henri Saint-Simon“ in „Von Babeuf bis Blanqui. Französischer Sozialismus und der Kommunismus vor Marx, Band I Einführung“ hrsg. von J.Höppner/ W.Seidel-Höppner, Reclam Verlag,Leipzig,1975 s. 118
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptfokus dieses Textes?
Dieser Text analysiert die sozialistischen Theorien von Henri de Saint-Simon und vergleicht sie teilweise mit den Vorstellungen von Cabet. Es geht um die Ideen des Frühsozialismus und ihre Relevanz für die soziale Frage und zukünftige Gesellschaftsentwürfe.
Wer war Henri de Saint-Simon?
Henri de Saint-Simon war ein früher sozialistischer Denker, der sich für die gesellschaftliche und ökonomische Verbesserung der Lebensbedingungen aller Menschen einsetzte. Er strebte die Aufhebung des Elends, die Abschaffung des Erbrechts und die Verwirklichung von Gerechtigkeit und Teilhabe an.
Was ist die saint-simonistische Gesellschaftsauffassung?
Die saint-simonistische Gesellschaftsauffassung basiert auf der Idee des gesellschaftlichen Fortschritts durch verschiedene Entwicklungsphasen, nämlich organische und kritische Epochen. Saint-Simon sah eine Höherentwicklung des gesellschaftlichen Zusammenlebens und plädierte für die Beseitigung von Ungleichheiten und Ausbeutung.
Wie sieht Saint-Simon die Rolle der Arbeit in der Gesellschaft?
Saint-Simon betrachtet Arbeit als das Medium der menschlichen Schöpferkraft und als Quelle für innere Erfüllung und äußeren Reichtum. Er glaubt, dass Menschen durch selbstgewählte und nützliche Arbeit Glück erreichen können. Die gesellschaftliche Position und Wertschätzung sollen auf dem individuellen Arbeitseinsatz beruhen.
Was ist die saint-simonistische Anthropologie?
Die saint-simonistische Anthropologie geht davon aus, dass Menschen von Natur aus unterschiedlich begabt sind. Diese Unterschiede begründen die Bildung von Vereinigungen und Organisationen, in denen sich die Individuen durch Austausch und gegenseitige Hilfe ergänzen können.
Was kritisiert Saint-Simon an den bestehenden Verhältnissen?
Saint-Simon kritisiert die materiellen Ungleichheiten und die Ausbeutung in der Gesellschaft. Er sieht die Eigentumsverhältnisse, die oft durch Vererbung entstanden sind, als eine Hauptursache für die Verelendung der Massen.
Was ist die Bedeutung der Begriffe "organische Epoche" und "kritische Epoche" im Text?
Die Begriffe bezeichnen unterschiedliche Entwicklungsphasen der Gesellschaft. Organische Epochen sind konstruktive und aufbauende Zeitalter, während kritische Epochen destruktive und überprüfende Zeitalter sind, die eine Voraussetzung für die weitere soziale Genese darstellen.
Wie unterscheidet sich Saint-Simons Ansatz von dem anderer Sozialisten (wie Cabet)?
Der Text stellt Saint-Simon als einen Vertreter des meriokratischen Sozialismus dar, während Cabet als ein Befürworter des bedarfsorientierten Kommunismus charakterisiert wird. Der Text zielt darauf ab, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden Ansätze zu analysieren.
- Citation du texte
- Alexej Licharew (Auteur), 2016, Der französische Frühsozialismus. Die soziale Frage in Anlehnung an Saint-Simon und Cabet, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/490789