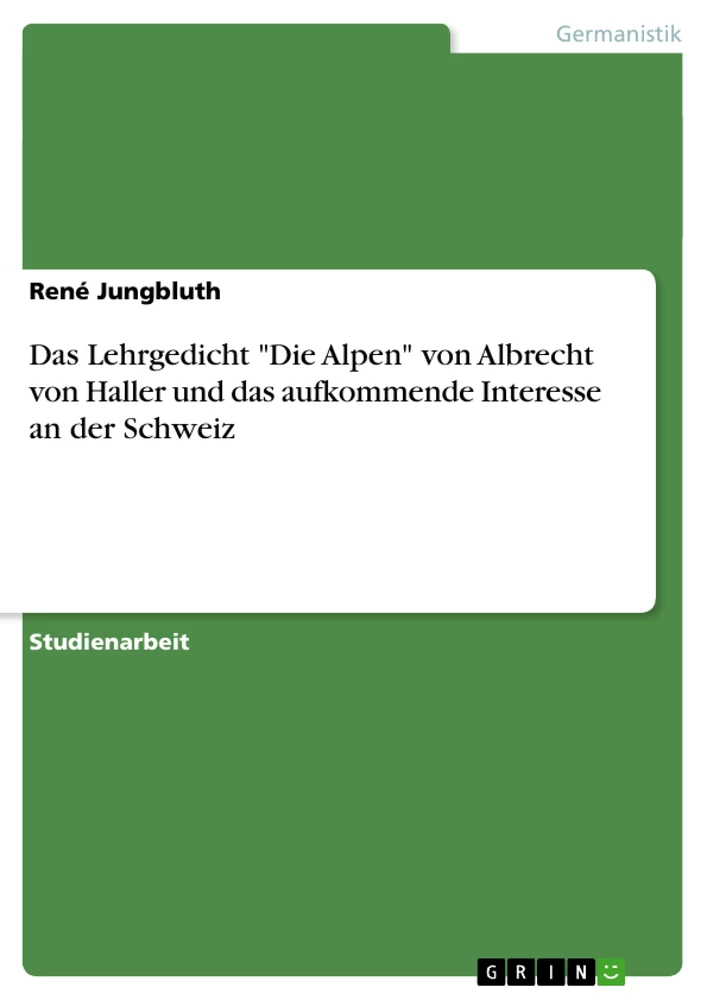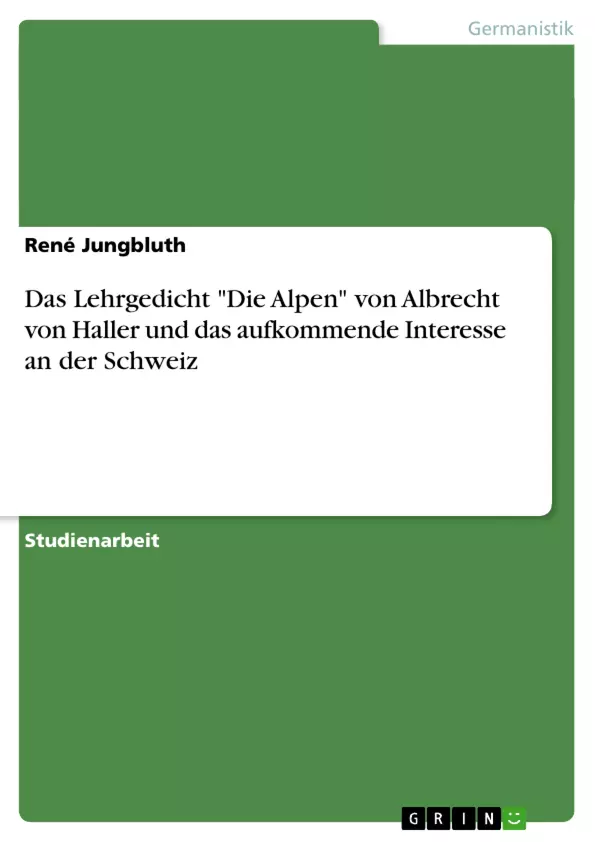Die Alpen werden im 18 Jahrhundert erstmals zum Untersuchungsgegenstand der Forschung. Bis zu Beginn des 18. Jahrhunderts hat man die Alpen als Un- Kulturraum wahrgenommen und sie nur „als zu überwindendes Schrecknis“ empfunden. Man mied die Berge und überquerte sie nur widerwillig, um südliche Gefilde aufzusuchen. Jeder Gebildete kannte die Schilderung Hannibals mit seinen unvorstellbaren Schwierigkeiten, die Kämpfe mit den Bergbewohnern, die unbegehbaren Wege auf den Gebirgshöhen und den frühen Einbruch des Winters mit Schnee, Eis und Kälte. Die Einstellung zu den Alpen änderte sich grundlegend im 18. Jahrhundert. Die Naturwissenschaften stimulierten das Interesse an den Alpen und rückten sie für die Forscher in den Vordergrund.
Mit Albrecht von Haller und die seinem Gedicht „Die Alpen“ beschriebene Reflexion seiner Alpenreise in die Schweiz, die er mit dem befreundeten Naturwissenschaftler Johann Gessner 1728 unternommen hatte, werden die Menschen des 18. Jahrhunderts mit dem bis dahin eher unbekannten Gebirge, das auch als „Terra Incognita“ bezeichnet wird, konfrontiert. Er führt der deutschen Lyrik das Gebirge als neuen Inhalt zu und versucht das Kolorit dieser bestimmten Landschaft wiederzugeben.
Doch Haller soll mit den „Alpen“ nicht nur einen Imagewandel der abschreckenden Alpen bewirkt haben, sondern soll auch eine „Welle der Schweizerbegeisterung ausgelöst haben“. Im Jahr 1793 stellt Johannes Bürkli in der Vorrede zu seiner zusammengestellten Sammlung „Gedichte über die Schweiz und über Schweizer“ sogar fest, dass sich die Schweiz zum „Modeland“ „der Reisenden aller Classen“ entwickelt habe.5
Doch was führt zu so einer plötzlichen Beliebtheit der Alpen? Was für einen Anteil lässt sich Hallers Gedicht zuschreiben?
In der vorliegenden Hausarbeit sollen einige Aspekte diskutiert werden, die möglicherweise ausschlaggebend für die Alpenbegeisterung sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gattungsproblematik
- Die zeitgenössische Rezeption
- Die Leserschaft
- Die Nachahmung der „Alpen“
- Die Inhalte
- Die Naturbeschreibungen
- Die postulierte Schönheit der Flora
- Die Hof- und Stadtkritik
- Die Korrelation der Naturbeschreibungen mit der theologischen Auffassung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Frage, welche Faktoren zur steigenden Beliebtheit der Alpen im 18. Jahrhundert beigetragen haben. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Gedicht „Die Alpen“ von Albrecht von Haller, das als einflussreicher Katalysator dieser Begeisterung gilt. Die Arbeit untersucht, wie Hallers Werk das Bild der Alpen als abschreckendes „Schrecknis“ veränderte und zu einer neuen Wahrnehmung der Schweiz als „Modeland“ führte.
- Das Gedicht „Die Alpen“ von Albrecht von Haller als Impulsgeber für die Alpenbegeisterung
- Der Imagewandel der Alpen im 18. Jahrhundert von einem abschreckenden „Schrecknis“ zu einem „Modeland“
- Die Rezeption von Hallers Gedicht im Kontext der zeitgenössischen Literatur und Kultur
- Die Gattungsproblematik von „Die Alpen“ und seine Einordnung in das literarische Gefüge der Zeit
- Die Rolle von Naturwissenschaft und Philosophie in der neuen Wahrnehmung der Alpen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die historische Wahrnehmung der Alpen bis zum 18. Jahrhundert und stellt den Wandel hin zu einer neuen, positiv besetzten Perspektive dar. Dieses Interesse wird vor allem auf die naturwissenschaftliche Forschung sowie auf die Alpenreise Hallers zurückgeführt, die er 1728 mit Johann Gessner unternahm. In seiner Reflexion auf diese Reise, dem Gedicht „Die Alpen“, setzt sich Haller mit der bis dahin eher unbekannten Berglandschaft auseinander und trägt maßgeblich zu ihrer Popularisierung bei.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Schwierigkeit, Hallers Gedicht in eine literarische Gattung einzuordnen. Die Debatte um die Einordnung von „Die Alpen“ als Lehrgedicht, Deskription oder Idyll wird beleuchtet, wobei die Arbeiten von Albertsen und Siegrist herausgestellt werden, die das Gedicht als ein Zusammenspiel von Deskription und moralphilosophischen Lehrsätzen interpretieren.
Der dritte Abschnitt untersucht die Rezeption von Hallers Gedicht in der Zeit seiner Entstehung. Dabei wird die Leserschaft beleuchtet, die sich hauptsächlich aus dem gebildeten Bürgertum zusammensetzte, und die Rolle von Hallers Werk in der zeitgenössischen Literatur wird anhand von Nachahmungen und Zitaten in anderen Werken analysiert.
Die Inhalte von „Die Alpen“ stehen im Fokus des vierten Kapitels. Die Beschreibungen der Natur, die postulierte Schönheit der Alpenflora und die Kritik an Hof und Stadt werden in diesem Abschnitt beleuchtet. Darüber hinaus wird die Verbindung von Naturbeschreibungen und theologischen Ansichten in Hallers Werk behandelt.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit Themen wie der Alpenbegeisterung des 18. Jahrhunderts, dem Gedicht „Die Alpen“ von Albrecht von Haller, der Gattungsproblematik des Werks, der zeitgenössischen Rezeption, der Naturbeschreibung, der theologischen Deutung der Landschaft und der Rolle des Bürgertums als kulturelle Kraft.
- Citation du texte
- René Jungbluth (Auteur), 2004, Das Lehrgedicht "Die Alpen" von Albrecht von Haller und das aufkommende Interesse an der Schweiz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49085