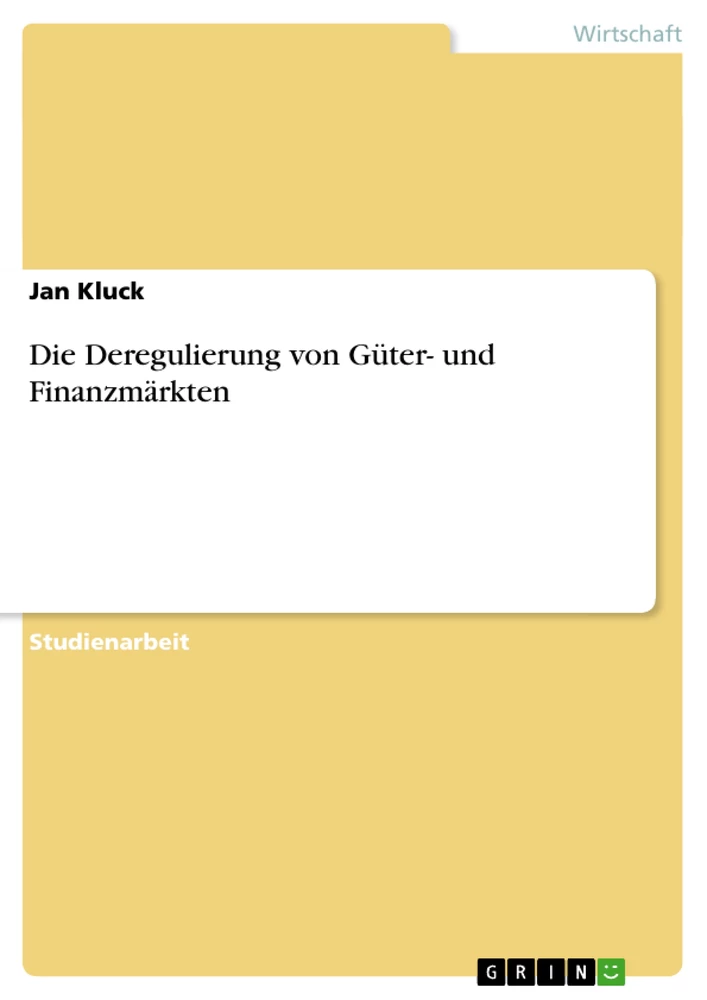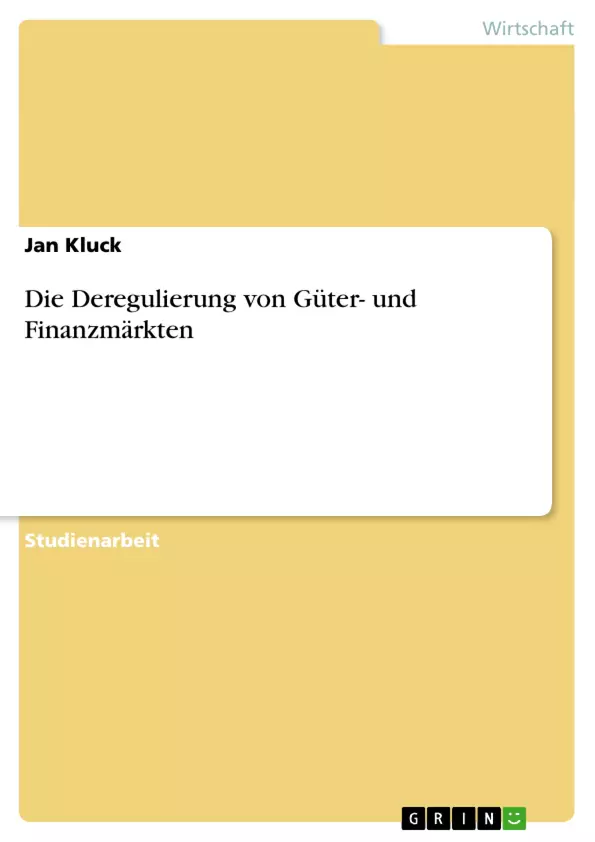Im Jahre 2000 wandte sich Robert Solow mit einigen Empfehlungen an die europäische und dabei speziell an die deutsche Beschäftigungspolitik. Er kritisierte vor allem eine zu einseitige Fokussierung auf politisch schwer durchsetzbare Lösungsvorschläge wie den Abbau von staatlichen Sozialleistungen und die Flexibilisierung der Arbeitsmärkte. Die Chancen, die sich auf einfacherem Wege durch Deregulierung der Güter- und Kapitalmärkte ergäben, würden demgegenüber sträflich vernachlässigt. Bereits durch eine Verbesserung des Risikokapitalangebots nach amerikanischem Vorbild könne eines der Hauptprobleme der Europäer, die Schaffung neuer Jobs, effektiv angegangen werden. In diesem Sinne befasst sich die vorliegende Arbeit mit der Deregulierung auf Güter- und Kapitalmärkten und den damit einhergehenden Auswirkungen auf die Entwicklung der Arbeitslosigkeit. Sie beginnt mit einem kurzen Überblick über die gängigsten Argumetationen bezüglich der Beschäftigungswirkungen von Deregulierung. Anschließend wird beispielhaft die formalen Herleitung der zuvor beschriebenen Effekte durch Blanchard und Philippon dargestellt. Diese berücksichtigt auch die grundsätzliche Möglichkeit von negativen Auswirkungen durch Deregulierung auf die Beschäftigungssituation sowie die Rolle unvollständiger Information bei der Lohnfindung. Im abschließenden Ausblick stehen einige Überlegungen zur Politischen Ökonomie im Mittelpunkt, welche die Durchsetzbarkeit von Deregulierung betreffen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beschäftigungswirkungen der Gütermarktderegulierung
- Monopolrenten und Löhne
- Gütermärkte und Produktivität
- Beschäftigungswirkungen der Kapitalmarktderegulierung
- Quasi-Renten und Löhne
- Kapitalmärkte und Innovation
- Der Modellansatz von Blanchard / Philippon
- Hypothese
- Annahmen und Vereinfachungen
- Herleitung der gesamtwirtschaftlichen Beschäftigung
- Beschäftigungswirkung der Deregulierung
- Empirische Evidenz
- Ausblick / Überlegungen zur Politischen Ökonomie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit den Auswirkungen der Deregulierung auf Güter- und Kapitalmärkten auf die Beschäftigung. Der Fokus liegt dabei auf den Auswirkungen dieser Deregulierung auf die Arbeitslosigkeit, die durch verbesserte Wettbewerbsbedingungen und die Förderung von Innovationen entstehen können. Die Arbeit analysiert die theoretischen Argumente, die für eine positive Beschäftigungswirkung von Deregulierung sprechen, und beleuchtet diese durch die Anwendung eines Modells von Blanchard und Philippon.
- Beschäftigungswirkungen der Deregulierung auf Güter- und Kapitalmärkten
- Rolle von Monopolrenten und Quasi-Renten
- Zusammenhang zwischen Deregulierung, Wettbewerb und Innovation
- Analyse des Modells von Blanchard und Philippon
- Überlegungen zur Politischen Ökonomie von Deregulierung
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den Kontext der Seminararbeit dar und beleuchtet die Kritik von Robert Solow an der einseitigen Fokussierung der europäischen Beschäftigungspolitik.
- Kapitel 2 diskutiert die Beschäftigungswirkungen der Deregulierung auf Gütermärkten, indem es die Rolle von Monopolrenten, Lohnverhandlungen und die Auswirkungen auf die Güterpreise beleuchtet.
- Kapitel 3 befasst sich mit den Beschäftigungswirkungen der Deregulierung auf Kapitalmärkten, indem es die Rolle von Quasi-Renten, Innovationen und die Auswirkungen auf die Kapitalallokation betrachtet.
- Kapitel 4 widmet sich dem Modellansatz von Blanchard und Philippon, das die formalen Auswirkungen der Deregulierung auf die Beschäftigung untersucht.
Schlüsselwörter
Deregulierung, Gütermarkt, Kapitalmarkt, Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Monopolrenten, Quasi-Renten, Wettbewerb, Innovation, Modell von Blanchard und Philippon, Politische Ökonomie.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hat die Gütermarktderegulierung auf die Beschäftigung?
Deregulierung auf Gütermärkten kann Monopolrenten abbauen, was zu niedrigeren Preisen und einer höheren Produktivität führt, was langfristig die Nachfrage nach Arbeit steigern kann.
Was bewirkt die Deregulierung von Kapitalmärkten?
Ein verbessertes Angebot an Risikokapital fördert Innovationen und die Gründung neuer Unternehmen, was als effektives Mittel zur Schaffung neuer Arbeitsplätze gilt.
Was ist der Kern des Modellansatzes von Blanchard und Philippon?
Das Modell untersucht formal, wie Deregulierung die Lohnfindung und Beschäftigung beeinflusst, wobei auch die Rolle unvollständiger Informationen und potenziell negative Kurzfristeffekte berücksichtigt werden.
Warum kritisierte Robert Solow die deutsche Beschäftigungspolitik?
Solow kritisierte die einseitige Konzentration auf den Abbau von Sozialleistungen und forderte stattdessen, die Chancen der Deregulierung von Güter- und Kapitalmärkten stärker zu nutzen.
Welche Rolle spielen "Monopolrenten" bei der Arbeitslosigkeit?
Hohe Monopolrenten können zu überhöhten Preisen und künstlicher Knappheit führen, was die gesamtwirtschaftliche Beschäftigung drosselt. Deregulierung soll diesen Effekt umkehren.
- Citar trabajo
- Jan Kluck (Autor), 2003, Die Deregulierung von Güter- und Finanzmärkten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49093