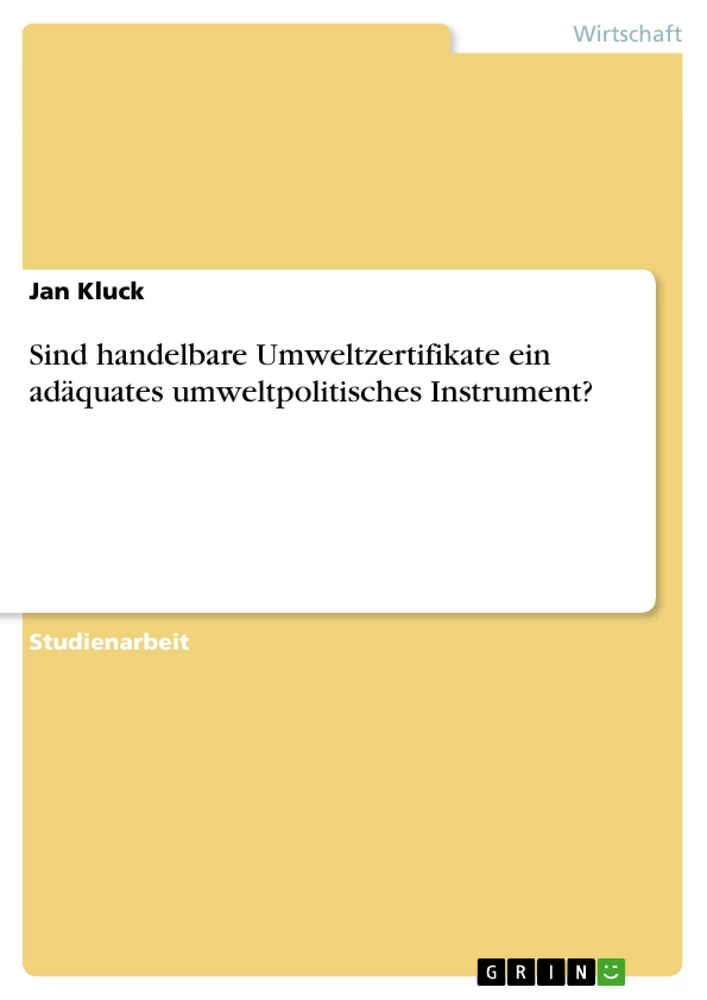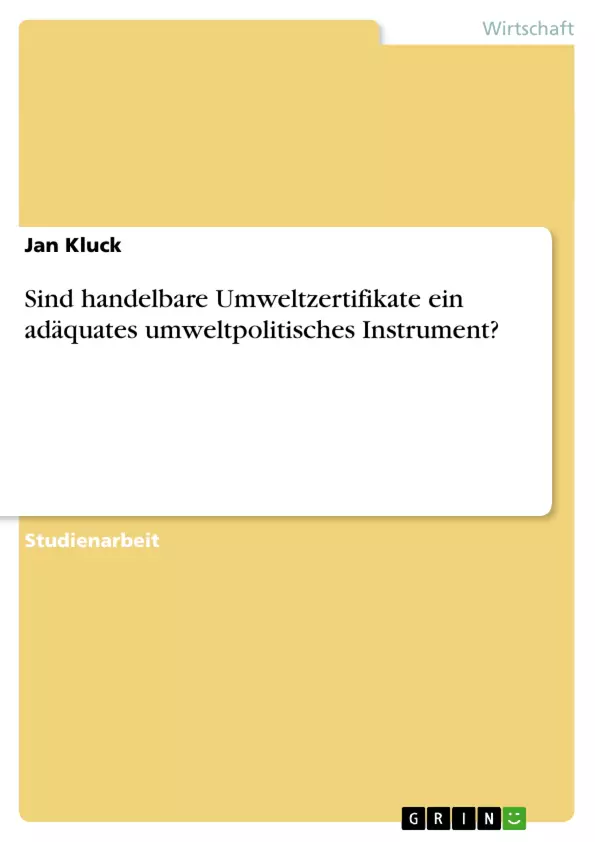Seit mehr als 30 Jahren erfreuen sich handelbare Umweltzertifikate in der wissenschaftlichen Diskussion großer Beliebtheit. Die modelltheoretische Forschung verspricht für diesen marktwirtschaftlichen Politikansatz ein zielgenaues Erreichen umweltpolitischer Ziele bei gleichzeitiger Minimierung der dafür aufzubringenden gesellschaftlichen Kosten. Ein weiterer Schritt in Richtung Ausgleich zwischen ökonomischer und ökologischer Effizienz, zwischen wirtschafts- und umweltpolitischen Interessen scheint durch die Stärkung ökonomischer Anreize für die Reduktion von Emissionen möglich zu sein.
Trotz nachdrücklicher wissenschaftlicher Empfehlungen und praxisnaher Modellspezifikationen lassen sich weltweit allerdings nur sehr wenige Beispiele für Umsetzungsversuche finden, bis heute wird das umweltpolitische Geschehen von Abgaben- und Auflagenpolitik dominiert. Die positiven Erfahrungen einiger Projekte in den Vereinigten Staaten scheinen jedoch das Interesse vieler Entscheidungsträger geweckt zu haben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlegende Eigenschaften handelbarer Umweltzertifikate
- 2.1. Definition, Funktionsweise und Einordnung
- 2.2. Alternative Ausgestaltungsmöglichkeiten
- 2.2.1. Erstvergabeverfahren
- 2.2.2. Räumliche Differenzierung
- 2.2.3. Laufzeiten
- 2.2.4. Emissionskontrolle und Sanktionen
- 2.3. Eigenschaften des Zertifikatmarktes
- 3. Vergleich mit ordnungsrechtlichen Politikansätzen
- 3.1. Ökologische Zielgenauigkeit
- 3.2. Ökonomische Effizienz
- 3.3. Umwelttechnologischer Fortschritt
- 3.4. Zusammenfassung weiterer Argumente
- 4. Vergleich mit marktwirtschaftlichen Politikansätzen
- 4.1. Ökologische Zielgenauigkeit
- 4.2. Ökonomische Effizienz
- 4.3. Umwelttechnologischer Fortschritt
- 4.4. Zusammenfassung weiterer Argumente
- 5. Erfahrungen aus Umsetzungsversuchen
- 5.1. Überblick
- 5.2. Emissionshandelssysteme in den USA
- 5.2.1. US Lead Phasedown Tradable Permit Market
- 5.2.2. Das Acid-Rain-Programm
- 5.2.3. Das RECLAIM-Programm
- 5.3. Das Emissionshandelssystem in Dänemark
- 5.4. Das Emissionshandelssystem in Großbritannien
- 6. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Eignung handelbarer Umweltzertifikate als umweltpolitisches Instrument. Die Arbeit analysiert die Funktionsweise dieser Zertifikate, vergleicht sie mit anderen Ansätzen und bewertet empirische Erfahrungen aus verschiedenen Ländern.
- Funktionsweise und Eigenschaften handelbarer Umweltzertifikate
- Vergleich mit ordnungsrechtlichen und marktwirtschaftlichen Instrumenten
- Ökologische und ökonomische Effizienz
- Anreize für umwelttechnologischen Fortschritt
- Auswertung von Implementierungsversuchen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik handelbarer Umweltzertifikate ein und beschreibt deren Bedeutung in der wissenschaftlichen Diskussion. Sie hebt den Wunsch nach einem Ausgleich zwischen ökonomischer und ökologischer Effizienz hervor und stellt die Forschungsfrage nach der Adäquatheit dieser Zertifikate als umweltpolitisches Instrument. Die Arbeit kündigt die Struktur der folgenden Kapitel an, welche die Funktionsweise, den Vergleich mit anderen Instrumenten und die empirischen Erfahrungen beleuchten.
2. Grundlegende Eigenschaften handelbarer Umweltzertifikate: Dieses Kapitel definiert handelbare Umweltzertifikate, beschreibt deren Funktionsweise und ordnet sie im Kontext anderer umweltpolitischer Instrumente ein. Es werden verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten wie Erstvergabeverfahren, räumliche Differenzierung, Laufzeiten und Emissionskontrollen detailliert betrachtet. Der Fokus liegt auf der modelltheoretischen Analyse des Zertifikatmarktes und seinen ökologischen und ökonomischen Auswirkungen im Marktgleichgewicht.
3. Vergleich mit ordnungsrechtlichen Politikansätzen: Kapitel 3 vergleicht handelbare Umweltzertifikate mit ordnungsrechtlichen Politikansätzen. Die Analyse konzentriert sich auf die ökologische Zielgenauigkeit und die ökonomische Effizienz beider Ansätze. Es wird aufgezeigt, wo ordnungsrechtliche Instrumente im Vergleich zu Zertifikaten Nachteile aufweisen, insbesondere in Bezug auf ökonomische Effizienz. Die im vorherigen Kapitel gewonnenen Erkenntnisse über Emissionsrechte werden hier mit den Eigenschaften ordnungsrechtlicher Instrumente gegenübergestellt.
4. Vergleich mit marktwirtschaftlichen Politikansätzen: Dieses Kapitel vergleicht handelbare Umweltzertifikate mit anderen marktwirtschaftlichen Instrumenten, insbesondere Umweltsteuern. Die Analyse konzentriert sich auf die ökologische Zielgenauigkeit, ökonomische Effizienz und die Anreize für umwelttechnologischen Fortschritt. Es wird ein detaillierter Vergleich der verschiedenen Ansätze durchgeführt, um deren Vor- und Nachteile zu identifizieren.
5. Erfahrungen aus Umsetzungsversuchen: Kapitel 5 präsentiert einen empirischen Überblick über Erfahrungen aus der Umsetzung von Emissionshandelssystemen in verschiedenen Ländern, wie den USA (US Lead Phasedown Tradable Permit Market, Acid-Rain-Programm, RECLAIM-Programm), Dänemark und Großbritannien. Diese Erfahrungen werden mit den im vorherigen Kapitel gewonnenen theoretischen Erkenntnissen in Beziehung gesetzt, um die praktische Relevanz und Effektivität der verschiedenen Ansätze zu bewerten.
Schlüsselwörter
Handelbare Umweltzertifikate, Emissionshandel, Umweltpolitik, Ordnungsrecht, Marktwirtschaft, Ökologische Effizienz, Ökonomische Effizienz, Umwelttechnologischer Fortschritt, Emissionskontrolle, Marktgleichgewicht, Implementierungsversuche, USA, Dänemark, Großbritannien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Handelbare Umweltzertifikate"
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht die Eignung handelbarer Umweltzertifikate als umweltpolitisches Instrument. Sie analysiert die Funktionsweise dieser Zertifikate, vergleicht sie mit anderen Ansätzen (ordnungsrechtlichen und marktwirtschaftlichen Instrumenten) und bewertet empirische Erfahrungen aus verschiedenen Ländern (USA, Dänemark, Großbritannien).
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Funktionsweise und Eigenschaften handelbarer Umweltzertifikate, den Vergleich mit ordnungsrechtlichen und marktwirtschaftlichen Instrumenten, die ökologische und ökonomische Effizienz, Anreize für umwelttechnologischen Fortschritt und die Auswertung von Implementierungsversuchen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Grundlegende Eigenschaften handelbarer Umweltzertifikate, Vergleich mit ordnungsrechtlichen Politikansätzen, Vergleich mit marktwirtschaftlichen Politikansätzen, Erfahrungen aus Umsetzungsversuchen und Ausblick. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Thematik und baut auf den vorhergehenden Kapiteln auf.
Was sind die zentralen Ergebnisse des Kapitels "Grundlegende Eigenschaften handelbarer Umweltzertifikate"?
Dieses Kapitel definiert handelbare Umweltzertifikate, beschreibt ihre Funktionsweise und ordnet sie im Kontext anderer umweltpolitischer Instrumente ein. Es werden verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten (Erstvergabeverfahren, räumliche Differenzierung, Laufzeiten, Emissionskontrollen) detailliert betrachtet. Der Fokus liegt auf der modelltheoretischen Analyse des Zertifikatmarktes und seinen ökologischen und ökonomischen Auswirkungen im Marktgleichgewicht.
Wie werden handelbare Umweltzertifikate mit ordnungsrechtlichen Ansätzen verglichen?
Kapitel 3 vergleicht handelbare Umweltzertifikate mit ordnungsrechtlichen Politikansätzen. Die Analyse konzentriert sich auf die ökologische Zielgenauigkeit und die ökonomische Effizienz beider Ansätze. Es werden die Nachteile ordnungsrechtlicher Instrumente im Vergleich zu Zertifikaten (insbesondere hinsichtlich der ökonomischen Effizienz) aufgezeigt.
Wie werden handelbare Umweltzertifikate mit marktwirtschaftlichen Ansätzen verglichen?
Kapitel 4 vergleicht handelbare Umweltzertifikate mit anderen marktwirtschaftlichen Instrumenten (z.B. Umweltsteuern). Die Analyse konzentriert sich auf ökologische Zielgenauigkeit, ökonomische Effizienz und Anreize für umwelttechnologischen Fortschritt. Es wird ein detaillierter Vergleich der verschiedenen Ansätze durchgeführt, um deren Vor- und Nachteile zu identifizieren.
Welche Erfahrungen aus der Umsetzung werden dargestellt?
Kapitel 5 präsentiert einen empirischen Überblick über Erfahrungen aus der Umsetzung von Emissionshandelssystemen in verschiedenen Ländern: den USA (US Lead Phasedown Tradable Permit Market, Acid-Rain-Programm, RECLAIM-Programm), Dänemark und Großbritannien. Diese Erfahrungen werden mit den theoretischen Erkenntnissen in Beziehung gesetzt, um die praktische Relevanz und Effektivität der verschiedenen Ansätze zu bewerten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Handelbare Umweltzertifikate, Emissionshandel, Umweltpolitik, Ordnungsrecht, Marktwirtschaft, Ökologische Effizienz, Ökonomische Effizienz, Umwelttechnologischer Fortschritt, Emissionskontrolle, Marktgleichgewicht, Implementierungsversuche, USA, Dänemark, Großbritannien.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage ist die nach der Adäquatheit handelbarer Umweltzertifikate als umweltpolitisches Instrument, unter Berücksichtigung des Abwägens zwischen ökonomischer und ökologischer Effizienz.
- Citar trabajo
- Jan Kluck (Autor), 2003, Sind handelbare Umweltzertifikate ein adäquates umweltpolitisches Instrument?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49096