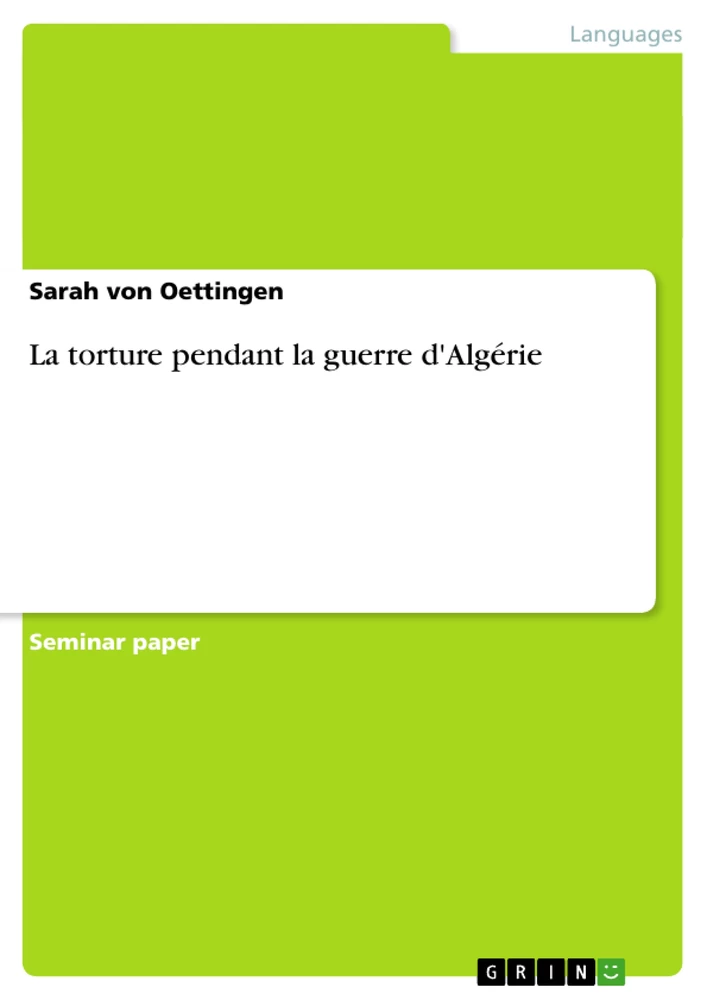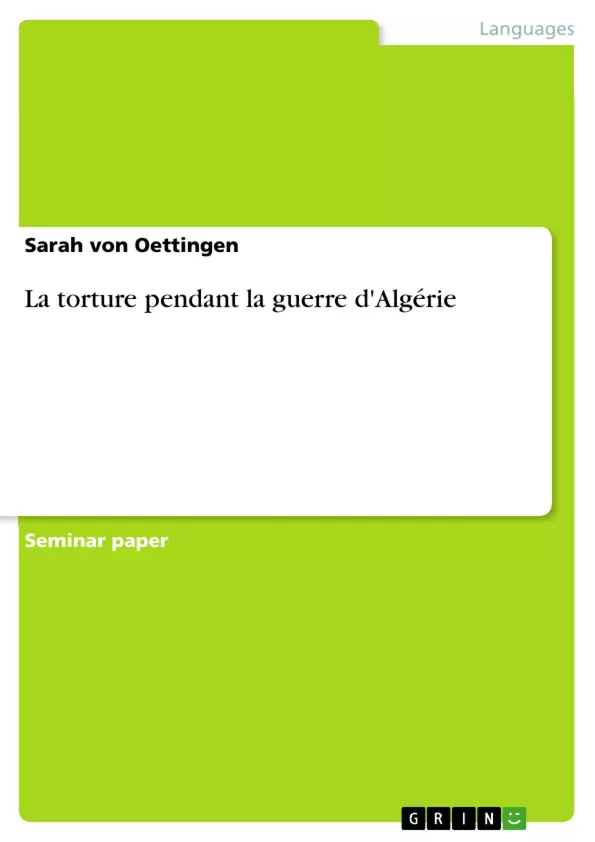I. Introduction
Quatre décennies après la fin de la " Guerre d′Algérie " en 1962, le débat sur les exactions de l′armée française en Algérie, resté tabou pendant tout ce temps-là, resurgit en France. Il fut déclenché par le témoignage de Louisette Ighilariz qui dénonce dans son article paru dans " Le Monde " le 20 juin 2000 les sévices qui lui ont été infligés en tant qu′activiste du Front de Libération Nationale (FLN) en 1957 à Alger par des militaires français. Nommément accusés dans ce témoignage, les généraux Jaques Massu et Paul Aussaresses y répondent le 23 novembre 2000 avec leurs propres témoignages en admettant l′usage de la torture et en affirmant que les plus haut fonctionnaires de l′Etat de l′époque en étaient bien au courant. Semblablement, l′ "appel des 12 " paru dans " L′Humanité " le 31 octobre 2000 par lequel douze intellectuels réclament de Lionel Jospin et de Jaques Chirac de " condamner la torture qui a été entreprise (au nom de l′Etat) durant la guerre d′Algérie (…) par une déclaration publique " suscite l′intérêt du public français.
Le brisement du tabou s′était déjà annoncé en juin 1999 par la reconnaissance officielle de la guerre par l′Assemblée Nationale : la " guerre sans nom " jusque là seulement désignée par l′expression " opérations de maintien de l′ordre " fut enfin substituée par la notion de " guerre ".
La torture et les exactions sont donc confirmées aussi bien par les victimes que par les bourreaux, chaque jour sortent de nouvelles révélations. L′objet du litige est si la torture fut justifiée comme moyen de répression du terrorisme du FLN ou non. Sinon : peut-on pénaliser les tortionnaires ?
La prise en compte de cette discussion constituera l′objectif de ce travail.
Pour aboutir à cette question, il me semble utile de tracer d′abord brièvement le contexte dans lequel se situe l′usage de la torture. En second, je travaillerai sur l′institutionalisation de la torture en me penchant sur la question du " comment ", sur les bourreaux, les victimes, les lieux et les méthodes de la torture. Je m′y appuyerai surtout sur les témoignages.
Ensuite, j′aborderai la question de la justification de de la torture.
Pour conclure, je réfléchirai sur la possibilté d′une pénalisation des tortionnaires.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Introduction
- II. La veille de la guerre
- III. L'institutionalisation de la torture
- III.1. Le pouvoir civil cède au pouvoir militaire
- III.2. Les bourreaux
- III.3. Victimes, lieux et méthodes
- IV. La fin justifie-t-elle les moyens ?
- V. Des obstacles
- VI. Conclusion
- VII. Sources
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Rechtfertigung und der möglichen Strafverfolgung von Folter während des Algerienkriegs. Die Arbeit analysiert den Kontext, in dem die Folter angewendet wurde, sowie die Institutionalisierung der Folterpraktiken. Sie befasst sich mit den Tätern, Opfern und Methoden der Folter und untersucht schließlich die Frage der rechtlichen Verantwortlichkeit.
- Der Kontext der französischen Kolonialherrschaft in Algerien und die daraus resultierenden Spannungen.
- Die Institutionalisierung der Folter durch militärische und zivile Stellen.
- Die Methoden und die Opfer der Folter.
- Die Debatte um die Rechtfertigung der Folter im Kontext des Kampfes gegen den FLN.
- Die Frage nach der strafrechtlichen Verfolgung der Verantwortlichen.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Introduction: Die Einleitung stellt den historischen Kontext der Debatte um die Folter im Algerienkrieg dar, ausgelöst durch aktuelle Zeugnisse von Opfern und Tätern. Sie beschreibt die Öffnung der Diskussion um die bis dahin tabuisierte Thematik und benennt die zentrale Forschungsfrage nach der Rechtfertigung und Strafbarkeit der Folter.
II. La veille de la guerre: Dieses Kapitel beschreibt die Vorgeschichte des Algerienkriegs, beginnend mit der französischen Kolonisierung Algeriens und der Schaffung eines ungleichen Zwei-Klassensystems. Es schildert die Unterdrückung der algierischen Bevölkerung und den Ausbruch von Aufständen, die schließlich zur Bildung nationalistischer Bewegungen und zum Beginn des Algerienkriegs führten.
III. L'institutionalisation de la torture: Dieses Kapitel untersucht die Institutionalisierung der Folterpraktiken während des Algerienkriegs. Es analysiert, wie die zivile Macht dem Militär wich und wie ausserordentliche Gesetzgebung und spezialisierte Nachrichtendienste die Anwendung von Folter ermöglichten. Es werden die Täterprofile untersucht, die Rolle der Soldaten und die Methoden der Folter, inklusive Opfer, Orte und angewandte Techniken, detailliert beschrieben.
Schlüsselwörter
Algerienkrieg, Folter, Kolonialismus, Frankreich, FLN, ALN, Militär, Zivilgesellschaft, Menschenrechte, Rechtfertigung, Strafverfolgung, Zeugnisse, Geschichte, Politische Repression.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Rechtfertigung und Strafverfolgung von Folter im Algerienkrieg
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rechtfertigung und mögliche Strafverfolgung von Folter während des Algerienkriegs. Sie analysiert den Kontext der Folteranwendung, die Institutionalisierung der Praktiken, Täter, Opfer, Methoden und die Frage der rechtlichen Verantwortlichkeit.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Kontext der französischen Kolonialherrschaft in Algerien, der Institutionalisierung der Folter durch militärische und zivile Stellen, den Methoden und Opfern der Folter, der Debatte um die Rechtfertigung der Folter im Kampf gegen den FLN und der Frage nach der strafrechtlichen Verfolgung der Verantwortlichen.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zur Vorgeschichte des Algerienkriegs ("La veille de la guerre"), zur Institutionalisierung der Folter ("L'institutionalisation de la torture"), zur Rechtfertigungsfrage ("La fin justifie-t-elle les moyens?"), zu Hindernissen der Strafverfolgung ("Des obstacles"), eine Schlussfolgerung, sowie eine Literaturliste.
Was wird im Kapitel "L'institutionalisation de la torture" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert, wie die zivile Macht dem Militär wich und wie ausserordentliche Gesetzgebung und spezialisierte Nachrichtendienste die Anwendung von Folter ermöglichten. Es untersucht Täterprofile, die Rolle der Soldaten und beschreibt detailliert die Methoden der Folter inklusive Opfer, Orte und angewandte Techniken.
Was wird in der Einleitung ("Introduction") erläutert?
Die Einleitung stellt den historischen Kontext der Debatte um die Folter im Algerienkrieg dar, ausgelöst durch aktuelle Zeugnisse von Opfern und Tätern. Sie beschreibt die Öffnung der Diskussion um die bis dahin tabuisierte Thematik und benennt die zentrale Forschungsfrage nach der Rechtfertigung und Strafbarkeit der Folter.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Thema?
Wichtige Schlüsselwörter sind Algerienkrieg, Folter, Kolonialismus, Frankreich, FLN, ALN, Militär, Zivilgesellschaft, Menschenrechte, Rechtfertigung, Strafverfolgung, Zeugnisse, Geschichte und Politische Repression.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Rechtfertigung und die mögliche Strafverfolgung von Folter während des Algerienkriegs zu untersuchen. Sie soll den Kontext, die Institutionalisierung und die Folgen der Folter analysieren.
Wie wird die Vorgeschichte des Algerienkriegs dargestellt?
Das Kapitel "La veille de la guerre" beschreibt die Vorgeschichte des Algerienkriegs, beginnend mit der französischen Kolonisierung Algeriens und der Schaffung eines ungleichen Zwei-Klassensystems. Es schildert die Unterdrückung der algierischen Bevölkerung und den Ausbruch von Aufständen, die schließlich zur Bildung nationalistischer Bewegungen und zum Beginn des Algerienkriegs führten.
- Quote paper
- Sarah von Oettingen (Author), 2002, La torture pendant la guerre d'Algérie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4911